Forschungsförderung: Wer schafft den 'Ruck'?
Zu Beginn des 21. Jahrhunderts steht die deutsche Forschungspolitik vor einer historischen Herausforderung. Die Führungsrolle im internationalen Wettbewerb hat Deutschland eingebüßt. Die entscheidenden Schritte in den Lebenswissenschaften, der Physik und der Informationstechnologie legen andere Staaten vor wie die USA, Japan, Finnland, Schweden und die Schweiz. Nachwuchswissenschaftler und Entwickler – ohnehin Mangelware – finden im Ausland bessere Chancen. Und doch hat der Forschungsstandort Deutschland in den letzten Jahren in wichtigen Positionen an Attraktivität und Effizienz zugelegt.
Es ist wie bei Alice im Wunderland: Wer auf der Stelle steht oder langsam geht, der fällt zurück. Im weltweiten Wettbewerb brauchen wir ständig neue Erkenntnisse, Produkte, Verfahren, Methoden und Systeme, um vorwärts zu kommen. Die zu konzipieren ist die klassische Aufgabe von Forschern und Entwicklern – also von Akademikern.
Doch woher nehmen? Lediglich 28 Prozent der deutschen Schulabgänger studieren. Im internationalen Rahmen liegt die Akademisierungsquote bei 45 Prozent. Der Anteil an jungen Naturwissenschaftlern in Deutschland ist nur halb so hoch wie in England oder Frankreich. Und viele der Besten arbeiten im Ausland. Dieser Exodus an Forschern veranlasste den Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft zu einer Umfrage: 43 Prozent der deutschen Wissenschaftler, die im Ausland arbeiten, denken nicht an eine Rückkehr; 44 Prozent sind unentschlossen, ob sie weiter im Ausland bleiben oder wieder nach Deutschland zurückkommen.
Im Klartext: Die Hälfte der Befragten hat im Ausland bessere Erfahrungen gemacht als im Heimatland, die andere Hälfte will bleiben, wo sie ist, bis sich Entscheidendes ändert wie etwa Karrierechancen, Arbeitsbedingungen oder die familiäre Situation. Vor allem den Ausbildungsmöglichkeiten für die Kinder wird ein hoher Stellenwert zugewiesen. Das schlechte Zeugnis der Pisa-Studie ist da für potenzielle Rückkehrer mit schulpflichtigen Kindern wenig einladend. Da hoch qualifizierte Menschen auch Wert auf die Ausbildung ihrer Kinder legen, sind hier Bildung und Forschung am Standort Deutschland untrennbar miteinander verbunden. Und die Qualität der Schulen verheißt für unsere Zukunft im globalen Wettbewerb nicht gerade vielversprechende Entwicklungen.
Es fehlt ein "Ruck", der nun quer durch die Parteienlandschaft angemahnt wird. Es braucht Nachwuchs an grauen Zellen, die in der Lage sind, Deutschlands wichtigstes Exportgut zu entwickeln: intelligente Produkte.
Dabei wird fleißig gearbeitet in Forschung und Entwicklung. Und das ist dokumentiert: 708 Gramm schwer, 638 Seiten stark ist der Faktenbericht Forschung 2002 des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). Vermutlich wäre dieser Wälzer noch umfangreicher, wäre da nicht der ausgiebige Gebrauch von Abkürzungen, die eigens in einem Anhang erläutert werden. Vom geläufigen Aids über das vielerorts er-klärungsbedürftige CCOL (Coordination Committee on the Ozone Layer) finden sich dort über GOAP (Greifswalder Bodden und Oderästuar Austauschprozesse) bis zu ZUMA (Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen in Mannheim) Erläuterungen zu rund 500 Kürzeln. Eine Momentaufnahme deutscher Forschung.
Nun sagt die opulente Zahl und Vielfalt allein noch wenig über die Qualität aus. Fast grenzt es an Vermessenheit, angesichts dieses reichen Spektrums an Betätigungsmöglichkeiten für geschulte Geister anzunehmen, das Forschungssystem Deutschlands, das in vielfacher Hinsicht schon längst auch globalisiert ist, wäre in irgendeiner Form leichter zu regieren und zu handhaben als irgendein Land oder eine Staatengemeinschaft.
Kann ein solch komplexes System gesteuert werden, und sind Erfolge und Innovationen überhaupt durch übergeordnete Instanzen planbar? Der soeben ausgeschiedene Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, Hubert Markl, weist in einem kritischen Beitrag über zu viel Bürokratie und Regulierungswut in Deutschland darauf hin, dass die USA, die in fast allen wichtigen Forschungsdisziplinen führend sind, ohne eigenes Wissenschaftsministerium auskommen. Stattdessen lässt sich ihre Regierung von Spitzenwissenschaftlern permanent beraten.
Die gegenwärtige rot-grüne Regierung Deutschlands hat in der Forschung kräftig zugelegt. Gleichwohl ist sie vom Wahlversprechen aus dem Jahr 1998, den Etat für Forschung und Bildung in der jetzt zu Ende gehenden Legislatur-periode um fünfzig Prozent zu erhöhen, weit entfernt geblieben. Immerhin: Sie kehrte den seit 1990 fortgesetzten Abwärtstrend in den Ausgaben für Forschung und Entwicklung um. Seit Herbst 1998 ist eine kontinuierliche Steigerung der Aufwendungen von 2,2 Prozent auf 2,4 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt zu verzeichnen. Das sind Schritte in die richtige Richtung – doch der Weg bis zu den großen Mitbewerbern auf den Zukunftsmärkten, den USA (2,7 Prozent) und Japan (über 3 Prozent), ist noch weit. Schweden und Finnland geben 3,7 beziehungsweise 3,1 Prozent ihres Bruttoinlandsproduktes für Forschung und Entwicklung aus. Und sie haben Erfolg damit.
Fraglich ist allerdings, ob das Ziel der Wettbewerbsfähigkeit allein über finanzielle Mittel zu erreichen ist. Denn fest steht: Die Qualität der Innovationen ist allenfalls locker mit dem Volumen der Förderung durch die öffentliche Hand verbunden. Haben die großen Forscher und Entwickler Deutschlands, auf die wir uns so gern berufen, jemals ansehnliche finanzielle Unterstützung genossen? Johannes Gutenberg hat seine Druckerpresse mit geborgtem Geld entwickelt, Alexander von Humboldt seine Forschungsreisen aus eigenen Mitteln finanziert und Nikolaus August Otto den Viertaktmotor als Tüftler und in Diensten von Unternehmen zusammengebaut.
Der Wissenschaftshistoriker Klaus Fischer von der Universität Trier bringt es auf den Punkt: "Keine der Basisinnovationen, die die Geschichte der Wissenschaften, der Technik und der Kultur bestimmt haben, wurde je auf der Grundlage eines genauen Planes, eines begutachteten Forschungsprojektes oder einer staatlichen Forschungsinitiative geschaffen. Die großen Durchbrüche der Wissenschaft – die "Revolutionen" in Astronomie, Physik, Chemie, Biologie und Medizin – sind ausnahmslos von weit blickenden Einzelpersonen erzielt worden, fern von den Geldtöpfen der Wissenschaftsförderer ..." (Aus: Die verborgenen Quellen des Neuen, Kreativität und Planung im wissenschaftlich-technischen Fortschritt, Trier 2001)
Biotechnologie als Jobmaschine und Wachstumsmotor
Immerhin: Die Steigerung der Forschungsmittel um über 19 Prozent während der Amtsdauer der jetzigen Regierung und die geplante Fortschreibung der Zuwächse – wenn auch für das Jahr 2002 in der Größenordnung von 9 auf 9,1 Milliarden Euro im kleineren Rahmen – ist angesichts leerer Kassen ein deutliches Bekenntnis der gegenwärtigen Regierungskoalition zur Rolle der Forschung in Deutschland. Im Sog dieser Investitionen ist der Anteil privater Ausgaben für die Forschung um 21 Prozent gestiegen.
Überdurchschnittlich profitierten von den Steigerungen der Legislaturperiode:
| Biotechnologie | + 27,6 % |
| Informationstechnologie | + 19,8 % |
| Mobilität und Verkehr | + 18,2 % |
| Strukturelle/innovative und Querschnittsaktivitäten | + 16,9 % |
| Meeres- und Polarforschung, Meerestechnik | + 14,2 % |
| Ernährung | + 13,8 % |
| Raumforschung, Städtebau, Bauforschung | + 12,3 % |
Die Forschungspolitik hat in unserer modernen Mediendemokratie den Nachteil, dass sie von der Öffentlichkeit weniger beachtet wird als andere Politikfelder. Es fehlen solch große Aufreger wie Terrorismus, Arbeitslosigkeit, BSE oder Nitrofen, aus denen Ministerien Relevanz und Präsenz beziehen. Die Pisa-Studie machte den Handlungsbedarf in der Bildung deutlich. Ausbleibende Erfolge in der Forschungspolitik sind hingegen eher leise. Sie werden von der Öffentlichkeit und den Medien jedenfalls weniger wichtig genommen als Niederlagen der Fußballnationalmannschaft.
Für die Erfolge der Forschung gibt es eine griffige neue Formel der Politik: Erfolg der Forschung EF ist die Summe aus der Anzahl der Arbeitsplätze A, der Anzahl der Betriebe B und dem Umsatz U. Und das Ganze im internationalen Vergleich, immer orientiert am Marktführer. Es ist ein neues, unverbrämtes Bild der Wissenschaft. Forschung im Elfenbeinturm, als Selbstzweck, als Ornament der Herrschenden – passé. Eine Verschlichtung, an der große Medien und politische Parteien kräftig feilen.
Als führend im Potenzial als Jobmaschine und Wachstumsmotor wurde über die vergangenen drei Jahre die Biotechnologie von allen politischen Parteien gesehen. Eine Euphorie zeichnete sich ab, die beinahe schon vergleichbar dem Internet-Hype war. Nur Spielverderber, Ignoranten und Miesepeter mochten da abseits stehen. Doch Investoren, die den Crash zahlreicher Internetfirmen noch frisch vor Augen haben, sind heute eher zögerlich. Während sie die Biotechnologien im ersten Quartal des Vorjahrs noch mit Investitionen in Höhe von 180 Millionen Euro bedachten, waren es im ersten Quartal 2002 nur 16 Millionen Euro. Die Entwicklungszeiten und der return on investments erfordern deutlich längeren Atem als die Resultate der Dotcoms. Zudem findet der Investor auf diesem neuen Markt der Biotechnologien keine Referenzen und Erfahrungswerte, auf die er sich beziehen kann, die ihm helfen, das Risiko abzuschätzen. Und wird sein Favorit als Erster ins Ziel kommen oder bringt ein Mitbewerber aus den USA, Taiwan oder Indien ein konkurrierendes Produkt schneller auf den Markt?
Das Kapital ist ein scheues Reh. Hier kann die öffentliche Hand also offensichtlich durch Forschungsförderung einen wichtigen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit leisten. Im wohl verstandenen Eigeninteresse – denn qualifizierte Wissenschaftler werden weltweit gesucht. Sie werden dahin ziehen, wo sie arbeiten können, und wir alle verlieren dies Kapital für die Zukunft.
Eine Zukunft, die noch in der neuesten BMBF-Publikation "im Detail" rosig geschildert wird: "Deutschland hat seine führende Position in der Biotechnologie weiter ausgebaut. Von derzeit rund 1500 kleinen und mittleren Biotech-Unternehmen in Europa sind über 330 in Deutschland ansässig. Das bedeutet Platz 1 vor Großbritannien mit 280 Unternehmen. Wir nehmen auch den Spitzenplatz in Europa bei der Zahl der Unternehmensneugründungen ein. Der Gesamtumsatz der deutschen Unternehmen hat sich im Jahr 2000 mit 719 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Die Zahl der Beschäftigten stieg im gleichen Zeitraum um über dreißig Prozent auf mehr als 10000." In sieben bis zehn Jahren, so schätzt das BMBF, werde die Zahl über 50000 liegen.
"You talked the talk, now walk the walk", so ein englisches Sprichwort, das nach Worten Taten anmahnt. Doch der Weg nach Toronto und ein deutliches Flaggezeigen in Schwarzrotgold wurde auf der weltgrößten Biotechnologiemesse, der Bio 2002, diesen Juni in Kanada vermisst. Kein Bundesminister aus Forschung oder Wirtschaft ließ sich dort sehen, wo er doch seine Amtskollegen aus vielen anderen einschlägig engagierten Ländern hätte treffen können. "… walk the walk?" Für die über 15000 Teilnehmer der Veranstaltung gab es auch keinen deutschen Stand als Anlaufstelle. Aber gerade hier wäre Präsenz wichtig gewesen, und gerade jetzt, wo sich nach all der positiven Aufbruchstimmung erste hässliche Realitäten zeigen. Die gefeierte Boombranche erlebt ihre ersten Pleiten. Im bayerischen "Silicon Valley" der Biotechnologie, dem Münchner Vorort Martinsried, stehen erstmals Flächen leer. Zwei Firmen sind diesen Sommer hier bereits in Konkurs gegangen.
Kenner der Branche erwarten eine "knallharte Selektion", so Ernst-Dieter Jarasch von der BioRegion Rhein-Ne-ckar-Dreieck. Vermutlich nur vierzig bis fünfzig der gegenwärtigen Unternehmen würden die nächsten Jahre überleben. "Und die Einsicht wächst", kommentiert die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (16.06.2002), "dass der staatliche Geldsegen auch manche unprofitable oder unrealistische Idee mit einem Firmenschild versehen hat."
Die Positionen der Parteien
Ungebremst von Realitäten sind allerdings noch die Perspektiven. Die Parteien erhoffen sich von den biotechnologischen Innovationen einen gewaltigen Effekt auf Konjunktur und Arbeitsmarkt. Denn es wird erwartet, dass unter den dreißig wichtigsten Innovationen bis zum Jahr 2020 die Hälfte mittels biotechnologischer Methoden entwickelt werden. Verständlich, dass keine der politischen Parteien, die jetzt um die Gunst der Wähler kämpfen, hier das Mauerblümchen spielen will. Dabei sein wollen alle – zumindest als Bedenkenträger.
Die SPD will die Förderung der bisher gesetzten Schwerpunkte fortsetzen. Im Faktenbericht heißt es hierzu: "Die Entwicklung der Ausgaben des Bundes für Forschung und Entwicklung und dabei insbesondere die des BMBF sind ein zentrales Kennzeichen für künftige Schwerpunkte, in denen wissenschaftlicher Fortschritt mit Hilfe staatlicher Finanzmittel gefördert werden sollen."
Bündnis 90/Die Grünen stellen in ihrem Grundsatzprogramm Bedenken und Problembewusstsein in den Vordergrund. Aber: "Das Potenzial der Bio- und Gentechnik, Therapien für bislang unheilbare Krankheiten zu finden, wollen wir nutzen. Allerdings findet auch diese Technologie ihre Grenzen in der Unantastbarkeit der Würde des Menschen. Verbrauchende Embryonenforschung, das Klonen von Menschen oder verpflichtende Gentests lehnen wir ab." So beschlossen auf der Bundesdelegiertenkonferenz in Wiesbaden letzten Mai. Wobei man mit dem wuchtigen letzten Satz gleich drei offene Türen einrennt.
Bei CDU/CSU klingt gelegentlich eine biotechnologische Aufbruchstimmung an. Kanzlerkandidat Edmund Stoiber ist ja schon seit Jahren aktiver Förderer der Biotechnologien in Bayern. So dürfte das im Antrag der CDU/CSU-Fraktion dokumentierte Bekenntnis Programm werden: "Die Biowissenschaften bieten die Chance, zur Lösung zahlreicher globaler Probleme im Zusammenhang mit Gesundheit, Alter, Ernährung und Umwelt sowie nachhaltiger Entwicklung beizutragen. Die Bio- und Gentechnologie ist eine Leittechnologie der nächsten Jahrzehnte." Allerdings verlangt das "C" im Parteinamen eine Differenzierung. Die CDU-Wertekommission tritt für eine restriktive Haltung bei der heiklen Frage der Reproduktionsmedizin ein. So lehnt sie eine Präimplantationsdiagnostik ab, ist für ein Verbot der Herstellung menschlicher Stammzellen und des therapeutischen Klonens.
Klar positiv äußert sich die FDP: "Die moderne Biotechnologie ist eine Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts. Als Querschnittstechnologie für sehr unterschiedliche Einsatzfelder … hat sie entscheidenden Anteil an der weiteren Entwicklung des Wissenschafts-, Technologie- und Wirtschaftsstandortes Deutschland. Die FDP will die Chancen, die sich aus der Genomforschung und der Anwendung gentechnischer Verfahren in der Humanmedizin (Rote Gentechnik), der Landwirtschaft (Grüne Gentechnik) und der industriellen Produktion (Graue Gentechnik) ergeben, aktiv nutzen." (aus: Liberale Argumente, Thesen zur Biotechnologie 4/01).
Von der PDS ist überwiegend Skepsis zu hören: "Rot-Grün steckt den Löwenanteil der Forschungsförderung in Prestigeprojekte wie den Transrapid und die Internationale Raumstation, in Satellitenprogramme, in die Kernfusion und die Militärforschung. Stärker als bisher werden die umstrittenen Gentechnologien gefördert, obwohl ihre ökologischen und sozialen Auswirkungen für Menschen, Tiere und Pflanzen nicht absehbar sind..." (aus: PDS-Politik von A-Z, der Internetseite www.pds-im-bundestag.de).
Starker Skeptizismus gegen Innovationen scheint sich zu einem weltweit beachteten Merkmal Europas entwickelt zu haben. Der englische Premierminister Tony Blair prangerte dies kürzlich als "Kultur der Unvernunft" an:
"In Bangalore traf ich Wissenschaftler, die in der Biotechnologie forschten. Sie sagten mir: ‚Europa verliert den Anschluss – ihr könnt bald zusehen, wie wir an euch vorbeiziehen.‘ Erstaunt waren sie über die Gentechnik-Debatte hier und im übrigen Europa und meinten, wir seien komplett im Griff von Protestbewegungen und Pressure Groups, die mit Emotionen die Vernunft besiegen. Und sie glauben nicht, dass wir die politische Kraft haben, uns vehement für die wissenschaftliche Seite einzusetzen. Wenn wir kein besseres Verständnis der Wissenschaft und ihrer Rolle entwickeln, so fürchte ich, werden sie Recht behalten."
So klar hat sich bisher noch kein deutscher Regierungschef zur Forschung bekannt.
Aus: Spektrum der Wissenschaft 8 / 2002, Seite 90
© Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH

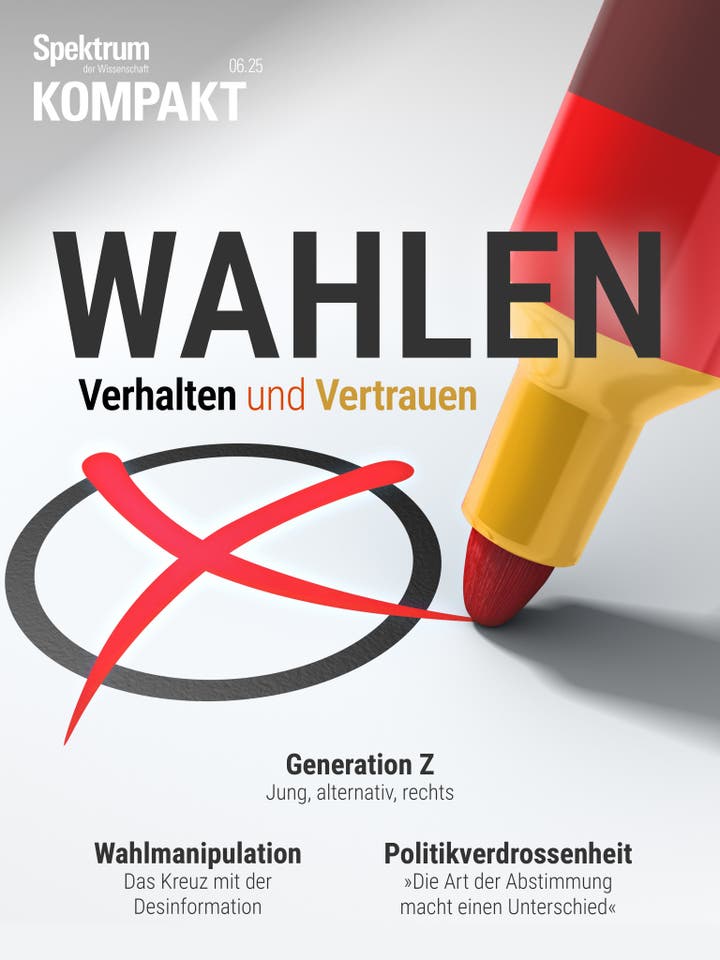

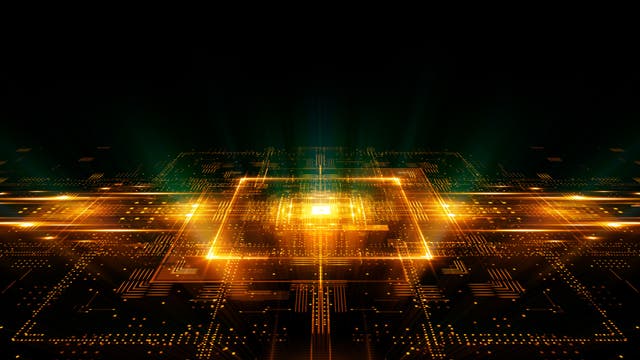


Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben