Wie grün sind grüne Kunststoffe?
Es ist mittlerweile möglich, Kunststoffe aus Pflanzen statt aus nicht erneuerbaren fossilen Brennstoffen herzustellen. Aber sind diese "natürlichen" Polymere wirklich so umweltfreundlich, wie sie auf den ersten Blick scheinen?
Ein Farmer im Herzen Iowas. Während er die staubige Landstraße entlangfährt, lässt er seinen Blick zufrieden über die Reihen hoher, blattreicher Maispflanzen schweifen, die sich, sachte im Wind schwankend, bis zum Horizont erstrecken. Lächelnd denkt er daran, dass nur wenige um das Geheimnis dieser Pflanzen wissen: Nicht nur, dass Maiskörner in den Kolben heranreifen ? an den Stängeln und Blättern wachsen auch Kunststoffkörnchen.
Dieses idyllische Bild könnte bald Wirklichkeit werden, und es erscheint um vieles sympathischer als die Herstellung von Polymeren in petrochemischen Fabriken, die weltweit jedes Jahr etwa 270 Millionen Tonnen Öl und Gas verbrauchen. Fossile Brennstoffe liefern sowohl die Energie als auch das Ausgangsmaterial für die Umwandlung von Rohöl in gängige Kunststoffe wie Polystyrol, Polyethylen und Polypropylen.
Polymere sind aus unserem Alltag kaum mehr wegzudenken ? von Plastikflaschen über Kunstfasern bis zu Gartenstühlen und Autoteilen begegnen sie uns auf Schritt und Tritt. Umweltschützer weisen jedoch zunehmend darauf hin, dass ihre Herstellung der Forderung nach Nachhaltigkeit nicht genüge tut. Die zur Zeit bekannten weltweiten fossilen Ölvorräte werden in etwa 80 Jahren aufgebraucht sein, Erdgas in 70 und Kohle in 700 Jahren. Ökonomisch könnte sich die Erschöpfung der Lagerstätten jedoch schon viel früher auswirken. Bei knappen Ressourcen steigen die Preise ? das ist auch den Verantwortlichen in der Politik nicht entgangen. Im August 1999 erließ US-Präsident Bill Clinton eine Verfügung, die den Ersatz fossiler Ressourcen durch pflanzliche Stoffe als Energie und Rohmaterialquelle zum Forschungsziel erklärt.
Vor diesem Hintergrund waren Biotechnologen wie wir beide hoch erfreut über die erfolgreiche Entwicklung von Methoden, Kunststoffe in Pflanzen "anzubauen". Oberflächlich betrachtet, schien dieser technologische Durchbruch das Nachhaltigkeitsproblem ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen; denn Kunststoffe auf pflanzlicher Basis wären in zweifacher Hinsicht "grün": sie stammten aus einer erneuerbaren Ressource und würden nach Gebrauch wieder natürlich abgebaut.
Jüngste Forschungsergebnisse wecken jedoch Zweifel an dieser optimistischen Sicht. Zum einen enthält die biologische Abbaubarkeit verborgene Kosten: Bei der Kompostierung werden nämlich Treibhausgase wie Kohlendioxid und Methan freigesetzt, deren Emissionen internationale Anstrengungen zu reduzieren versuchen. Wichtiger aber ist, dass man zur Extraktion der Kunststoffe aus den Pflanzen immer noch fossile Brennstoffe als Energiequelle benötigt, und unsere Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass dieser Energiebedarf weitaus größer ist als erwartet. Der Erfolg der Herstellung grüner Kunststoffe hängt also davon ab, ob Wissenschaftler ökonomische Wege finden, die Hürde dieses hohen Energieverbrauchs zu überwinden und zugleich zusätzliche Umweltbelastungen zu vermeiden.
Die traditionelle Kunststoffherstellung trägt überraschend viel zum Verbrauch an fossilen Brennstoffen bei. Automobile, Lastwagen, Flugzeuge, Heizungen und Kraftwerke verschlingen zwar den Löwenanteil ? mehr als 90 Prozent ? des Ausstoßes der Rohölraffinerien, der Rest aber geht zum größten Teil in die Kunststoffproduktion, in den USA allein rund 80 Millionen Tonnen im Jahr. Bisher verfolgten Biotechnologie und Agrarindustrie bei ihren Bemühungen, herkömmliche Polymere durch Alternativen auf Pflanzenbasis zu ersetzen, im Wesentlichen drei Ansätze: die Umwandlung pflanzlicher Zucker in Kunststoffe, die Kunststoffproduktion in Mikroorganismen und den Anbau von Kunststoffen in Feldfrüchten wie Mais.
Cargill, ein Riese in der Agrarindustrie, und Dow Chemical, ein führendes Chemieunternehmen, gründeten vor drei Jahren eine gemeinsame Tochterfirma, um mit vereinten Kräften den erstgenannten Ansatz voranzutreiben, nämlich Zucker aus Mais und anderen Pflanzen in ein Plastikmaterial namens Polylactid (PLA) zu konvertieren. Zunächst wandeln Mikroorganismen den Zucker dabei in Milchsäure um. In einem zweiten Schritt werden die Milchsäuremoleküle dann zu Polymerketten verbunden, deren Eigenschaften denen von Polyethylenterephthalat (PET) ähneln ? jenem petrochemisch hergestellten Kunststoff, aus dem Plastikflaschen und bestimmte Textilfasern bestehen.
Die Suche nach neuen Produkten auf der Basis von Maiszucker war eine natürliche Erweiterung von Cargills Aktivitäten auf dem Sektor der Nassmühlenverfahren, bei denen aus Maiskörnern Produkte wie Maissirup mit hohem Fruktosegehalt, Zitronensäure, Pflanzenöl und Tierfutter hergestellt werden. 1999 verarbeitete diese Industrie fast 39 Millionen Tonnen Mais ? etwa 15 Prozent der Jahresernte der USA. Anfang dieses Jahres nun startete Cargill Dow ein 300-Millionen-Dollar-Projekt mit dem Ziel, Ende 2001 die Massenproduktion ihres neuen Kunststoffs, Nature-Works? PLA, aufzunehmen.
Unternehmen wie Imperial Chemical Industries entwickelten Verfahren zur Produktion eines anderen Kunststoffs, Polyhydroxyalkanoat (PHA). Wie PLA wird er aus pflanzlichem Zucker hergestellt und ist biologisch abbaubar. Im Fall von PHA wandelt das Bakterium Ralstonia eutropha den Zucker jedoch direkt in Kunststoff um. Während zur Synthese von PLA ein Schritt außerhalb des Organismus erforderlich ist, reichert sich PHA ganz natürlich in den Mikroben an ? in Form von Körnchen, die bis zu 90 Prozent der Masse einer Zelle ausmachen können.
Imperial Chemical Industries realisierte diesen Fermentationsprozess in industriellem Maßstab als Antwort auf die Ölkrisen der siebziger Jahre und ließ seine Mikroben pflanzlichen Zucker in mehrere Tonnen PHA pro Jahr konvertieren. Andere Firmen stellten aus dem Kunststoff dann kommerzielle Artikel wie biologisch abbaubare Rasierer und Shampooflaschen (Wella) her, die in bescheidenen Mengen verkauft wurden. PHA kostete jedoch, wie sich zeigte, in der Herstellung wesentlich mehr als sein Gegenstück aus fossilen Brennstoffen und bot außer der biologischen Abbaubarkeit keine Vorteile in den Gebrauchseigenschaften. 1995 kaufte Monsanto das Verfahren und die zugehörigen Patente, konnte es aber nicht profitabel machen.
Seitdem haben viele akademische Forschungsgruppen und kommerzielle Unternehmen, einschließlich Monsanto, ihre Anstrengungen darauf gerichtet, PHA nach dem dritten Ansatz herzustellen, es also direkt von Pflanzen erzeugen zu lassen. Gelänge es, Feldfrüchte genetisch so umzuprogrammieren, dass sie den Kunststoff während ihres Wachstums synthetisieren, würde der Fermentationsschritt ganz umgangen. Man könnte PHA also direkt in der Pflanze erzeugen statt es über den langwierigen Prozess von Anbau, Ernte, Zuckergewinnung und schließlich Fermentierung zu produzieren. Viele Forscher sehen das als die effizienteste ? und eleganteste ? Lösung für die Herstellung von Kunststoff aus erneuerbaren Ressourcen an, und etliche Arbeitsgruppen verfolgen auch heute noch intensiv dieses Ziel.
Mitte der achtziger Jahre arbeitete einer von uns (Slater) in einer Forschungsgruppe an der Isolierung von Genen mit der Bauanleitung für Enzyme, mit deren Hilfe Bakterien Polymere herstellen können. Brächte man diese Gene in eine Pflanze ein, würden sie, so die Erwartung, dort dafür sorgen, dass Acetylcoenzym A ? ein natürliches Zwischenprodukt bei der Photosynthese ? in eine Art Kunststoff umgewandelt wird. Tatsächlich gelang Forschern der Michigan State University und der James Madison University in Virginia 1992 gemeinsam dieser Kunstgriff. Durch Genmanipulation brachten sie die Ackerschmalwand ? das bevorzugte "Versuchskaninchen" der Pflanzengenetiker ? dazu, sprödes PHA zu produzieren. Zwei Jahre später begannen Wissenschaftler bei Monsanto, an der Erzeugung von flexiblerem PHA in einer gängigen landwirtschaftlichen Nutzpflanze zu arbeiten: Mais.
Damit die Kunststoffproduktion nicht mit der Nahrungsmittelproduktion konkurrieren würde, fassten die Forscher den Teil der Pflanze ins Auge, der üblicherweise nicht geerntet wird: die Blätter und den Stängel. Würde man darin Kunststoff wachsen lassen, könnten die Farmer den Mais nach wie vor mit einem traditionellen Mähdrescher ernten; dann würden sie das Feld ein weiteres Mal durchkämmen und die kunststoffhaltigen Stängel und Blätter einsammeln. Im Unterschied zur Produktion von PLA und PHA durch Fermentierung, die eine Konkurrenz um Land impliziert, das auch mit anderen Nutzpflanzen bestellt werden könnte, hat man hier den Vorteil, dass Korn und Plastik vom gleichen Feld geerntet werden. (Mit Pflanzen wie Rutenhirse (Panicum virgatum), die auch auf landwirtschaftlich nur schlecht nutzbarem Boden gedeihen, ließe sich diese Konkurrenz zwischen Kunststoff- und Nahrungsproduktion ebenfalls umgehen.)
Auf zwei Gebieten sind mittlerweile bedeutende technologische Fortschritte gemacht worden: Der Kunststoffanteil in der Pflanze konnte erhöht und die Zusammensetzung des Kunststoffs so modifiziert werden, dass er günstige Gebrauchseigenschaften aufweist. Einzeln betrachtet, sind diese Ergebnisse sehr ermutigend; allerdings hat es sich als schwierig erwiesen, beide Ziele gleichzeitig zu erreichen. Nach aller bisherigen Erfahrung sind die Chloroplasten der Blätter der beste Ort für die Kunststoffherstellung. Aber das Chloroplast ist eine grüne Organelle, die Licht einfängt; deshalb könnten hohe Kunststoffkonzentrationen die Photosynthese behindern und den Kornertrag reduzieren.
Das Problem: Energie und Emissionen
Auch das Herauslösen des Kunststoffs aus der Pflanze bereitet enorme Probleme. Ursprünglich dachte man bei Monsanto, dazu genüge eine Zusatzeinheit in einer bestehenden Anlage zur Maisverarbeitung. Aber als sich die Verfahrenstechniker an den konkreten Entwurf machten, stellten sie fest, dass für das Extrahieren und Zusammenführen des Kunststoffs große Mengen Lösungsmittel benötigt würden, das man nach Gebrauch zurückgewinnen müsste. Die erforderliche Infrastruktur des Verfahrens erreichte damit Dimensionen wie bei bestehenden petrochemischen Kunststofffabriken und übertraf die Größe der ursprünglichen Kornmühle.
Mit genügend Zeit und Forschungsmitteln könnten diese technischen Schwierigkeiten vermutlich überwunden werden. Und so hatten wir beide in der Tat geplant, unsere wissenschaftlichen Aktivitäten für die nächsten Jahre auf die Entwicklung biologisch abbaubarer Kunststoffe zu richten. Aber ein gewichtiger Einwand ließ uns zweifeln, ob es sich überhaupt lohne, nach Lösungen dieser Art zu suchen. Als wir den Bedarf an Energie und Rohstoffen für jeden einzelnen Schritt zur Gewinnung von PHA aus Pflanzen berechneten ? Ernten, Trocknen von Stängeln und Blättern, Extraktion von PHA, Reinigung des Kunststoffs, Abtrennen und Recycling des Lösungsmittels, Mischen des Kunststoffs zur Herstellung eines Granulates ? kamen wir zu dem Ergebnis, dass auf diese Weise insgesamt mehr fossile Ressourcen verbraucht würden als bei der konventionellen petrochemischer Produktion.
Unserer jüngsten Studie zufolge, die wir zusammen mit einigen Kollegen angefertigt und dieses Frühjahr fertig gestellt haben, benötigt die Herstellung eines Kilogramms PHA aus genetisch modifizierten Maispflanzen dreimal so viel Energie wie die 29 Megajoule, die bei der Herstellung derselben Menge Polyethylen aus fossilen Brennstoffen verbraucht werden. Zu unserer großen Enttäuschung konnte die Tatsache, dass Mais statt Erdöl als Rohstoff dient, diesen höheren Energieverbrauch nicht wettmachen. Gemäß dem derzeitigen Energieverbrauch der getreideverarbeitenden Industrie bräuchte man 2,65 Kilogramm fossilen Brennstoffs, um den Energiebedarf für die Herstellung eines einzigen Kilogramms PHA zu decken. Nach Daten, die von der Europäischen Vereinigung der Kunststoffhersteller (APME) bei 36 europäischen Kunststoffwerken erhoben wurden, benötigt ein Kilogramm Polyethylen dagegen nur etwa 2,2 Kilogramm Öl und Erdgas, von denen fast die Hälfte in das Endprodukt gelangt. Das heißt, dass lediglich 60 Prozent der Gesamtmenge ? 1,3 Kilogramm ? zur Energieerzeugung verbrannt werden müssen.
Angesichts dieser Zahlen lässt sich wohl kaum behaupten, dass in Mais gewachsener und mit Energie aus fossilen Brennstoffen extrahierter Kunststoff die fossilen Ressourcen schont. Was man beim Ersatz der begrenzten Ressource durch die erneuerbare gewinnt, geht durch den zusätzlichen Energiebedarf wieder verloren. In einer früheren Studie hatte einer von uns (Gerngross) gezeigt, dass die Produktion eines Kilogramms PHA durch mikrobielle Fermentierung eine ähnlich große Menge ? 2,39 Kilogramm ? an fossilem Brennstoff erfordert. Entmutigende Erkenntnisse dieser Art waren mit ein Grund dafür, dass Monsanto, der technologische Spitzenreiter bei der Herstellung von pflanzlichem PHA, Ende letzten Jahres das Aus für die Entwicklung Kunststoff produzierender Feldfrüchte ankündigte.
Das einzige Polymer auf Pflanzenbasis, das derzeit kommerziell entwickelt wird, ist PLA von Cargill Dow. Seine Herstellung benötigt 20 bis 50 Prozent weniger Energie aus fossilen Ressourcen als die Produktion von Kunststoff aus Erdöl, ist aber immer noch viel energieaufwendiger als die meisten petrochemischen Verfahren. Unternehmensvertreter von Cargill-Dow erwarten, dass der Energiebedarf weiter sinken wird; dennoch muss das Verfahren Jahrzehnte an Forschung und Entwicklung aufholen, die ihm die petrochemische Konkurrenz voraus hat. Die Erschließung alternativer Quellen für pflanzlichen Zucker wie Weizen und Rüben, deren Aufbereitung weniger Energie benötigt, ist eine Möglichkeit, den Verbrauch an fossilen Brennstoffen zu drosseln. Mittlerweile schätzen Wissenschaftler bei Cargill Dow, dass die erste Produktionsstätte für PLA, die gerade in Blair (Nebraska) gebaut wird, höchstens 56 Megajoule je Kilogramm Kunststoff verbrauchen wird ? 50 Prozent mehr als für PET, aber 40 Prozent weniger als für Nylon, ein weiteres petrochemisches Konkurrenzprodukt von PLA.
Die Energie, die für die Produktion von Kunststoffen auf pflanzlicher Basis benötigt wird, ist jedoch in einem weiteren, vielleicht noch schwerer wiegenden Sinne bedenklich für die Umwelt. Zur konventionellen Kunststoffherstellung wird hauptsächlich Erdöl genutzt; bei der Produktion von Kunststoffen in Pflanzen dagegen dienen ? wie in der Getreide anbauenden und verarbeitenden Industrie allgemein ? Kohle und Erdgas als Hauptenergiequellen. Jedes Verfahren zur Herstellung von Kunststoffen auf pflanzlicher Basis bedeutet somit auch einen Wechsel von einem knapperen Brennstoff (Erdöl) zu einem weniger knappen (Kohle). Einige Fachleute behaupten, dies sei ein Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. Dabei übersehen sie jedoch, dass bei der Kunststoffproduktion aus erneuerbaren Rohstoffen wie Mais alle fossilen Brennstoffe zur Energiegewinnung verfeuert werden, während bei den petrochemischen Verfahren ein bedeutender Anteil davon in das Endprodukt gelangt.
Das Verheizen von mehr fossilen Brennstoffen verschärft das globale Klimaproblem, indem es den Ausstoß an Treibhausgasen wie Kohlendioxid erhöht. Außerdem dürften die Emissionen anderer Schadstoffe wie Schwefeldioxid steigen, das zum sauren Regen beiträgt. Mehr noch: Jeder Produktionsprozess, der solche Emissionen erhöht, steht in eklatantem Gegensatz zum Protokoll von Kioto. Dieses internationale Abkommen unter der Regie der Vereinten Nationen hat zum Ziel, durch Reduktion des Eintrags von Kohlendioxid und anderen Gasen in die Atmosphäre die Luftqualität zu verbessern und die globale Erwärmung abzuschwächen.
Die Schlussfolgerung aus unseren Analysen war unausweichlich: Der Nutzen, den der Anbau von Kunststoff in Pflanzen für die Umwelt hat, wird durch einen nicht zu rechtfertigenden Anstieg von Energieverbrauch und Gasemissionen zunichte gemacht. Einzig PLA könnte in dieser Hinsicht mit petrochemischen Kunststoffen mithalten. Seine Herstellung ist zwar nicht ganz so elegant wie der Anbau von PHA in Pflanzen, profitiert aber von wesentlichen Merkmalen eines effizienten Verfahrens: niedrigem Energieverbrauch und hohen Ausbeuten (fast 80 Prozent des pflanzlichen Zuckers gelangen in das Endprodukt). Dennoch hat auch die Herstellung von PLA den unvermeidlichen Nachteil, mehr Treibhausgase freizusetzen als viele entsprechende petrochemische Verfahren.
So ernüchternd unsere anfänglichen Analysen waren, wollten wir doch nicht glauben, dass die Technologien auf Pflanzenbasis nicht zu retten wären. So überlegten wir uns, dass die Verbrennung von Biomasse, also pflanzlichem Material wie etwa Stroh, den zusätzlichen Energiebedarf decken könnte. Die dabei anfallenden Kohlendioxid-Emissionen wären weniger negativ zu bewerten als die beim Verbrennen fossilen Kohlenstoffs, der Millionen von Jahren unter der Erde gelegen hat. Sie ließen den Kohlendioxidgehalt der Luft insgesamt nicht steigen, da die neu wachsenden Pflanzen im nächsten Frühjahr die Gasmenge, die beim Verbrennen freigesetzt wurden, wieder aufnehmen würden. (Aus demselben Grund erhöht auch das Verbrennen von Kunststoffen auf pflanzlicher Basis den Kohlendioxidgehalt nicht.)
Die Lösung: erneuerbare Energie
Folglich argumentierten wir und andere Forscher, dass sich mit Biomasse als Primärenergiequelle in der getreideverarbeitenden Industrie die Kunststoffproduktion von fossilen Ressourcen abkoppeln ließe. Bevor es soweit ist, müssten jedoch noch einige technologische Hürden genommen werden, und eine völlig neue Infrastruktur zur Energieerzeugung wäre zu etablieren. Wird das je passieren? Bei der Energieproduktion zeigen sich in den US-Bundesstaaten mit Maisanbau eher gegenläufige Tendenzen. Die meisten bezogen 1998 einen überproportionalen Anteil ihrer elektrischen Energie aus Kohlekraftwerken ? Iowa zum Beispiel 86 und Indiana sogar 98 Prozent ?, während der nationale Durchschnitt bei 56 Prozent lag. (Andere Bundesstaaten gewinnen einen größeren Teil ihrer Energie aus Erdgas, Öl, Kern- und Wasserkraft.)
Sowohl Monsanto als auch Cargill Dow denken über Strategien zur Energiegewinnung aus Biomasse nach. Bei ihrer theoretischen Analyse nahmen die Monsanto-Forscher an, das gesamte Stroh, das nach der Extraktion des Kunststoffs übrig blieb, würde zur Gewinnung von Elektrizität und Dampf verbrannt. Die so erzeugte Strommenge aus Biomasse wäre mehr als ausreichend, um die Extraktion von PHA mit Energie zu versorgen. Der Überschuss könnte von der PHA-Extraktionsanlage an ein nahe gelegenes konventionelles Kraftwerk geliefert werden; auf diese Weise ginge die Herstellung eines wertvollen Kunststoffs mit einer Nettoreduktion der Treibhausgas-Emissionen einher.
Man beachte jedoch, dass der primäre Nutzen für die Umwelt nicht etwa durch die Verwendung von Pflanzen als Rohmaterialien entsteht, sondern durch den Übergang zu einer Energiequelle auf pflanzlicher Basis. Bei gesonderter Betrachtung von Kunststoffherstellung und Energieerzeugung erkannten wir, dass unter rationalen Gesichtspunkten erneuerbare Energie derjenigen aus fossilen Quelle für alle industriellen Verfahren vorzuziehen wäre ? unabhängig davon, welcher Kunststoff auf welche Weise produziert wird. Mit anderen Worten: Warum sollte man für die sehr energieintensive Herstellung von Biokunststoffen Energie bereitstellen, wenn es doch die Möglichkeit gibt, herkömmliche Kunststoffe mit viel weniger Energieaufwand und geringeren Emissionen an Treibhausgasen zu produzieren? Offenbar ließen sich sowohl die Emissionen als auch der Verbrauch an fossilen Ressourcen am stärksten reduzieren, wenn man Kunststoffe wie bisher aus Erdöl erzeugt, dabei aber erneuerbare Biomasse als Brennstoff einsetzt.
Leider gibt es nicht die eine optimale Strategie, die alle ökologischen, technischen und wirtschaftlichen Beschränkungen der verschiedenen Herstellungsverfahren von Polymeren überwindet. Für konventionelle Kunststoffe benötigt man fossile Brennstoffe als Rohmaterial, für PLA und PHA nicht. Konventionelle Kunststoffe haben ein breiteres Spektrum an Materialeigenschaften als PLA und PHA, sind aber nicht biologisch abbaubar. PLA auf Pflanzenbasis und PHA aus Fermentationsprozessen sind technologisch einfacher herzustellen als in Mais gewachsenes PHA, konkurrieren aber mit landwirtschaftlichen Produkten ? insbesondere Nahrungsmitteln ? um begrenzte Anbauflächen. Und obwohl die PLA-Herstellung weniger fossile Rohstoffe verbraucht als die Produktion herkömmlicher Kunststoffe, benötigt sie doch mehr Energie und setzt mehr Treibhausgase frei.
Welche Wahl wir als Gesellschaft schließlich treffen, hängt also stark davon ab, welche Priorität wir dem Verbrauch fossiler Energieträger, der Emission von Treibhausgasen, der Landnutzung, der Müllentsorgung und nicht zuletzt der Rentabilität beimessen ? wobei all diese Faktoren interpretierbar sind und ihre Bewertung von der jeweils herrschenden Politik und dem Wertesystem beeinflusst wird. Doch wie auch immer Kunststoffe hergestellt werden ? der Energieverbrauch und die dadurch verursachten Emissionen haben die größten Auswirkungen auf die Umwelt.
Aus dieser Tatsache ergibt sich für uns eine entscheidende Folgerung: Jede Form der Kunststoffherstellung sollte die Emission von Treibhausgasen nicht nur verringern, sondern noch einen Schritt weiter gehen und den Kohlenstoff-Strom in die Atmosphäre umkehren. Dieses Ziel erfordert, nicht abbaubare Kunststoffe mit Energie aus Biomasse aus Ressourcen herzustellen, die Kohlendioxid aus der Luft gebunden haben, also beispielsweise aus Pflanzen. Nach Gebrauch könnte der Kunststoff deponiert werden, um den enthaltenen Kohlenstoff aus dem Verkehr zu ziehen und nicht in die Atmosphäre zurückkehren zu lassen. Das wäre auch mit einigen biologisch abbaubaren Kunststoffen möglich, weil auf Deponien, die viele Kunststoffabfälle aufnehmen, keine günstigen Bedingungen für eine rasche mikrobielle Zersetzung herrschen. (Auch die Verbrennung von Kunststoff wäre emissionsneutral, wenn die dabei freigesetzte Energie genutzt würde, um eine entsprechende Menge an Primärenergie einzusparen. Anmerkung der Redaktion)
Letztendlich kann sich die Forderung nach Reduktion des Kohlendioxidgehalts der Atmosphäre aber nicht allein an die Kunststoffindustrie richten. Jeder Produktionsprozess ließe sich umweltfreundlicher gestalten, wenn er mit erneuerbaren Rohmaterialien und erneuerbarer Energie arbeiten würde. Dazu müssten weltweit gewaltige Veränderungen der Infrastruktur zur Stromerzeugung vorgenommen werden, aber es wäre die Mühe wohl wert. Schließlich ist erneuerbare Energie für das Ziel einer nachhaltigen Wirtschaft unerlässlich; daher bleibt sie auch die entscheidende Hürde vor der Herstellung wahrhaft "grüner" Kunststoffe.
Literaturhinweise
Neuere Entwicklungen bei biologisch abbaubaren Kunststoffen. Von Gerald Rafler in: Spektrum der Wissenschaft Digest, Moderne Chemie II, S. 87 (2000).
Can Biotechnology Move Us toward a Sustainable Society? Von T. U. Gerngross in: Nature Biotechnology, Bd. 17, S. 541; Juni 1999.
Patrick Gruber, Vizepräsident der Technologieabteilung von Cargill Dow, beantwortet Fragen über den neuen Kunststoff seines Unternehmens auf pflanzlicher Basis.
Wie will sich NatureWorks™ PLA gegen petrochemische Kunststoffe behaupten?
Die meisten petrochemischen Kunststoffe oder Polymere haben nur eine, höchstens zwei Haupteigenschaften. Dadurch sind ihre Einsatzmöglichkeiten jeweils begrenzt. NatureWorks™ PLA vereint dagegen verschiedene Gebrauchseigenschaften in einer einzigen Kunststoff-Familie ? wie die Wärmedämmung von Polystyrol, die Fähigkeit von Polypropylen, gefaltet zu bleiben, und von Cellophan, Verdrehungen beizubehalten. Dies und ihr schimmernder Glanz machen PLA zum Beispiel für Firmen attraktiv, die daraus Bonbonpapier und andere Verpackungen für Konsumgüter entwickeln. Auch in der Textilbranche kann PLA als natürliche Faser, was Gebrauchseigenschaften und Leichtigkeit der Verarbeitung angeht, mit Synthetika wie Nylon mithalten. Insgesamt haben Industriekreise ein Marktpotenzial von mehreren Millionen Tonnen ausgemacht ? etwa für normale und Sportbekleidung, Hygieneprodukte, Einrichtungsgegenstände und Verpackungen.
Welche Umweltvorteile bietet PLA?
Da wir für PLA pflanzlichen Zucker anstelle von fossilen Brennstoffen als Ausgangsmaterial verwenden, benötigt seine Herstellung 20 bis 50 Prozent weniger fossile Ressourcen als die von konventionellem Kunststoff. PLA kann recycelt oder zur Wiederverwertung in seine ursprünglichen chemischen Bestandteile zerlegt werden. Zugleich ist es ungefähr so gut biologisch abbaubar wie Papier und daher kompostierbar. Damit wird PLA die Abhängigkeit unserer Gesellschaft von fossilen Brennstoffen verringern und zugleich Produkte liefern, die sich mit heutigen Verfahren leicht entsorgen lassen. Diese Umweltvorteile sind ein Pluspunkt ? doch glauben wir, dass die Verbraucher PLA vor allem kaufen werden, weil es gute Gebrauchseigenschaften hat und herkömmlich hergestellten Kunststoffen nicht nachsteht.
Machen diese Vorzüge auch die Tatsache wett, dass der Energieverbrauch zur Herstellung von PLA größer ist als der für die meisten petrochemischen Kunststoffe?
Man muss bedenken, dass unsere Technologie zur PLA-Gewinnung erst zehn Jahre alt ist, während die Petrochemie auf fast hundert Jahre Entwicklung zurückblickt, in der sie ihre Produkte stetig verbessert hat. Immerhin verbraucht schon unsere erste Produktionsanlage, die gerade in Nebraska gebaut wird, 40 Prozent weniger an fossilen Ressourcen, als für die Herstellung von konventionellem Nylon benötigt werden. Unsere Wissenschaftler und Ingenieure werden die PLA-Produktion optimieren, und wir erwarten von unserer zweiten und dritten Produktionsanlage, die schon für das Jahr 2004 geplant sind, eine Senkung des Energieverbrauchs um 50 Prozent.
Werden Sie die ökologischen Schwachstellen von PLA, die Gerngross und Slater ansprechen, zu beheben suchen?
Selbstverständlich. Wir entwickeln nicht nur Produktionsverfahren, die weniger Energie benötigen, sondern erforschen auch effizientere Arten der Energieerzeugung ? etwa die Kraft-Wärmekopplung und den Einsatz erneuerbarer Brennstoffe wie Biomasse. Außerdem suchen wir nach alternativen Ausgangsmaterialien für PLA. Bei Nutzung von fermentierbaren Zuckern aus Maisstroh könnte man nach der Getreideernte auf dem gleichen Feld noch einmal ernten. PLA lässt sich, je nach Klima, auch aus Weizen, Rüben und anderen Feldfrüchten gewinnen.
Aus: Spektrum der Wissenschaft 12 / 2000, Seite 58
© Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH
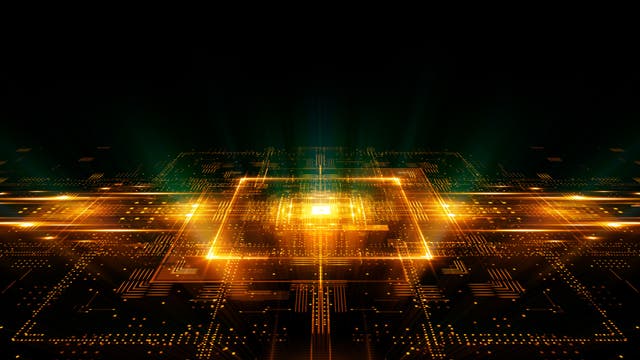


Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben