Wirksame Gestaltung von Umweltschutzabkommen
Schon mehr als 170 internationale Verträge sollen Luft, Boden, Wasser und die Organismen vor Gefährdungen durch den Menschen bewahren. Gleichwohl sind innovative Ansätze für globale Vereinbarungen erforderlich, damit die Erde auf Dauer ein sicherer Hort des Lebens ist.
Das Völkerrecht, so scheint es, schützt die Umwelt recht umfassend: Nahezu alle Lebensformen und -räume sind in den insgesamt etwa 170 einschlägigen Verträgen und Abkommen, von denen die meisten in den letzten 20 Jahren geschlossen wurden, berücksichtigt. Demnach wären sie vor den meisten erdenklichen Bedrohungen wie giftigen Abfällen und Emissionen, vor Entwaldung, Überfischung und Überjagung bewahrt.
Doch diese heile Welt gibt es weitgehend nur auf dem Papier. Die den Gepflogenheiten der internationalen Diplomatie eigenen Schwächen machen viele solcher Vereinbarungen praktisch wertlos. Weil eine grundlegende Revision des Systems zwischenstaatlicher Beziehungen – insbesondere der Funktionsweise der Vereinten Nationen – nicht sehr wahrscheinlich ist, sucht man nun oftmals am Verhandlungstisch nach neuen Ideen, um den Abkommen größere Wirkung zu verleihen.
Wohl am hinderlichsten ist die Tradition, daß internationale Beschlüsse einstimmig gefaßt werden müssen. Dies hat zur Folge, daß der zur Unterzeichnung aufliegende Vertragstext den Bedenken und Einwänden einzelner Staaten sehr weit entgegenkommt und mithin nur den kleinsten gemeinsamen Nenner widerspiegelt. Zum Beispiel einigten sich auf der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung (United Nations Conference on Environment and Development, UNCED) in Rio de Janeiro im Juni 1992 mehr als 100 Regierungen auf eine Klimakonvention (Spektrum der Wissenschaft, November 1992, Seite 156). Aber die USA bestanden darauf, daß der Wortlaut geändert würde; nun sind die einzelnen Staaten nur noch aufgefordert – und nicht verpflichtet –, ihre Emissionen an Kohlendioxid bis zum Jahre 2000 auf dem Stand von 1990 zu stabilisieren.
Damit nicht einige wenige störrische Staaten die guten Absichten anderer unterlaufen können, sehen manche Verträge neuartige Abstimmungsverfahren vor. Ist Konsens nicht zu erreichen, erlauben sie einer dazu autorisierten Mehrheit, schärfere Maßnahmen hinzuzufügen. Oftmals brauchen diese Zusätze nicht ratifiziert zu werden. Dennoch sind alle Vertragspartner rechtlich daran gebunden, sofern sie nicht ausdrücklich widersprechen; in einigen wenigen Fällen haben die Regierungen mit abweichender Meinung nicht einmal die Möglichkeit, vom Vertrag zurückzutreten.
Das 1987 entworfene und seit 1989 wirksame Montrealer Protokoll, das die Zerstörung der stratosphärischen Ozonschicht durch Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKWs) eindämmen soll, enthält derartige Vorkehrungen: Es erlaubt einer Zweidrittelmehrheit der 140 Vertragsparteien – in der die meisten Industrie- wie auch die meisten Entwicklungsländer vertreten wären –, schärfere Kontrollen in das Abkommen aufzunehmen. Auf der zweiten Vertragsstaatenkonferenz zum Montrealer Protokoll im Juni 1990 wurden die Regelungen insofern verschärft, als alle Vertragsparteien bis zum Jahre 2000 die Produktion von FCKWs einzustellen haben. Dieses vollständige Verbot, mit dem man auf neue wisssenschaftliche Erkenntnisse über die Geschwindigkeit des Ozonabbaus reagierte, ersetzte die ursprüngliche Forderung des Protokolls, die Produktion von FCKWs nur auf die Hälfte des damaligen Verbrauchs zu reduzieren. Zwei Jahre später wurde der Termin für den Herstellungsstopp auf den 1. Januar 1996 vorgezogen (siehe Kasten Seite 66). Bei beiden Nachfolgekonferenzen konnte somit ein Konsens erreicht werden – und zweifellos hat das Wissen, gegebenenfalls überstimmt zu werden, die Entscheidungen der eher zögerlichen Staaten erheblich beeinflußt.
Erfordert es schon viel Verhandlungsgeschick und Kompromißbereitschaft, um auf diese Weise überhaupt wirkungsvolle Maßnahmen zu vereinbaren, so ist es noch viel schwerer, diese anschließend umzusetzen und ihre Einhaltung zu überwachen. Die wenigsten internationalen Abkommen sehen Strafen vor, und wenn, kommt der zuwiderhandelnde Staat meist ungeschoren davon.
Aber so einfache Verfahren wie das Offenlegen bestimmter Daten und Aktivitäten haben sich in letzter Zeit als äußerst effektiv erwiesen. Manche Verträge fordern die Unterzeichnerstaaten auf zu berichten, auf welche Weise und wie wirkungsvoll sie versucht haben, ihren Verpflichtungen nachzukommen. Anhand dieser Informationen können auch nichtstaatliche Institutionen (sogenannte nongovernmental organizations) Verstöße öffentlich anprangern. So deckte die private Umweltschutzorganisation Greenpeace im Januar 1990 auf, daß Großbritannien mit dem Verklappen von Schlacke in die Nordsee den Geist (wenn nicht sogar den Wortlaut) der Oslo-Konvention über Müllentsorgung in die Meere von 1972 verletzte.
Außer moralischer Überzeugungsarbeit und öffentlicher Bloßstellung können Handelsanreize oder -beschränkungen Vertragstreue gewährleisten. Den Unterzeichnern des Montrealer Protokolls ist es untersagt, FCKWs oder FCKW-haltige Produkte aus Nicht-Vertragsstaaten zu importieren. Diese Vorschriften haben mehr als 100 Länder maßgeblich veranlaßt, diesem Abkommen beizutreten.
Entschärfung von Wertkonflikten
Allerdings können wirtschaftlichen Restriktionen die Regeln des freien Welthandels entgegenstehen. Im Oktober 1991 und erneut im Mai 1994 entschieden Ausschüsse, die auf das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT) zu achten haben, daß Bestimmungen des US-Gesetzes zum Schutz der Meeressäuger dieses Abkommen verletzen; das betraf vor allem ein Embargo, das die USA gegen den Import von Thunfisch aus Mexiko verhängt hatten, weil dort beim kommerziellen Fischfang viele Delphine getötet wurden. Diese Entscheidung schuf einen bedenklichen Präzedenzfall: Wenn GATT derartige Handelsrestriktionen verhindern kann, gibt es nur wenige Mittel, vertragsbrüchige Staaten zum Überdenken ihrer Haltung zu bewegen.
Eine Alternative zu den eben beschriebenen Optionen sind Erklärungen mit nicht-verbindlicher Wirkung. Mit solchen Deklarationen lassen sich Maßnahmen mitunter schneller umsetzen als mit völkerrechtlich bindenden Abkommen. Paradoxerweise sind Regierungen nämlich oftmals eher bereit, Verpflichtungen einzugehen, solange sie nicht gezwungen sind, sie einzuhalten. Internationale Behörden, aufgeschlossene Regierungen und nichtstaatliche Organisationen können solche gleichsam weichen Gesetze über Finanzierungsprogramme und öffentliche Kampagnen fördern. Deklarationen vermögen gewisse Erwartungen zu wecken oder gar weltweit eine übereinstimmende Denkart zu erwirken – was das Aushandeln längerfristig gültiger Abkommen sicherlich begünstigen würde.
Die Agenda 21, ein mehr als 500 Seiten umfassendes Dokument zur nachhaltigen Entwicklung, das aus der Rio-Konferenz hervorging, ist ein Beispiel dafür. Dieses Aktionsprogramm gibt politische Empfehlungen zu so dringlichen Themen wie der Bekämpfung der Armut und der Versorgung aller Menschen mit sauberem Wasser.
Die ehrgeizigen Richtlinien strikt zu befolgen, würde zwar die finanziellen und technischen Möglichkeiten vieler Länder übersteigen; man hofft jedoch, daß nationale Regierungen und internationale Organisationen ermuntert werden, sich daran zu orientieren und wann immer möglich ihre politischen Richtlinien umfassend zu erneuern. Mehr als 100 Staaten haben bereits Kommissionen für nachhaltige Entwicklung eingerichtet, welche die Vorgaben der Agenda 21 in praktisches Handeln umsetzen sollen. Auch die Vereinten Nationen haben eine solche Kommission gebildet, welche die Durchführung der Beschlüsse von Rio überwachen soll.
Die Agenda 21 regt in starkem Maße Bürgerinitiativen, Firmengruppen und andere nichtstaatliche Organisationen zur Mitarbeit an. Weil diese nicht der diplomatischen Etikette unterliegen, können sie die Nichterfüllung von Vereinbarungen oder Verhandlungsfehler oftmals klarer aufzeigen als Regierungsvertreter. Sie haben zudem häufig Zugang zu Schlüsselinformationen, die Regierungen übersehen oder nicht zur Verfügung haben. Aus diesen Gründen spielen solche Gruppen in internationalen Umweltschutzgesprächen eine zunehmend bedeutendere Rolle. Angesichts der Beiträge nichtstaatlicher Organisationen zur Rio-Konferenz hat die UN-Kommission für nachhaltige Entwicklung mehr als 500 solcher Gruppierungen zur Teilnahme an ihren Aktivitäten akkreditiert.
Probleme der Finanzierung
Entwicklungsländern ist es aber in vielen Fällen unmöglich, die von ihnen unterzeichneten Vereinbarungen einzuhalten – gleich, ob es sich dabei um reine Absichtserklärungen oder völkerrechtlich verbindliche Verträge handelt. Ob dieses Ungleichgewicht beseitigt werden kann, hängt weitgehend von der finanziellen und technischen Hilfe – und ihrer sinnvollen Anwendung – der Industriestaaten ab.
Dazu muß die internationale Gemeinschaft geeignetere Mittel zum Bereitstellen und Verteilen solcher Hilfen entwickeln. Das UNCED-Sekretariat schätzte 1992 den Finanzbedarf aller Entwicklungsländer auf 125 Milliarden Dollar jährlich, um allein die Agenda 21 umzusetzen – mehr als das Doppelte dessen, was ihnen derzeit an Entwicklungshilfe zufließt. Die Regierungen der Industriestaaten kündigten in Rio de Janeiro zwar an, den Zielen der Agenda 21 höchste Priorität beim Aufstellen ihrer Etats für die Dritte Welt einzuräumen und den Anteil der Entwicklungshilfe auf 0,7 Prozent ihres Bruttosozialprodukts zu erhöhen, legten sich aber nicht verbindlich auf einen Zeitpunkt fest.
Um Bemühungen um den Erhalt der Lebensgrundlagen auf der Erde zu unterstützen, sprachen sich die Unterzeichnerstaaten der Erklärung von Rio de Janeiro für den Ausbau des Globalen Umweltfonds (Global Environment Facility, GEF) aus, einer Einrichtung, die 1990 von der Weltbank, dem UN-Umwelt- und dem UN-Entwicklungsprogramm als Pilotprojekt gegründet worden war. Fortan sollte der Fonds als vorläufiger Mechanismus dienen, Projekte in den Entwicklungsländern zur Einhaltung der Klimakonvention und der gleichfalls 1992 verabschiedeten Konvention zum Schutz der Artenvielfalt zu fördern; im März 1994 vereinbarten die Regierungen des weiteren, den GEF als ständige Einrichtung zu etablieren und für die nächsten drei Jahre mit zwei Milliarden Dollar auszustatten.
Trotzdem ist der GEF nicht unumstritten. Viele Entwicklungsländer und nichtstaatliche Organisationen mißtrauen seiner Nähe zur Weltbank, weil sie bei ihren oft gigantischen Entwicklungsprojekten die Interessen der Einheimischen mißachtet habe und das Mitspracherecht der Staaten an die Höhe ihrer finanziellen Zuwendungen an die Weltbank kopple. Um diese Einwände zu entkräften und den Umweltfond von der Weltbank unabhängiger zu machen, veränderte das im März 1994 geschlossene Abkommen die Kontrollbefugnisse: Die Empfängerländer haben jetzt ein gewichtigeres Stimmrecht. Dennoch bleibt abzuwarten, ob die Unterzeichnerstaaten der beiden in Rio de Janeiro ausgehandelten Konventionen mit diesen Reformen zufrieden sein und den GEF dauerhaft als Finanzinstrument nutzen werden.
Eine Welt-Behörde?
Alle hier angesprochenen Maßnahmen ließen sich wesentlich wirksamer einsetzen, wenn die nationalen Regierungen bereit wären, eine einzelne internationale Institution anzuerkennen und damit zu betrauen, einen Großteil der Umweltschutzabkommen auszuhandeln und umzusetzen. Diese Aufgabe könnte beispielsweise dem UN-Umweltprogramm, der UN-Kommission für nachhaltige Entwicklung oder einer neu zu gründenden Organisation zugewiesen werden. Ein zentral koordiniertes Vorgehen könnte eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Vertragspartnern mit ähnlichen Interessen fördern und nichtstaatliche Organisationen stärker in Verhandlungen einbeziehen – die gegenwärtige Verfahrensweise läßt derart vorteilhafte Aktivitäten nicht zu.
Heutzutage befaßt sich eine fast unüberschaubare Anzahl von UN-Unterorganisationen und mehr oder weniger unabhängigen Gremien in den einzelnen Staaten mit dem Erarbeiten und Umsetzen von Umweltschutzverträgen. Für jedes neu zu diskutierende Abkommen tendiert die Generalversammlung der Vereinten Nationen dazu, ein internationales Komitee zu schaffen – vergleichbar dem Internationalen Verhandlungskomitee zum Klimawandel. Dessen Vorschläge werden dann zur weiteren Bearbeitung an andere Einrichtungen gegeben. Eine sogenannte Konferenz der Vertragspartner, bestehend aus Vertretern der Teilnehmerstaaten, tritt regelmäßig zusammen und überwacht formal die Umsetzung der Übereinkommen. Häufig berichtet ein kleinerer Umsetzungsausschuß dieser Konferenz.
Diese Regierungsausschüsse werden durch Sekretariate unterstützt, deren Arbeit jedoch durch knappe Etats und Personalmangel erschwert ist. Das Sekretariat des Montrealer Protokolls zum Beispiel hat nur fünf Beschäftigte und ein Gesamtbudget von 2,5 Millionen Dollar – weniger als ein Prozent dessen, was zum Beispiel der amerikanischen Umweltschutzbehörde für Luftreinhaltungsmaßnahmen zur Verfügung steht.
In manchen Fällen mag diese Zersplitterung der Zuständigkeiten durchaus erfolgreich gewesen sein. Kleine Teams können bestimmte Arbeiten oftmals besser bewältigen als bürokratisch aufgeblähte Verwaltungsapparate; aber in der Mehrzahl der Fälle hatte diese administrative Struktur – beziehungsweise der Mangel daran – Ineffizienz und Verzögerungen zur Folge.
Für eine mögliche Revision können vielleicht Strategien aus anderen Bereichen der internationalen Beziehungen als Vorbild dienen. Die Internationale Arbeitsorganisation etwa wäre ein vernünftiges Modell: Sie bietet ein Forum dafür, internationale Standards zu Themen wie Arbeitsplatzsicherheit zu verhandeln, und überprüft, ob die Mitglieder diese auch einhalten; des weiteren haben infolge der ungewöhnlichen Dreiteilung der Organisationsstruktur Vertreter der Wirtschaft, der Gewerkschaften und der Regierungen gleiches Mitspracherecht.
Internationale Verträge und Institutionen zu schaffen, die so wirkungsvoll sind, daß die fortschreitende weltweite Plünderung und Zerstörung ökologischer Ressourcen aufgehalten und gar Verbesserungen erreicht werden können, ist schwierig. Die souveränen Staaten müßten dazu einen Teil ihrer Macht an internationale Institutionen abtreten und diese wiederum Vertreter von nichtstaatlichen Organisationen einbeziehen. Dies steht zwar im Widerspruch zu bisherigen nationalstaatlichen Verhaltensweisen, wäre aber letztlich im Interesse aller Länder, denn nicht weniger als die Bewohnbarkeit unseres Planeten steht auf dem Spiel. So wie die Welt durch die grenzüberschreitenden Wirkungen von Technik, Umweltverschmutzung, Handel und Verkehr verändert wurde, muß sich nun auch das Ausüben von Regierungsgewalt wandeln.
Literaturhinweise
- Lessons Learned in Global Environmental Governance. Von Peter H. Sand. World Resources Institute, 1990.
– After the Earth Summit: The Future of Environmental Governance. Von Hilary F. French. Worldwatch Institute, Bericht 107, 1992.
– The Effectiveness of International Environmental Agreements: A Survey of Existing International Instruments. Von Peter H. Sand. Grotius Publications, Cambridge University Press, 1992.
– New Ways to Make International Environmental Law. Von Geoffrey Palmer in: American Journal of International Law, Band 86, Heft 2, Seiten 259 bis 283, April 1992.
– Institutions for the Earth. Von Peter M. Haas, Robert O. Keohane und Marc A. Levy. MIT Press, 1993.
– Environmental Diplomacy. Von L. E. Susskind. Oxford University Press, 1994.
– Spektrum der Wissenschaft, Digest 1: Umwelt-Wirtschaft, 1994.
Aus: Spektrum der Wissenschaft 2 / 1995, Seite 62
© Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH



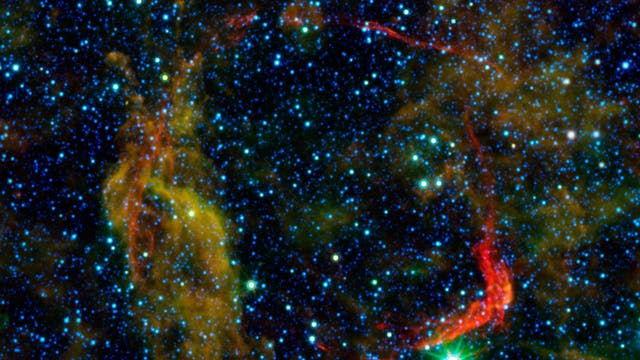

Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben