Astronomie: Die Suche nach fernen Monden
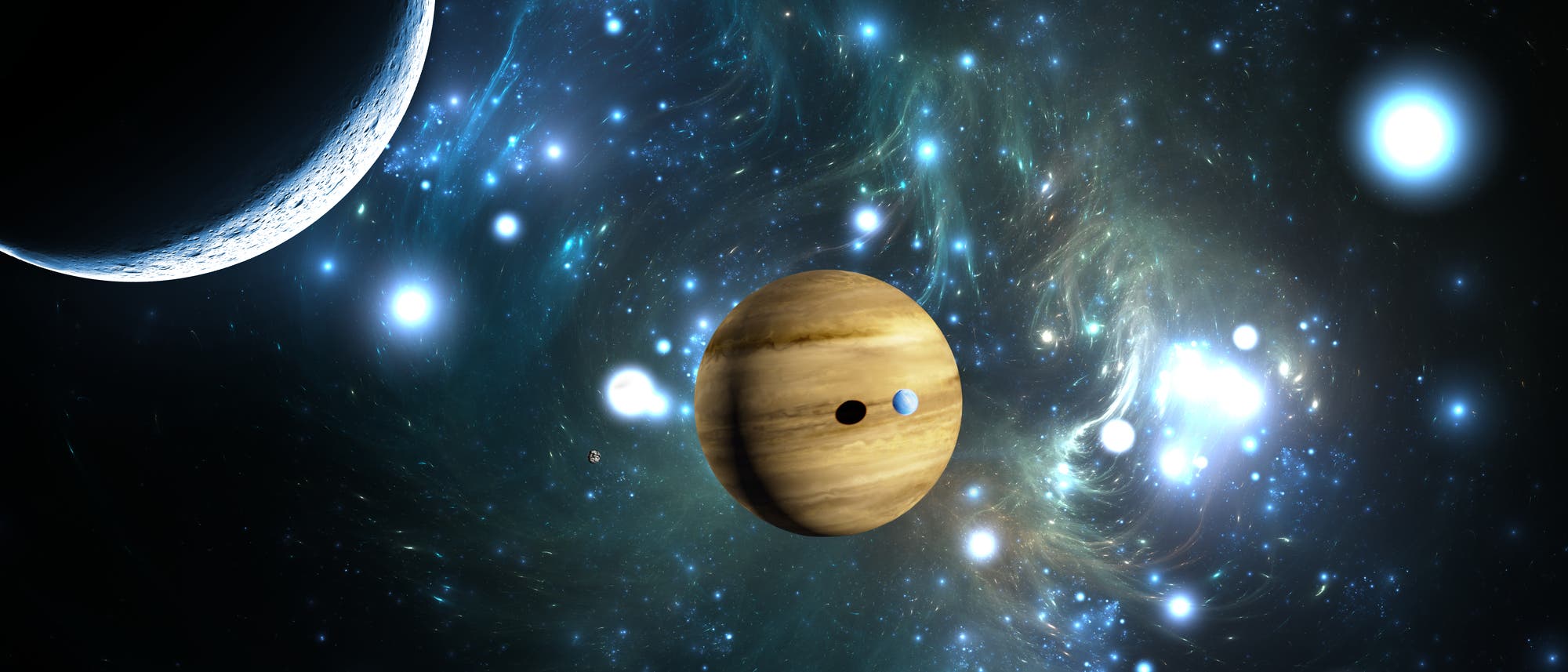
1655 richtete Christiaan Huygens ein selbst konstruiertes Teleskop auf den Saturn. Der holländische Astronom wollte seine Annahme überprüfen, der Planet sei von einem einzigen festen Ring umgeben, dessen Ausrichtung sich im Lauf der Jahre verändert. Dabei entdeckte Huygens den riesigen Mond Titan. Fortan war Saturn neben Erde und Jupiter der dritte Planet, von dem ein Trabant bekannt war. Heute wissen wir: Monde kommen in unserem Sonnensystem sogar noch weitaus häufiger vor als Planeten.
Aber gilt das gleichermaßen für den Rest des Weltalls? 2007 beobachtete ein Netzwerk von automatisierten Teleskopen einen etwa 433 Lichtjahre entfernten Stern im Sternbild Centaurus. Seine Helligkeit brach für 54 Tage merklich ein, anschließend nahm sie wieder zu. Die Ursache war ein riesiger, von 37 Ringen umgebener Gasplanet. Und wie Saturn hat auch diese J1407b genannte Welt eine Lücke in ihrem Ringsystem. Darin könnte sich ein Mond bewegen, der ungefähr die Masse der Erde hat.
Ob das wirklich so ist, ist unklar. Wenn nicht dort, müsste es jedenfalls im Orbit anderer Exoplaneten Monde geben. Seit den ersten Entdeckungen in den 1990er Jahren haben Astronominnen und Astronomen inzwischen mehr als 4000 Planeten um ferne Sterne aufgespürt, insbesondere dank des 2009 gestarteten Kepler-Weltraumteleskops, das bis 2018 in Betrieb war. Exoplaneten scheint es überall und in fast jeder erdenklichen Größe zu geben.
Monde als Planeten-Stabilisatoren
Die Spekulationen über mögliche Trabanten begannen bereits in den frühen 2000er Jahren. Mittlerweile gibt es mehrere Kandidaten, aber noch keinen Beleg. Fachleute versprechen sich von entdeckten Exomonden nicht weniger als eine Neujustierung unserer kosmischen Perspektive. Von Monden in anderen Sternsystemen könnten wir in Erfahrung bringen, wie groß solche Himmelskörper in der Regel sind und wie sie sich gebildet haben. Daraus ließen sich dann Rückschlüsse ziehen, ob das Sonnensystem eher gewöhnlich oder ein Exot ist – und welche Rolle der Mond während der irdischen Entwicklung gespielt hat.
Bis heute ist unser Heimatplanet beispielsweise der einzige bekannte mit Plattentektonik. Außerdem besitzt die Erde eine Atmosphäre, die dick genug ist, um Wasser flüssig zu halten, verbunden mit einem milden, über Äonen stabilen Klima. All diese Bedingungen waren bei der Evolution des Lebens wichtig und lassen sich zumindest teilweise auf den Einfluss unseres Trabanten zurückführen.
Er betrat schon in den Kindertagen des Sonnensystems die Bildfläche, vor 4,5 Milliarden Jahren. Damals kollidierte vermutlich ein Himmelskörper von der Größe des heutigen Mars mit dem Vorläufer der Erde. Der gewaltige Crash hinterließ an ihrer Stelle einen glühenden, länglichen Klumpen und schleuderte eine brodelnde Gesteinsschmelze ins All, aus der sich bald darauf der Mond formen sollte.
In den folgenden Milliarden Jahren kühlte unser Trabant ab und entfernte sich dabei allmählich von der Erde. Diese wiederum wurde immer runder, je weiter sich der Mond zurückzog. Ihre Kruste spannte sich unter den resultierenden Gezeitenkräften – möglicherweise der Beginn der Plattentektonik. Das Abwandern des Mondes verlangsamte zudem die Erddrehung, wodurch sich unser Tag um fast zwei Millisekunden pro Jahrhundert verlängert.
Große Monde mit Wasser könnten selbst lebensfreundlich sein
Der Einfluss des Mondes hängt mit seiner Schwere zusammen: Er besitzt 1,2 Prozent der Masse der Erde. Trabanten anderer Planeten sind relativ zu ihrem Mutterkörper deutlich leichter. Titan zum Beispiel hat, obwohl er fast 50 Prozent größer ist als der Erdmond, nur 0,02 Prozent von Saturns Masse. Die Anziehungskraft des Mondes hält die Erdachse in einer konstanten Neigung von 23,5 Grad zur Sonne. Die Konfiguration bewahrt unser Klima vor allzu raschen Veränderungen. Ganz anders etwa sieht es auf dem Mars aus, der nur zwei kleine Monde hat. Seine Achse schwankt alle paar Millionen Jahre zwischen null und 60 Grad, was zu dramatischen klimatischen Störungen führt.
Falls die irdische Vergangenheit ein Anhaltspunkt ist, sollten auch bei Exoplaneten Monde für stabilere Umweltbedingungen sorgen. Und selbst, wenn es auf den Planeten kein Leben gibt, sind womöglich die Exomonde ihrerseits geeignete Habitate. Unter dem gefrorenen Panzer von Eismonden wie Europa oder Enceladus vermuten Fachleute seit Langem günstige Voraussetzungen für einfache Lebewesen. Sogar bei Titan sind entsprechende Szenarien denkbar. Der Saturnmond ist mit Meeren aus Methan und Ethan bedeckt. Das ist auf den ersten Blick nicht mit Leben kompatibel, wie wir es von der Erde kennen. Aber der Mond hat eine dichte Atmosphäre, die Substanzen im flüssigen Aggregatzustand hält, und so besteht zumindest eine Chance für eine exotische Form von Biologie. Saturn dagegen wäre wegen seiner starken Schwerkraft und giftigen Wolken aus Ammoniak wohl kaum ein sicherer Hafen für Leben. Dasselbe gilt für Jupiters tödliche Strahlungsgürtel und Gasschichten, wohingegen seine Monde ruhiger sind.
»Aus unserem Sonnensystem wissen wir, dass Planeten vom Format des Jupiters große Monde besitzen, die potenziell Wasser auf der Oberfläche halten können«, bekräftigt Chris Fox von der Western University in Ontario. »Wenn solch ein Planet seinen Stern in der habitablen Zone umkreist, könnte es sogar Monde geben, die der Erde ähneln.« Falls Monde auch in anderen Sternsystemen weit häufiger sind als Planeten, sind sie womöglich der aussichtsreichste Ort für die Suche nach außerirdischen Organismen.
Lange bevor das Kepler-Teleskop seine ersten Aufnahmen gemacht hat, gingen Astronominnen und Astronomen davon aus, dass es überall im Kosmos Exomonde gibt. Schon 1999 schlugen Paola Sartoretti und Jean Schneider vom Pariser Observatorium vor, mit der so genannten Transitmethode nach Trabanten zu suchen. Himmelskörper verdunkeln ihren Stern ein wenig, wenn sie von der Erde aus gesehen daran vorüberziehen. Die Voraussetzung für solch einen Transit ist die Anordnung des Planetensystems in einer flachen Ebene, bei der wir von der Seite auf die Kante der Scheibe schauen.
Wie man Exomonde findet
Das Kepler-Teleskop hat die Methode ein Jahrzehnt lang genutzt, um Exoplaneten aufzuspüren. Sartoretti und Schneider vermuteten, man könne damit außerdem Monde nachweisen. Zumindest, wenn sie in großer Entfernung um ihren Planeten kreisen und sich zum Zeitpunkt des Transits gerade neben dem Planeten befinden. Der Stern würde dadurch während des Transits etwas dunkler erscheinen als erwartet.
Selbst wenn Exomonde enge Bahnen um ihren Planeten ziehen, könnte man die Trabanten wohl noch registrieren, erkannten Sartoretti und Schneider. Dazu müsste man genau protokollieren, ob sich das periodische Transitmuster des Planeten im Lauf der Zeit verändert. Denn meist wiederholen sich die Verdunkelungen mit metronomähnlicher Präzision. Manchmal schwankt die Zeit zwischen zwei Transits etwas: Dann beginnen oder enden die Minifinsternisse ein wenig früher oder später als gedacht. Zu der so genannten Transitzeit-Variation kommt es normalerweise, wenn es mehrere Planeten im Orbit des Sterns gibt und diese mittels ihrer Schwerkraft aneinander zerren. Monde müssten einen prinzipiell ähnlichen Effekt hervorrufen.
Dazu muss man wissen, dass auch unser Mond nicht auf einer völlig kreisförmigen Bahn um die Erde wandert. Vielmehr umrunden beide Körper ihren gemeinsamen Schwerpunkt, das Baryzentrum. Es befindet sich in unserem Fall innerhalb der Erdkugel, aber nicht genau in deren Zentrum. Bei Exoplaneten und ihren Monden könnte das Schlingern ausgeprägt genug sein, um bei einer gezielten Suche aufzufallen.
2017 haben Alex Teachey vom Academia Sinica Institute of Astronomy and Astrophysics in Taiwan und David Kipping von der New Yorker Columbia University die Daten des Kepler-Teleskops nach Hinweisen auf Exomonde durchforstet. Sie analysierten dazu etwa 300 Planeten in der Hoffnung auf verdächtige Transitsignale. Am Ende stießen sie nur auf einen Kandidaten: Kepler-1625b.
Anschließend bewarben sich die beiden erfolgreich um Beobachtungszeit am Hubble-Weltraumteleskop. Ein Jahr lang analysierten sie die Messungen. Und tatsächlich begann der Transit von Kepler-1625b früher, als er sollte, was auf einen Mond hindeutete. In einem fünf Jahre umfassenden Datensatz verschob sich die Transitzeit außerdem um etwa 20 Minuten. »Damit ist klar, dass etwas den Planeten herumschiebt«, sagt Kipping. »Wir denken, es handelt sich um einen Mond.«
Entdeckung oder Wunschdenken?
Teachey und Kipping veröffentlichten ihre Arbeit im Oktober 2018. Demnach könnte der Exoplanet Kepler-1625b – der selbst deutlich größer als Jupiter ist – einen Mond vom Format des Neptuns haben. Eine Entdeckung beanspruchten die beiden Forscher jedoch nicht. »Ich glaube, einige Kollegen waren frustriert von der Art und Weise, wie wir unser Ergebnis präsentiert haben«, sagt Teachey. »Wir haben offenbar den Eindruck erweckt, einerseits auf die Anerkennung für eine Entdeckung aus zu sein, andererseits aber davor zurückschrecken, diese ernsthaft für uns zu beanspruchen. Ich verstehe, dass das frustrierend ist, schließlich fragen wir uns alle, ob da nun ein Mond ist. Es gibt einfach noch zu viele Unsicherheiten.« René Heller vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen hat kurz nach der Veröffentlichung einen Teil von Teacheys Ergebnissen reproduziert, fand aber insgesamt keine ausreichenden Beweise für einen Mond. Laura Kreidberg, die am Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg die Atmosphäre von Exoplaneten untersucht, konnte einen wichtigen Teil der Resultate nicht bestätigen.
Unterdessen wuchs das Interesse an dem Thema. Schon bald durchsuchten weitere Teams die Kepler-Daten und spürten von Monden ausgelösten Variationen der Transits nach. Andere wandten sich optischen Beobachtungssystemen wie dem Spectro-Polarimetric-High-contrast-Exoplanet-REsearch-Instrument (SPHERE) des Very Large Telescope zu. Cecilia Lazzoni von der Universität von Padua in Italien glaubt zum Beispiel, mit Hilfe von SPHERE-Daten einen riesigen Exomond gefunden zu haben. In einer in der Fachzeitschrift »Astronomy & Astrophysics« veröffentlichten Arbeit beschrieben sie und ihre Kollegen ihn als Begleiter eines sehr massearmen Braunen Zwergs. So nennen Astronomen ein schwach leuchtendes Objekt, das anders als ein Stern keinen Wasserstoff fusioniert, aber ein Vielfaches der Größe des Jupiters hat. Lazzonis Welt und ihr Begleitkörper entsprächen demnach eher zwei umeinander kreisenden Riesenplaneten als einer Welt mit Trabant. Sollten solche Paare häufiger vorkommen, wäre zu klären, wie man eigentlich definiert, was Planeten von Monden unterscheidet.
2019 analysierte Phil Sutton von der University of Lincoln in England den eingangs erwähnten Super-Saturn J1407b neu. Er wollte Beweise für Monde finden, die außerhalb des Rings liegen, wie es bei den meisten Saturnmonden der Fall ist. Also schaute er, ob die 37 Ringe von J1407b ähnlich wie bei dem Gasplaneten unseres Sonnensystems geformt sind. Sutton sah keine Hinweise auf Monde, mehr noch: Solche würden laut seiner Analyse die fragilen Ringe des Exoplaneten zerstören.
Im Sommer 2020 sah Chris Fox aus Ontario weitere Kepler-Daten durch. Zusammen mit seinem Kollegen Paul Weigert fand er in einer Auswahl von 13 mit dem Weltraumteleskop aufgespürten Planeten insgesamt 8 mit Transitzeit-Variationen, die mit Exomonden erklärt werden könnten. Andere Ursachen sind allerdings ebenso denkbar, von veränderlicher Sternaktivität bis hin zu weiteren Planeten. »In vielen Fällen waren wir in der Lage, das Muster einem etwaigen Mond zuzuordnen, aber in allen Fällen ließ es sich genauso durch einen zweiten Planeten erklären«, resümiert Fox.
Widersprüchliche Analysen derselben Daten
Schließlich organisierte Kipping im November 2020 eine erste internationale Konferenz zu Exomonden, die virtuell abgehalten wurde und rund 80 Fachleute zusammenbrachte. Eine der Erkenntnisse: Die Entdeckung eines Exomondes lässt wohl auch deshalb noch auf sich warten, weil sich die Sache bislang an der Grenze des technisch Machbaren bewegt. Der winzige Helligkeitsunterschied bei einem Transit ist schon dann in vielen Fällen kaum nachweisbar, wenn er von einem Planeten herrührt. Die Messung des Transitzeitpunkts erfordert gleichfalls eine Präzision, die bisherige Instrumente nur gerade so eben liefern.
Das frustriert. Laura Kreidberg beispielsweise wurmt es, dass sie und Teachey bei der Analyse des Exomond-Kandidaten um Kepler-1625b nicht zur gleichen Antwort gelangt sind. Die beiden haben zwar ihre Analysen verglichen, konnten die Schlussfolgerungen aber einfach nicht in Einklang bringen. »Ich habe daraus eine Lehre gezogen: Wir stoßen wirklich an die Grenzen dessen, was das Hubble-Teleskop leisten kann«, sagt Kreidberg. »Es wurde entwickelt, um weit entfernte Galaxien zu beobachten, nicht vergleichsweise nahe Exoplaneten und ihre Monde.
Andere Schwierigkeiten sind geometrischer Natur. Wegen der von Kepler und Newton formulierten grundlegenden Bewegungsgesetze sind die Bahnen von Monden immer dann stabil, wenn diese sich innerhalb eines bestimmten Abstands vom Planeten befinden, der so genannten Hill-Sphäre. Sonst läuft der Trabant Gefahr, von der Schwerkraft des Sterns aus seinem Orbit gekegelt zu werden. Das wird insbesondere bei einem geringen Abstand von Planeten und Zentralgestirn zum Problem. Bisher kreisen die meisten bekannten Exoplaneten jedoch sehr eng um ihren Stern, oft näher als Merkur um die Sonne. Somit ist die Chance recht groß, dass sie ohne Begleiter unterwegs sind. »Die Planeten, die wir vor ihren Sternen vorüberziehen sehen, können wegen der ungünstigen Gravitationsverhältnisse meist wohl keine Monde an sich binden«, sagt Stephen Kane von der University of California in Riverside. Er veröffentlichte 2017 eine Arbeit, der zufolge auf engem Raum befindliche Planetensysteme wie das von TRAPPIST-1 mit seinen sieben erdähnlichen Planeten wahrscheinlich gar keine Trabanten beherbergen.
Planeten, die sich in größerer Distanz zu ihren Sternen befinden, wie Jupiter und Saturn, haben dagegen eher Monde, argumentiert Alice Quillen, eine Astronomin an der University of Rochester, die den Super-Saturn J1407b untersucht hat. Dafür spricht nicht nur der geringere Einfluss der Schwerkraft des Sterns weiter draußen. Planeten können an den Rändern eines Systems zudem eher verirrte Asteroiden und andere Himmelskörper einfangen, so wie es Neptun mutmaßlich mit seinem Mond Triton getan hat. Letzterer dürfte einst ein Zwergplanet wie Pluto gewesen sein, geriet dann aber irgendwann in den Einzugsbereich von Neptun.
Weit von ihrem Stern entfernte Exoplaneten sind allerdings schwierig aufzuspüren, auch weil sie sehr lang für einen Umlauf brauchen. Zum Vergleich: Jupiter benötigt dafür zwölf irdische Jahre. Es ist nötig, zwei oder mehr Transits beizuwohnen, um einen Planet sicher zu identifizieren. Obendrein lassen sich solche Signale nicht immer von denen aus Doppelsternsystemen unterscheiden, wo sich beide Partner in entsprechenden Abständen umkreisen und gegenseitig verdunkeln.
Sternaktivität übertönt schwache Signale
Zusätzlich erschweren die Sterne selbst die Arbeit. Unsere Sonne ist eine vergleichsweise ruhige Feuerkugel; andere hingegen neigen stärker zu Strahlungsausbrüchen, schleudern immer wieder Unmengen Materie ins All und bilden auf ihrer Oberfläche viele Flecken. »Je genauer man die Helligkeit eines Sterns vermessen kann, desto mehr sieht man von der stellaren Aktivität«, sagt Kane. Das Ganze gleicht dann einem Rauschen in den Daten, das mitunter größer ist als das Signal von etwaigen Monden. »Das schafft eine Empfindlichkeitsgrenze, von der nicht klar ist, ob sie sich überwinden lässt.«
Umso kreativer werden die Ideen für mögliche mathematische und instrumentelle Auswege. Apurva Oza von der Universität Bern beispielsweise hält Ausschau nach vulkanisch aktiven Monden, die sich leichter verraten könnten. Als Vorbild dient hier der Jupitertrabant Io; er ist einer der vier Monde, die bereits Galileo Galilei entdeckt hat. Hobbyastronomen brauchen dafür nur ein gutes Fernglas. Für Profis mit der richtigen Ausrüstung ist Io eines der auffälligsten Objekte am Himmel. Die Schlote an seiner Oberfläche speien Natrium und Kalium ins All. Diese und andere Stoffe können sich bis in eine Distanz ausbreiten, die dem 500-Fachen des Jupiterradius entspricht.
Solch eine Signatur wäre auch aus einiger Entfernung aufspürbar, sogar unabhängig von einem zufällig passenden Transit. Denn dank an Teleskopen befestigten Spektrografen lassen sich Gase im Umfeld von Sternen nachweisen. So haben Messungen immer wieder Natrium, Kalium und andere verdächtige Elemente enthüllt, ohne dass es eine einfache Erklärung dafür gäbe. »Möglicherweise ist schlicht ein Mond dafür verantwortlich«, spekuliert Oza.
Bis leistungsfähigere Observatorien verfügbar sind, bleibt nur geschicktere Analyse
Für die Zukunft des Felds hoffen Astronominnen und Astronomen zunächst auf das James-Webb-Weltraumteleskop (JWST), das nach mehreren Verzögerungen Ende 2021 gestartet ist. Momentan sind keine passenden Instrumente in Betrieb. Somit bleibt vorerst nur ein Herumdoktern an der Datenverarbeitung. »Ein Teil unserer Arbeit besteht darin, bessere Methoden zu finden«, sagt Teachey. Entsprechend gleiche eine Entdeckung weniger einem klar definierbaren Heureka-Moment, wie ihn Laien oft vor Augen haben. Vielmehr gehe es darum, geduldig einen Test nach dem anderen durchzuführen. Am Ende komme dann vielleicht etwas Interessantes heraus, was jedoch weiter überprüft werden müsse.
Mittelfristig könnten auch Observatorien am Erdboden neue Daten für die Suche nach Exomonden liefern, etwa das Extremely Large Telescope, das derzeit in der chilenischen Atacama-Wüste gebaut wird. Das europäische Weltraumteleskop PLAnetary Transits and Oscillations of Stars (PLATO) könnte ebenfalls bei der Suche helfen und soll 2026 starten. Für die 2030er Jahre sind dann viel versprechende Projekte wie der James-Webb-Nachfolger LUVOIR (Large UV/Optical/IR Surveyor) geplant.
»Im Augenblick bleibt uns bloß Hubble, bis endlich James Webb läuft«, sagt Kipping. Das gibt immerhin Zeit, um die Suchstrategien zu verfeinern. Laura Kreidberg ist zuversichtlich, mit JWST Signale von Exomonden zu empfangen, räumt aber ein, dass eine eindeutige Entdeckung noch eine Weile auf sich warten lassen könnte. »Man muss schon optimistisch veranlagt sein, um Exoplaneten zu erforschen.« Das gilt umso mehr für deren Monde.
(Anm. der Red.: Der Artikel wurde am 09.02.2022 bezüglich des Starts des JWST aktualisiert.)
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.