Astrophysik: Die Kinderstuben der Sterne

Die Figuren, die manche am nächtlichen Firmament zu erkennen glauben, stellen nur Projektionen des menschlichen Gehirns dar, das einzelne Sterne miteinander in Beziehung zu setzen versucht. Tatsächlich ist die große Mehrzahl aller Sterne auf sich gestellt und weit von ihren Nachbarn entfernt. Doch das war nicht immer so: Jeder Stern beginnt sein Leben in einer Gruppe von Geschwistern nahezu gleichen Alters. Erst nach und nach driftet die Schar auseinander. Einige dieser stellaren Kinderstuben existieren noch heute; Astronomen bezeichnen sie als Cluster oder Sternhaufen. Der wohl bekannteste von ihnen ist der Orion-Trapezium-Haufen im Orion-Nebel: Bilder des Weltraumteleskops Hubble zeigen, wie seine Sterne inmitten von aufgewühlten Wolken aus Staub und Gas aufleuchten. Einen weiteren Sternhaufen, die Plejaden, aus dem einzelne Hauptsterne hell hervortreten, sieht man als verschwommenen Lichtfleck im Sternbild Stier sogar mit dem bloßen Auge.
Sternhaufen kommen in höchst unterschiedlichen Varianten vor, die von schwächlichen Gebilden mit wenigen Dutzend Mitgliedern bis zu dichten Ansammlungen von Millionen Sternen reichen. Einige Exemplare sind nur ein paar Millionen Jahre alt, andere Haufen stammen aus der Frühzeit des Universums. Nicht zuletzt, weil sie Sterne in allen möglichen Stadien ihres Lebenszyklus beherbergen, haben sie die wichtigsten Belege für die heutige Theorie der Sternentstehung geliefert, eine der größten astrophysikalischen Errungenschaften des 20. Jahrhunderts (siehe SdW 8/2013, S. 46).
Weniger gut erforscht ist, wie sich Sternhaufen als solche entwickeln und was genau sich in ihnen abspielt. Und warum gibt es sie ausgerechnet in den heute beobachteten Spielarten? Vor etwa 20 Jahren, als ich gemeinsam mit Francesco Palla vom Arcetri-Observatorium in Florenz ein Lehrbuch über Sternentstehung verfasste, wurde mir erstmals bewusst, dass wir offenbar weit mehr über die Sterne selbst wissen als über die Kinderstuben, die sie hervorbringen. An einem Nachmittag, wir saßen gerade im Café Strada in Berkeley, kam mir eine Idee. Vielleicht erschaffen ja dieselben physikalischen Kräfte die verschiedenen Haufenvarianten. Und vielleicht ist nur eine einzige Variable dafür maßgeblich, welche Art Haufen im Lauf der Zeit entsteht – nämlich die Masse der "Elternwolke", in der ein Cluster geboren wird.
In den folgenden beiden Jahrzehnten habe ich einen erheblichen Teil meiner Zeit dafür aufgewandt, Belege für diese Vermutung zu finden. Schon damals wussten Astronomen viel über die Entstehung von Sternen und auch einiges über die Cluster, in denen das geschieht. Ausgangspunkt sind große Molekülwolken, wie sie in jeder Galaxie vorkommen. Sie bestehen vor allem aus Wasserstoffmolekülen, außerdem finden sich in ihnen weitere Elemente sowie geringe Mengen an Staub. Den Schwerkraftsog einer Wolke spüren nicht nur Sterne und andere Objekte in ihrer näheren Umgebung, er wirkt auch auf die Materie in ihrem Inneren. Dort, wo ihre Gas- und Staubdichte besonders groß ist, ballt sich die Materie daher zu so genannten Protosternen zusammen, den Vorläufern der Sterne.
Astronomen unterscheiden fünf Haufentypen nach ihrem Alter sowie nach Zahl und Dichte der darin enthaltenen Sterne. Die jüngsten stellaren Gruppierungen werden als eingebettete Cluster bezeichnet. Man findet sie in Wolken, die so dicht sind, dass sie die von ihren Mitgliedern im optischen Spektralbereich erzeugte Strahlung komplett verschlucken; nur das infrarote Glimmen des durch die Strahlung aufgeheizten Staubs dringt nach außen. Die innere Struktur solcher primitiven Cluster bleibt den Forschern deshalb ein Geheimnis.
Die ältesten und auch mitgliederreichsten Cluster sind als Kugelsternhaufen bekannt. Sie entstanden in der Frühzeit des Universums und können bis zu eine Million dicht gepackter Sterne enthalten. Die Elternwolken dieser Haufen sind längst verschwunden, die Mitgliedersterne also gut sichtbar. Unglücklicherweise lassen sich Kugelsternhaufen nur schwer beobachten: Sie liegen in sehr großer Entfernung oberhalb und unterhalb der galaktischen Scheibe.
Aus praktischen Gründen habe ich mich auf die drei Haufentypen konzentriert, die in der galaktischen Ebene liegen und sich am besten untersuchen lassen. Einer davon sind die spärlich bevölkerten T-Assoziationen, sie bestehen aus bis zu einigen hundert T-Tauri-Sternen, also sehr jungen und noch kontrahierenden Himmelskörpern. Auch unsere Sonne war in ihrer Frühzeit ein solcher T-Tauri-Stern. Die Himmelskörper werden zwar noch von ihrer Elternwolke umgeben, aber nicht vollständig verborgen. Lange bleiben solche Haufen nicht zusammen: Die ältesten T-Assoziationen sind gerade einmal rund fünf Millionen Jahre alt.
Bereits seit einiger Zeit wissen Forscher, dass die Masse der Elternwolke von T-Assoziationen wesentlicher größer ist als die Gesamtmasse der Sterne, die aus ihr hervorgehen. Ich vermute, dass hierin auch der Grund für ihre kurze Lebensspanne liegt. Ist die Masse der Elternwolke einer T-Assoziation viel größer als die ihrer stellaren Mitglieder, dann muss die Gravitationskraft der Wolke für den Zusammenhalt des Clusters maßgeblich sein und nicht die wechselseitige Anziehung der Sterne untereinander. Anders gesagt: Sobald die Wolke sich auflöst, driften die Sterne auseinander. Astronomen vermuten, dass es in T-Assoziationen stellare Winde sind – also kräftige Gasströme, die von den Sternen ausgehen –, welche die Elternwolke nach und nach wegblasen.
Den zweiten Typ stellarer Gruppen, die sich in der Milchstraße leicht beobachten lassen, bezeichnen Astronomen als OB-Assoziation. Solche Gruppen beherbergen typischerweise zehnmal mehr Sterne als T-Assoziationen, darunter einige so genannte O- und B-Sterne. Diese Sterntypen zählen zu den leuchtstärksten und massereichsten im gesamten Universum. Auch der rund 1500 Lichtjahre entfernte Orion-Trapezium-Haufen ist eine OB-Assoziation: Er enthält vier sehr massereiche O- sowie rund 2000 kleinere Sterne, darunter viele vom T-Tauri-Typ. In diesem Cluster herrscht die höchste Sterndichte, die in unserem Teil der Milchstraße zu finden ist.
Irgendwann lassen sich die schnellen Sterne nicht mehr im Zaum halten
Alle OB-Assoziationen gehen aus besonders massereichen Elternwolken hervor und besitzen ähnlich große Dichten. Den extrem starken Gravitationskräften innerhalb solcher Formationen zum Trotz schleudern sich die Sterne aber eines Tages selbst aus den Haufen hinaus. Auf Fotos von voll entwickelten OB-Assoziationen, die im Abstand von einigen Jahrzehnten aufgenommen wurden, lässt sich die dadurch größer gewordene Entfernung zwischen einzelnen Sternen ablesen. Eine der Ursachen: Die enorme Schwerkraft der Elternwolke bringt die Sterne von Anfang an auf hohe Bahngeschwindigkeiten. Darum entweichen sie, kaum dass die Wolke ausdünnt.
Während ihres kurzen Lebens setzen die O- und B-Sterne in OB-Assoziationen ihre Elternwolke unter starken Beschuss durch ultraviolette Strahlung. Wie die Sonne auch beziehen sie ihre Energie aus Kernfusionsprozessen, doch brennt ihr nuklearer "Ofen" weitaus stärker: Ein typischer O-Stern mit etwa 30-facher Sonnenmasse verfeuert sein Fusionsmaterial in wenigen Millionen Jahren. Seine ultraviolette Strahlung ionisiert das umgebende Gas – daher rührt auch das Leuchten der ionisierten Staub- und Gaspartikel im Orion-Trapezium-Haufen –, wodurch Temperatur und Druck steigen und die Elternwolke in den umgebenden Raum expandieren lassen. In dem Maß, in dem die Wolke ausdünnt, schwindet aber auch ihre Schwerkraft. Irgendwann kann sie die kleinen, schnellen Sterne nicht mehr im Zaum halten, so dass diese weit aus dem System geschleudert werden.
Darüber hinaus gibt es aber auch einen bemerkenswert stabilen Typ von Sternhaufen, die so genannten offenen Sternhaufen. Sie sind sehr viel seltener, bestehen aus bis zu 1000 gewöhnlichen Sternen und können über hunderte Millionen Jahre, zuweilen sogar über Jahrmilliarden hinweg zusammenhalten. Die ursprünglichen Molekülwolken – und damit die von ihnen ausgehende Schwerkraft – sind aus diesen Systemen längst verschwunden.
Auch die Plejaden sind ein solcher offener Cluster. Vor 125 Millionen Jahren entstanden, hat sich seine Elternwolke wohl bereits vor rund 120 Millionen Jahren aufgelöst. Die Hyaden, am Sternhimmel nicht weit von den Plejaden entfernt, sind sogar 630 Millionen Jahre alt. In den Randzonen unserer Galaxie gibt es Dutzende offener Cluster, die noch älter sind. M67 zum Beispiel, eine Formation aus rund 1000 Sternen, ist vor vier Milliarden Jahren entstanden.
Aber selbst offene Cluster sind nicht unsterblich. Astronomen vermuten, dass die von vorüberziehenden Molekülwolken ausgehende Schwerkraft die Formationen allmählich verkleinert und zerstreut. Dennoch geben offene Sternhaufen große Rätsel auf. Während die Forscher nach jahrzehntelanger Forschung recht gut erklären können, wie die allmähliche Auflösung der Elternwolken den Zerfall von T- und OB-Assoziationen auslöst, haben sie bis heute noch keine Antwort darauf gefunden, warum offene Cluster den Zerfall ihrer Elternwolken über viele Millionen Jahre hinweg in fester Formation zu überstehen vermögen.
Wie entscheidet sich, welche Art von Haufen entsteht?
Für mich war dieses Rätsel von Anfang an Teil eines größeren Themenkomplexes, dessen zentrale Fragen lauteten: Warum gibt es in unserer Galaxie nur eine begrenzte Zahl von Clustertypen? Und wie entscheidet sich, welche Art Cluster eine Molekülwolke bildet? Auf der Suche nach Antworten betrachtete ich die Kräfte, die in Sternhaufen wirken. In den von mir untersuchten drei Clustertypen zeigten sich zwei gegenläufige Prozesse am Werk: Kontraktion, ausgelöst durch die Schwerkraft der Elternwolken, und Expansion als Folge von stellaren Winden und ionisierender Strahlung. Jede Wolke, in der sich Sterne bilden, ist diesen entgegengesetzt wirkenden Einflussfaktoren in unterschiedlich hohem Maß unterworfen. Bei T- und OB-Assoziationen setzt sich am Ende die Expansion durch. Bei offenen Clustern scheinen sich Expansion und Kontraktion hingegen auszugleichen – zumindest während der kritischen Phase, in der sich die Mitgliedersterne bilden.
Das Kräftegleichgewicht in einer Wolke, so schloss ich, bestimmt also nicht nur über ihr eigenes Schicksal, sondern auch über dasjenige des von ihr erzeugten Sternhaufens. Weiterhin vermutete ich, dass der Schlüssel zu dieser Balance in der Ausgangsmasse der Elternwolke zu suchen ist. Denn das Maß, in dem eine Wolke kontrahiert, hängt von ihrer Schwerkraft und diese wiederum von ihrer Masse ab. Darüber hinaus bestimmt ihre Masse über die Zahl der erzeugten Sterne. Nehmen wir das Beispiel einer Wolke geringer Masse: Sie zieht sich langsam zusammen, wobei allmählich ihre Dichte steigt und es schließlich zur Bildung einer kleinen Zahl gewöhnlicher Sterne kommt. Anschließend bläst der solare Wind dieser Sterne die Wolke allmählich weg und wirkt dadurch der Kontraktion entgegen. Am Ende entkommen die Himmelskörper ins All. Dieses Szenario passt gut zu unseren Beobachtungen von T-Assoziationen. Das andere Extrem ist eine Wolke mit einer um etwa das Zehnfache höheren Masse, die sich viel schneller zusammenzieht und in der auf engem Raum zahlreiche Sterne entstehen. Der Zentralbereich der Wolke erreicht mit der Zeit eine so hohe Dichte, dass es auch zur Geburt einiger sehr massereicher Sterne kommt. Die starke Strahlung dieser Sterne bläst die Elternwolke dann zügig weg – genau das beobachten wir in OB-Assoziationen tatsächlich –, so dass die schnellen Mitglieder des Haufens rasch aus der Formation ausbrechen können.
Wahrscheinlich existieren auch Wolken, deren Masse zwischen den Extremen liegt. Auf sie würden beide Einflüsse im gleichen Maß wirken: Sie ziehen sich einerseits zusammen und verlieren andererseits Masse. Das Ergebnis ist eine Molekülwolke, die eine ständig wachsende Zahl junger, eng benachbarter Sterne enthält; sehr massereiche Exemplare würden sich dabei aber nicht bilden. Selbst wenn stellare Winde die Wolke anschließend wegtreiben, reichen die wechselseitigen Gravitationskräfte der dicht gedrängten Sterne nun aus, um sie über sehr lange Zeiträume aneinanderzubinden. Diese Konfiguration ähnelt derjenigen, die Astronomen in offenen Clustern beobachten.
In meiner Theorie des Kräftegleichgewichts postuliere ich, dass die Ausgangsmasse einer Elternwolke das innere Wechselspiel aus Kontraktion und Expansion bestimmt und damit auch die Entwicklung des aus ihr entstehenden Clusters. Doch während sich die Expansion von OB-Assoziationen und die anschließende Verteilung ihrer Sterne im Raum direkt untersuchen lassen, kann man bislang nicht durch Beobachtungen belegen, dass sich Molekülwolken überhaupt zusammenziehen. Noch weniger klar ist, ob sie dies entsprechend meiner Theorie tun. Wie ließe sich das prüfen? Ein solcher Vorgang würde sicherlich in den frühesten Anfängen der Clusterbildung erfolgen. Ich müsste also sehr junge Sterngruppen wie etwa die eingebetteten Cluster untersuchen. Weil deren Inneres aber verborgen bleibt, bot sich ein anderer Weg an: Ich musste nachweisen, dass ältere Cluster schon vor langer Zeit durch eine Kontraktionsphase gegangen sind.
Bald fand ich einen Hinweis darauf, wie mir das gelingen könnte. Bereits in den späten 1950er Jahren hatte der Astronom Maarten Schmidt vom California Institute of Technology herausgefunden, dass die Gasdichte in einer bestimmten Wolkenregion und die dortige Sternentstehungsrate miteinander in Beziehung stehen; dieser empirische Zusammenhang ist mittlerweile als Schmidt-Kennicutt-Gesetz bekannt. Wenn also die Dichte einer Elternwolke im Verlauf ihrer Kontraktion zunimmt, sollte, während der Cluster noch sehr jung war, auch die Rate der Sternbildung gewachsen sein.
Zum Glück liefert die Theorie der Sternentstehung das nötige Werkzeug frei Haus, um diese längst vergangenen Sternentstehungsraten zu messen. Sie beschreibt neben vielen anderen Dingen, wie sich junge Sterne, deren nuklearer Ofen noch nicht gezündet hat, mit der Zeit entwickeln. Zu diesen Himmelskörpern zählen auch die T-Tauri-Sterne. Sie besitzen ungefähr die Masse unserer Sonne und leuchten ähnlich hell. Zumindest anfangs geht dieses Leuchten aber nicht auf Fusionsreaktionen in ihrem Inneren zurück, sondern darauf, dass sie sich unter ihrer eigenen Schwerkraft immer stärker zusammenziehen, wobei sie die frei werdende Energie in Form von Wärme abstrahlen.
Obwohl die Kompressionsrate allmählich sinkt, steigt die Oberflächentemperatur weiter; mit zunehmendem Alter werden die Objekte also immer heißer und mit abnehmendem Radius immer leuchtschwächer. Kennt man Oberflächentemperatur und Leuchtstärke eines T-Tauri-Sterns und darüber hinaus dessen Abstand zur Erde, lässt sich daher berechnen, wie lange er bereits kontrahiert, und damit auch, wie alt er ist. Könnte man sich also einen Überblick über die Altersverteilung in einem Cluster verschaffen, erhielte man Aufschluss darüber, wann und mit jeweils welcher Rate sich seine Mitgliedersterne gebildet haben.
Unsere Methode auf nahe gelegene stellare Gruppen anzuwenden, war nicht schwierig – für sie existieren die meisten Daten. Palla und ich fanden heraus, dass in allen Gruppen, die heute noch reichlich Gaswolken besitzen, die Sternbildungsrate mit der Zeit angestiegen ist. Beispielsweise wiesen wir im Jahr 2000 nach, dass sich die Sternbildungsrate im Orion-Trapezium-Haufen im Verlauf von Jahrmillionen immer weiter beschleunigt hat, bevor die Elternwolke verschwand. Damit sah ich meine Vermutung bestätigt, der zufolge Cluster bildende Wolken in der Frühphase ihrer Entwicklung tatsächlich kontrahieren.
Im Jahr 2007 modellierte ich mit meinem damaligen Doktoranden Eric Huff, der heute an der Ohio State University forscht, die Elternwolke des Orion-Trapezium-Haufens; dabei ließen wir die von mir postulierten Kontraktions- und Expansionskräfte einfließen. In Computersimulationen auf Basis dieses Modells kontrahierte die simulierte Wolke exakt gemäß unseren Vorhersagen. Anschließend griffen wir zusätzlich auf das Schmidt-Kennicutt-Gesetz zurück und zeigten, wie die zunehmende Dichte in bestimmten Wolkenregionen nach und nach Einfluss auf die lokale Sternbildungsrate gewinnt. Außerdem stimmte die beschleunigte Sternentstehungsrate, die unser Modell lieferte, mit derjenigen überein, die Palla und ich durch Altersmessungen von Sternen im Orion-Trapezium-Haufen ermittelt hatten. Dieser Befund erhärtet die Kontraktionshypothese also zusätzlich.
Unglücklicherweise lassen sich die Methoden zur Untersuchung von Sternentstehungsraten in der Vergangenheit nicht auf offene Cluster übertragen – die meisten davon sind einfach zu alt. Ihre durch Kontraktion und Sternbildung geprägte Jugendphase von einigen Millionen Jahren Dauer macht nur einen winzigen Bruchteil ihrer gesamten Lebensspanne aus, und die zu ihrer Untersuchung erforderliche Auflösung besitzen unsere Werkzeuge zur Bestimmung des Sternalters nicht einmal annähernd. Auch der Gedanke, die Elternwolken offener Cluster einfach zu simulieren, führt nicht weiter: Diese Wolken verschwanden vor so langer Zeit, dass wir über ihre Massen und ihr Verhalten überhaupt nicht sinnvoll spekulieren können.
Man kann allerdings einen offenen Cluster modellieren, dessen Elternwolke bereits verschwunden ist. Der Weg dorthin führt über Mehrkörpersimulationen, bei denen der Computer komplexe, ineinandergreifende Gleichungen löst, welche die Bewegung einer Vielzahl von Objekten unter Einfluss ihrer wechselseitigen Schwerkraftanziehung beschreiben. Mit diesem Ansatz konnten Forscher herausfinden, was in offenen Clustern geschieht, sobald sie die anfängliche Phase der Kontraktion und Sternbildung hinter sich gelassen haben.
Manche der so gewonnenen Erkenntnisse kamen recht unerwartet. Trotz ihrer bemerkenswerten Stabilität sind offene Haufen nicht statisch. Die wechselseitigen Schwerkrafteinflüsse ihrer Mitgliedersterne erzeugen einen langsamen Wirbel, bei dem die Sterne einander umtanzen wie Bienen, die um ihren Korb schwärmen. Was bei diesem Tanz geschieht, errechnen die Mehrkörperalgorithmen auf so effiziente Weise, dass ein Standard-PC genügt, um die Entstehung eines 1200-Mitglieder-Systems wie des Plejaden-Clusters zu simulieren. Vor einigen Jahren haben mein damaliger Student Joseph Converse, heute an der University of Toledo im US-Bundesstaat Ohio, und ich mit Hilfe dieses numerischen Modells die Geschichte der Plejaden zu rekonstruieren versucht. Wir gaben einer zufälligen Anfangskonfiguration 125 Millionen Jahre Zeit, um sich zu entwickeln, und verglichen den vom Computer generierten Cluster anschließend mit seinem realen Pendant. Dann änderten wir die Anfangsbedingungen so lange, bis die Simulation eine Gruppe erzeugte, die dem Original ähnelte.
Die Plejaden expandieren, bleiben aber intakt
Was wir sahen, überraschte uns. Offenbar hat sich der Plejaden-Cluster trotz der ihn bindenden Gravitationskräfte über seine gesamte Lebensdauer hinweg mehr oder minder gleichmäßig ausgedehnt, indem sich die Sterne langsam, aber stetig voneinander entfernten. Das widerspricht früheren Analysen, denen zufolge sich Sterne in offenen Clustern mit der Zeit so verteilen, dass im Zentrum die schwereren und in den Außenregionen vergleichsweise leichte Exemplare anzutreffen sind; dieses als dynamische Relaxation bezeichnete Schema trifft etwa auf Kugelsternhaufen zu. Selbst wenn wir unsere Mehrkörpersimulation weitere 900 Millionen Jahre laufen ließen, setzte sich die gleichmäßige Expansion fort. Die Plejaden erschienen am Ende zwar aufgebläht, aber immer noch intakt. Offenbar übersah man bisher einige wichtige Faktoren, die für das Gleichgewicht der zur Clusterbildung führenden Kräfte eine Rolle spielen.
Was bringt die offenen Haufen dazu, sich auf so gleichmäßige Weise auszudehnen? Der Schlüssel zum Verständnis, so fanden Converse und ich heraus, sind die in Sterngruppen recht häufigen Doppelsterne, also Paare von Sternen, die einander in geringem Abstand umkreisen. Mitte der 1970er Jahre zeigten Simulationen von Douglas Heggie, heute an der schottischen University of Edinburgh, dass bei Annäherung eines dritten Sterns an einen Doppelstern ein Trio entsteht und einen komplizierten "Tanz" aufzuführen beginnt. Er endet gewöhnlich damit, dass der leichteste der drei Sterne mit hohem Tempo aus der Gruppe geworfen wird. Gerät dieser dann in die Nähe anderer Haufenmitglieder, gibt er einen Teil seiner Energie an diese weiter. Dadurch erhöhen sich deren Bahngeschwindigkeiten, der Cluster "erhitzt" sich gewissermaßen und dehnt sich aus – unserer Simulation zufolge allerdings so langsam, dass dies Astronomen normalerweise nicht auffallen dürfte.
Die Beobachtung von Sternhaufen hat also letztlich nicht nur einige Belege für meine Hypothese, der zufolge die Ausgangsmasse einer Molekülwolke sowohl die Struktur als auch die Entwicklung eines Clusters bestimmt, zu Tage gefördert. Meine Untersuchungen bieten darüber hinaus Ansatzpunkte für weitere Studien; so könnten Astronomen nach Wegen suchen, die gleichförmige Expansion offener Cluster durch Messungen nachzuweisen. Zugleich offenbaren sie die vielen Lücken in unserem Verständnis von Sternhaufen. Trotz aller Fortschritte in der Computersimulation können wir noch nicht befriedigend modellieren, wie die lokalen Dichten in Elternwolken groß genug werden, damit sich Sterne bilden. Und trotz jahrzehntelanger Beobachtungen mit Radio- und Infrarotteleskopen können wir noch immer nicht nachvollziehen, welchen Mustern die Bewegungen innerhalb der Wolken folgen. Die sich im Inneren dicker Staubwolken abspielende Geburtsphase stellarer Gruppen bleibt rätselhaft.
Dennoch kann das von mir und meinen Kollegen entwickelte Modell des Kräftegleichgewichts helfen, mehr über diese Geburtsphase und ihre weitere Entwicklung zu erfahren. Mit einer Kombination aus analytischen Studien und Mehrkörpersimulationen wollen wir nachweisen, dass eine Wolke, die in gleichem Maß Masse verliert, wie sie kontrahiert, in der Tat ein durch Gravitationskräfte gebundenes Gebilde hervorbringt, das einem offenen Cluster ähnelt. Weiterhin wollen wir mit Hilfe von Modellen erkunden, wie sich die Kontraktion von im Entstehen begriffenen T-Assoziationen umkehrt, so dass die Mitgliedersterne in den Weltraum entkommen. Spielen stellare Winde dabei wirklich eine so entscheidende Rolle, wie die Astronomen stets glaubten?
Lange Zeit galten Studien an stellaren Gruppen als Randgebiet der Astronomie. Nun aber werden sie für andere Teildisziplinen immer wichtiger. Einigen Astronomen zufolge bildete sich unsere Sonne in einer dicht bevölkerten OB-Assoziation; andere Sterne in ihrer Nähe wirbelten die sie umgebende Scheibe aus Gas und Staub dann in einer Weise durcheinander, dass aus ihr das Sonnensystem entstand. Auch für die Entwicklung des interstellaren Mediums und sogar ganzer Galaxien spielen die von uns untersuchten Molekülwolken eine wichtige Rolle. Alles, was wir über Sternhaufen lernen, wird uns letztlich den Weg zu einem besseren Verständnis des gesamten Universums ebnen.

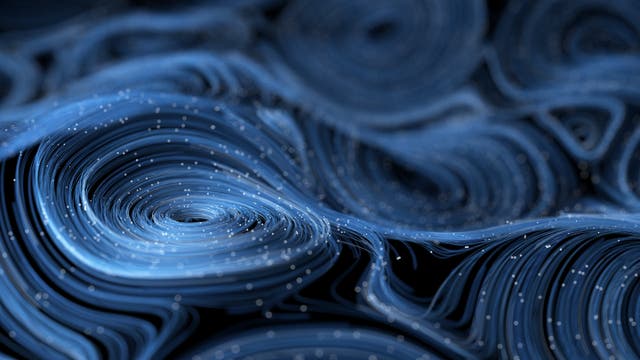
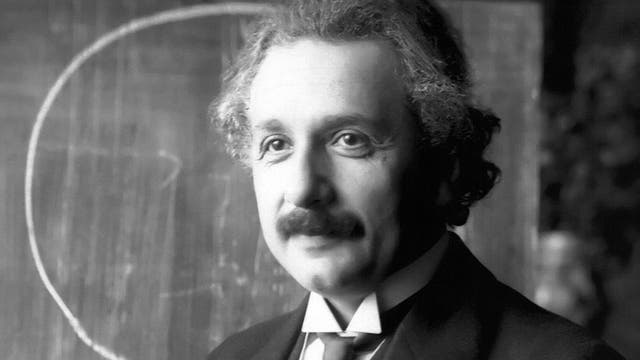
Schreiben Sie uns!
1 Beitrag anzeigen