Schnelle Evolution: Gleicher See, anderer Fisch

Wann und wie genau der Dreistachlige Stichling seinen Weg in den Bodensee gefunden hat, daran scheiden sich die Geister der Evolutionsforschung. Er soll vor 150 Jahren ausgesetzt worden sein, sagen die einen; er kam vor 1000 Jahren auf natürliche Art und Weise, sagen die anderen. "So oder so: Wir reden hier evolutionsbiologisch betrachtet von einer sehr kurzen Zeit", sagt Stichlingsexperte Daniel Berner von der Universität Basel.
Bei einem Zeitpunkt sind die Forscher sich einig – vor 12 000 Jahren, als die letzte Eiszeit sich ihrem Ende zuneigte und die Eisschmelze neue Zugänge frei legte, konnte sich Gasterosteus aculeatus erstmals aus dem Meer in Flüsse und Seen begeben. Hier passten sich die Stichlinge mit der Zeit ihrer jeweiligen neuen Umgebung an. Besonders gut geht diese Differenzierung bei Stichlingen deswegen voran, weil die unterschiedlichen Populationen lieber unter sich bleiben und es darum wenig genetischen Austausch zwischen den Gruppen gibt. Das macht die Fische zu einem beliebten Modellorganismus für Evolutionsbiologen.
Im Bodensee sieht die spezielle Situation allerdings anders aus: Ein Teil der Stichlinge hat die Zuflüsse besiedelt, ein anderer den See. Während der Paarungszeiten müssen die Zuflussbewohner jedoch enger zusammenrücken – denn nun gesellen sich ihre Verwandten aus dem See zu ihnen. Dadurch kommt es viel öfter zu Begegnungen, bei denen die Gene beider Gruppen vermischt werden. Üblicherweise findet erst dann eine Auseinanderentwicklung statt, wenn unterschiedliche Nischen besetzt werden und die Populationen sich auch räumlich getrennt voneinander fortpflanzen. Umso erstaunlicher ist es daher, dass sich im Bodensee die beiden Stichlingstypen genetisch und äußerlich unterscheiden – und diese Unterschiede auch beibehalten.
Alles nur Äußerlichkeiten?
Ein Beispiel: Im offenen Gewässer sind die Stichlinge ungeschützter als in Flüssen. Zum Schutz vor Fressfeinden haben die Seestichlinge daher entlang ihres Körpers gut ausgebildete Knochenplatten entwickelt, während die Flussstichlinge mit leichterer Rüstung auskommen. Dieser Unterschied in der Panzerung ist bereits nachweislich genetisch determiniert. Anders verhält es sich mit einem weiteren äußerlichen Merkmal: der Größe. Seestichlinge sind merklich länger und zirka doppelt so schwer wie solche, die im Fluss heranwachsen. Das liegt laut Daniel Berner aber primär an den Hauptnahrungsquellen. Im Fluss zählen dazu vorrangig kleine Krebstiere, im See hingegen Plankton. Auf den ersten Blick erscheint es kontraintuitiv, dass Fische, die sich von Plankton ernähren, größer werden als solche, die gehaltreichere Tiere fressen. Und tatsächlich wachsen Seestichlinge viel langsamer. Auch werden sie nicht schon nach einem Jahr geschlechtsreif, sondern erst nach zwei Jahren – und in zwei Jahren überholen sie trotz Ernährungsdefizit ihre Flussverwandten letztlich doch noch körperlich. Phänotypische Plastizität nennen Evolutionsbiologen das.

Um nachzuweisen, dass der Größenunterschied von der Umgebung beeinflusst wird und weniger von den Genen, zog Daniel Berners Forschungsgruppe zunächst beide Typen Stichlinge unter standardisierten Laborbedingungen auf. Sie fanden keinerlei Hinweise darauf, dass genetische Abweichungen einen Einfluss auf das Wachstum oder die Entwicklung der Geschlechtsreife haben. Im Anschluss setzten sie junge Seestichlinge aus dem Labor in den Bodenseezuflüssen aus – in eigens abgegrenzten sechs Meter langen Flussabschnitten. Und tatsächlich: Als die Versuchsfische im Fluss von den Forschern zur Paarungszeit gewogen wurden, waren auch sie nur so schwer wie Flussstichlinge. "Theoretisch hätten wir das Experiment der Vollständigkeit halber auch umgekehrt ausführen müssen, also Flussstichlinge aus dem Labor kontrolliert im Seehabitat aussetzen, um zu sehen, ob sie dort zum Kontrollzeitpunkt schwerer und größer sind", erklärt Berner. Aber im See sei es nahezu unmöglich, einen für das Feldexperiment sinnvollen Bereich abzugrenzen. Dieser müsse viel größer sein als der im Fluss, und das wäre technisch nicht möglich. Doch die Forscher fühlen sich auch ohne Gegenprobe in ihrem Ergebnis bestätigt.
Die Auseinanderentwicklung zeigt sich im Erbgut
Wie weit sich die Stichlingspopulationen im Bodensee jedoch tatsächlich schon auseinanderentwickelt haben, zeigt sich erst, wenn Forscher die Gensequenzen minutiös miteinander vergleichen. In einer aktuellen Studie von Wissenschaftlern der Universität Bern konnten 37 Abschnitte im gesamten Genom gefunden werden, in denen sich See- und Flusspopulationen maßgeblich unterscheiden. Man könne hier quasi live miterleben, wie sich eine Art in zwei Arten aufspalte, so Erstautor David Marques vom Schweizer Wasserforschungsinstitut Eawag. Er ist mit dem Wort "Art" an sich allerdings wissenschaftlich gesehen nicht wirklich zufrieden. Er spricht lieber von verschiedenen "Ökotypen".
In der modernen Evolutionsforschung komme es immer wieder zu Debatten über den Artbegriff, erzählt Marius Rösti, der sich an der Universität Basel ebenfalls jahrelang mit den Bodenseestichlingen beschäftigt hat: "Der Konsens ist, dass die Frage nach Art oder nicht Art keine zentrale für die Evolutionsbiologie darstellt. Eine Art ist ein menschlicher Versuch zu klassifizieren und oft eine reine Arbeitshypothese." Anders gesagt: Forscher wie Rösti, Marques und Berner interessiert es nicht unbedingt, ab wann man von einer neuen Art reden kann, sondern vielmehr, wie biologische Vielfalt entsteht. Insofern stellen sie sich im Fall der Stichlinge im Bodensee hauptsächlich die Frage, wie es zu der Entwicklung kam, obwohl die Fische sich sehr häufig die Laichplätze teilen.
Hybriden im Nachteil
Eine These ist, dass die Abkömmlinge einer Kreuzung von See- und Flussstichling schlichtweg im Nachteil sind – egal in welcher Umgebung – und sich die beiden Ökotypen deswegen so stabil halten. Daniel Berner hat dazu weitere Feldexperimente durchgeführt. Er züchtete mit seinen Kollegen, um die Umwelteffekte zu eliminieren, zunächst im Labor See- und Flussstichlinge sowie eine Kreuzung der beiden. Die drei Populationen wurden dann in den Zufluss-Freilandgehegen ausgesetzt, und es zeigte sich, dass die Flussfische Seefischen und Hybriden im Flusslebensraum klar auskonkurrieren. "Wir schließen daraus, dass relativ unscheinbare Änderungen an vielen Genen ausreichen, um Populationen an ihren Lebensraum anzupassen", sagt Berner.
Dadurch, dass die Seestichlinge in der Flussumgebung so schlecht wegkommen, wird auch die Hybridisierung erschwert. Und selbst wenn sie stattfindet, wird das See-Erbgut zum Teil wieder aussortiert. Dabei handelt es sich um einen wichtigen Prozess in der Artbildung beziehungsweise in der Entwicklung von biologischer Vielfalt. Die bisherige Differenzierung der beiden Ökotypen bedeutet im Übrigen nicht zwangsläufig, dass sie sich immer weiter voneinander entfernen: "Je nachdem, wie sich ihre Lebensräume entwickeln, kann es auch sein, dass sie irgendwann wieder dieselbe Nische besiedeln und wieder zu einer Population werden", gibt David Marques zu bedenken. Die Evolution ist keine Einbahnstraße.


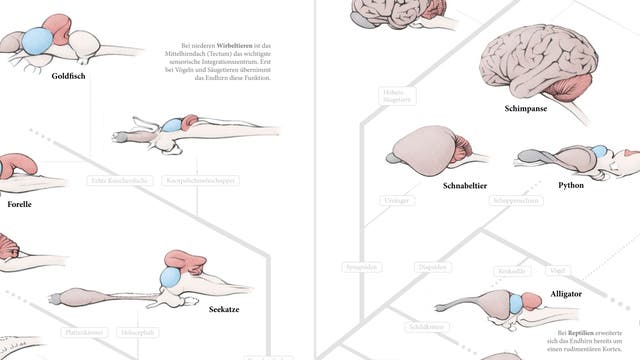




Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.