Radioastronomie: LOFAR läuft!
Die über mehrere Länder verteilte Teleskopanlage LOFAR zur Untersuchung des Radiohimmels bei Wellenlängen von zwischen 1 und 30 Meter erreicht mit Hilfe eines in Echtzeit arbeitenden Supercomputers die Auflösung optischer Teleskope und wird zehnmal so viele Radioquellen finden wie bisher bekannt sind.

© Thüringer Landessternwarte / M. Pluto (Ausschnitt)

© James Anderson, MPI für Radioastronomie (Ausschnitt)
LOFAR-Station Effelsberg | In unmittelbarer Nähe zum 100-Meter-Radioteleskop bei Effelsberg in der Eifel entstand bereits im Jahr 2007 die erste LOFAR-Station. Aus luftiger Höhe vom Teleskop fällt der Blick auf das Lowband-Antennenfeld im Vordergrund und die dunkle Highband-Antennenfläche im Hintergrund. Die Highband-Antenne besitzt eine Größe von 62 x 62 Metern.
Bis April 2010 wurden 22 Stationen vollständig aufgebaut und in technischer Hinsicht abgenommen. Sie befinden sich in den Niederlanden und in Deutschland. Die beiden deutschen Standorte sin Tautenburg und Effelsberg (siehe Bild). Seitdem stehen die fertig gestellten Stationen den Astronomen für Testbeobachtungen zur Verfügung.
Weitere Stationen sind zurzeit im Bau: In den Niederlanden arbeiten die Astronomen an 16 neuen Anlagen. In Deutschland entsteht eine neue Station in Unterweilenbach, die das MPI für Astrophysik in Garching betreiben wird, und eine weitere in Bornim, die das Astrophysikalische Institut Potsdam baut. Eine Station in Jülich in Zusammenarbeit mit dem John von Neumann Institute for Computing (NIC) soll bis zum Jahresende folgen. Zusätzliche Stationen in Südengland, Mittelfrankreich und Südschweden sind zur Zeit im Bau, weitere sind geplant.

© Spektrum der Wissenschaft / Emde Grafik (Ausschnitt)
LOFAR-Stationen | Quer über Europa erstreckt sich das Radioteleskop LOFAR. Antennenfelder an Standorten in Großbritannien, den Niederlanden, Schweden, Frankreich, Deutschland, Polen, der Ukraine und Italien spannen ein großes Interferometer mit einer Basislänge von mehr als 2000 Kilometern auf. Die ersten Stationen in den Niederlanden und in Deutschland sind nun in Betrieb; die Grafik zeigt alle geplanten Stationen in Europa.
Das Radiobild des gesamten Himmels einer einzelnen LOFAR-Station erreicht zwar nur eine Auflösung von rund drei Grad, es erforderte aber kaum eine Minute Messzeit. Soll jedoch die gleiche Auflösung wie bei einem optischen Teleskop mit nur zehn Zentimeter Durchmesser erreicht werden, so muss die effektive Öffnung des Teleskops gigantische 1000 Kilometer betragen. Das ist bei LOFAR der Fall.
Die Beobachtungsdaten aller Stationen verarbeitet ein Supercomputerin Echtzeit. Jede Station sendet ihre Daten mit einer Rate von drei Gigabit pro Sekunde. Im Rechenzentrum in Groningen werden daraus Himmelskarten berechnet. Zwischen- und Endprodukte gelangen in ein spezielles Datenarchiv, zu dem das Forschungszentrum Jülich die Speicherkapazität von einem Petabyte (1000 Terabyte) beisteuert, und stehen dann den Astronomen zur Verfügung.
Zur offiziellen Eröffnung von LOFAR am 12. Juni 2010 erwarten wir Wissenschaftler und Politiker aus allen beteiligten Ländern. An diesem Termin wird das Radioteleskop formal den Astronomen zur Nutzung übergeben. Auch wenn zu diesem Zeitpunkt noch nicht alle geplanten Stationen aufgebaut sind, so zeigen schon die bisherigen Ergebnisse, dass auch mit Teilen von LOFAR bereits spektakuläre Himmelsaufnahmen möglich sind.
Matthias Hoeft, Rainer Beck
Der gesamte gleichnamige Beitrag ist in Sterne und Weltraum 6/2010, S. 20-22 abgedruckt: www.astronomie-heute.de/artikel/1030152. Das Heft ist ab dem 18. Mai 2010 erhältlich.
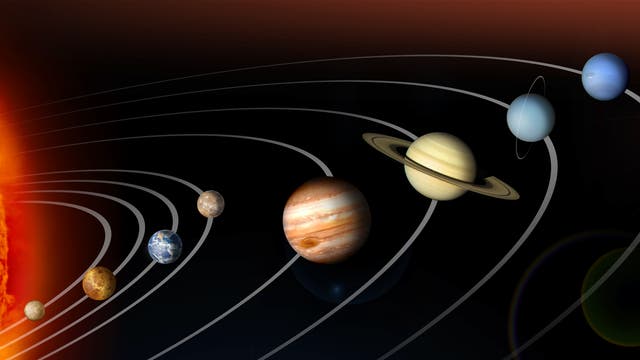


Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.