News: Symmetrisches Gedächtnis
Eben noch war es lediglich ein Stück zusammengeknüllter Draht, doch im nächsten Augenblick entfaltet es sich zu einem schwungvoll gebogenen Herzen ohne Ecken und Kanten. Mathematiker sind nun dem Geheimnis der Formgedächtnislegierungen zu Leibe gerückt.
Phasenübergänge sind ein grundlegender Vorgang in der Natur. Neben Übergängen zwischen einer flüssigen und einer festen Phase, wie zwischen Eis und Wasser, gibt es auch Übergänge in Festkörpern, bei denen sich die Kristallstruktur ändert. Ein wichtiges Beispiel dafür ist Eisen, wo ein Übergang zwischen einem kubisch-raumzentrierten und einem kubisch-flächenzentrierten Kristallgitter stattfindet. Ein anderes Beispiel sind Legierungen "mit Gedächtnis", die sich bei niedrigen Temperaturen verformen lassen und beim Erhitzen wieder ihre ursprüngliche Gestalt annehmen. Beide Beispiele unterscheiden sich in einer Hinsicht fundamental: Reines Eisen kann leicht plastisch verformt werden und ist daher weich im Vergleich zu den Formgedächtnislegierungen.
Doch weiches Eisen lässt sich durch Veredelung auch zu hartem Stahl machen. Dabei entdeckte als erster der deutsche Metallurgist Adolf Martens (1850-1914) in Stahl und Eisen charakteristische, feinskalige Strukturen, die mit bloßem Auge unsichtbar sind. Diese Strukturen treten bei Phasenübergängen auf. Er beobachtete, dass harte Stähle eine regelmäßige, geordnete Mikrostruktur aufweisen, während Eisen eine ungeordnete und viel komplexere Struktur besitzt. Auch heute noch ist die Frage, welche Legierungselemente und welche Prozessführung man bei der Stahlherstellung wählen soll, um ganz bestimmte Mikrostrukturen zu erzeugen, ein zentrales Thema in der Stahlforschung. Diese Strukturen entstehen durch Phasenübergänge; Martens zu Ehren nennt man diese Strukturen sowie die entsprechenden Phasenübergänge martensitisch.
Sowohl in Eisen aber auch in Formgedächtnislegierungen treten martensitische Phasenumwandlungen auf, und beide Materialklassen sind durch eine ähnliche kristallographische Struktur gekennzeichnet. Doch warum ist dann die Mikrostruktur in Eisen so viel schwächer ausgeprägt als in Formgedächtnislegierungen? Warum zeigt Eisen leicht plastisches Verhalten, aber keinen Formgedächtniseffekt? Warum sind umgekehrt die Umwandlungen in Formgedächtnislegierungen, anders als in Eisen, reversibel?
Forschern des Max-Planck Instituts für Mathematik in den Naturwissenschaften in Leipzig ist es gemeinsam mit Kollegen am California Institute of Technology und der Universität Padua gelungen, eine einfache Erklärung für diese Fragen zu finden. Die Grundidee lässt sich dabei leicht an einem Modell nachvollziehen, in Rahmen dessen man in Gedanken von einer Phase zu einer anderen und wieder zurück reist.
Gestartet wird sowohl für Eisen als auch für ein Formgedächtnismaterial bei hohen Temperaturen. Das Atomgitter sei jeweils quadratisch, die dritte Raumdimension ist der Einfachheit halber zu ignorieren. Bei Formgedächtnismaterialien tritt nun eine Symmetriereduktion ein. So kann seine Struktur sich in dem zweidimensionalen Beispiel von quadratisch zu rhombischen wandeln. Die Wahlmöglichkeit zwischen mehreren rhombischen Gittern führt zur Mikrostruktur. Erhitzt man das Formgedächtnismaterial in diesem Gedankenexperiment, wandelt sich das rhombische wieder in das ursprüngliche quadratische Gitter um – die Umwandlung ist reversibel.
Anders beim Eisen: Zwar wird auch hier bei hohen Temperaturen mit einem quadratischen Gitter gestartet. Bei Abkühlung wandelt sich es sich jedoch in ein hexagonales Gitter um – im Prinzip eine stärkere Scherung als bei Eisen. Das hexagonale Gitter besitzt nun aber eine andere, neue Symmetrie. Mehrere Zelle sind aufgrund dieser Symmetrie äquivalent zueinander. Wird das Material wieder erhitzt, kann es daher entweder zu dem Ausgangszustand zurückkehren oder zu einem neuen, ebenfalls quadratischen Zustand wechseln, wobei hier jedoch die Atome plötzlich um ein Atom gegeneinander verschoben sind.
Anders formuliert: Durchläuft das zweidimensionale Modell für Eisen einen Zyklus von zwei Phasenübergängen, so kann es auf dieser Reise eine plastische Verformung mitnehmen, da die Energiebarriere für die plastische Verformung nicht größer als die Barriere des Phasenübergangs selbst ist. Die Reise führt also nicht unbedingt zum Ausgangspunkt zurück. Die Transformation ist irreversibel.
Diese Überlegungen lassen sich mit mathematischen Methoden, die aus der Gruppentheorie stammen, auf eine dreidimensionale Situation übertragen. Auf diese Weise kann man zeigen, warum in einem Eisenkristall wegen der Vielfalt der möglichen Umwandlungspfade in der Tat beliebig große Verformungen entstehen. Dies führt zu plastischer Deformation und damit zu Irreversibilität. Diese mikroskopische Überlegung kann durchaus makroskopische Verformungen erklären.
Abseits von Formgedächtnismaterialen und Eisen kann diese mathematische Erkenntnis auch anderweitig nützlich sein: So finden martensitische Phasenübergänge auch in Keramiken und Polymeren statt, und selbst in biologischen Systemen wie dem T4-Bakteriophagen, einem Virus, lassen sie sich beobachten.
Doch weiches Eisen lässt sich durch Veredelung auch zu hartem Stahl machen. Dabei entdeckte als erster der deutsche Metallurgist Adolf Martens (1850-1914) in Stahl und Eisen charakteristische, feinskalige Strukturen, die mit bloßem Auge unsichtbar sind. Diese Strukturen treten bei Phasenübergängen auf. Er beobachtete, dass harte Stähle eine regelmäßige, geordnete Mikrostruktur aufweisen, während Eisen eine ungeordnete und viel komplexere Struktur besitzt. Auch heute noch ist die Frage, welche Legierungselemente und welche Prozessführung man bei der Stahlherstellung wählen soll, um ganz bestimmte Mikrostrukturen zu erzeugen, ein zentrales Thema in der Stahlforschung. Diese Strukturen entstehen durch Phasenübergänge; Martens zu Ehren nennt man diese Strukturen sowie die entsprechenden Phasenübergänge martensitisch.
Sowohl in Eisen aber auch in Formgedächtnislegierungen treten martensitische Phasenumwandlungen auf, und beide Materialklassen sind durch eine ähnliche kristallographische Struktur gekennzeichnet. Doch warum ist dann die Mikrostruktur in Eisen so viel schwächer ausgeprägt als in Formgedächtnislegierungen? Warum zeigt Eisen leicht plastisches Verhalten, aber keinen Formgedächtniseffekt? Warum sind umgekehrt die Umwandlungen in Formgedächtnislegierungen, anders als in Eisen, reversibel?
Forschern des Max-Planck Instituts für Mathematik in den Naturwissenschaften in Leipzig ist es gemeinsam mit Kollegen am California Institute of Technology und der Universität Padua gelungen, eine einfache Erklärung für diese Fragen zu finden. Die Grundidee lässt sich dabei leicht an einem Modell nachvollziehen, in Rahmen dessen man in Gedanken von einer Phase zu einer anderen und wieder zurück reist.
Gestartet wird sowohl für Eisen als auch für ein Formgedächtnismaterial bei hohen Temperaturen. Das Atomgitter sei jeweils quadratisch, die dritte Raumdimension ist der Einfachheit halber zu ignorieren. Bei Formgedächtnismaterialien tritt nun eine Symmetriereduktion ein. So kann seine Struktur sich in dem zweidimensionalen Beispiel von quadratisch zu rhombischen wandeln. Die Wahlmöglichkeit zwischen mehreren rhombischen Gittern führt zur Mikrostruktur. Erhitzt man das Formgedächtnismaterial in diesem Gedankenexperiment, wandelt sich das rhombische wieder in das ursprüngliche quadratische Gitter um – die Umwandlung ist reversibel.
Anders beim Eisen: Zwar wird auch hier bei hohen Temperaturen mit einem quadratischen Gitter gestartet. Bei Abkühlung wandelt sich es sich jedoch in ein hexagonales Gitter um – im Prinzip eine stärkere Scherung als bei Eisen. Das hexagonale Gitter besitzt nun aber eine andere, neue Symmetrie. Mehrere Zelle sind aufgrund dieser Symmetrie äquivalent zueinander. Wird das Material wieder erhitzt, kann es daher entweder zu dem Ausgangszustand zurückkehren oder zu einem neuen, ebenfalls quadratischen Zustand wechseln, wobei hier jedoch die Atome plötzlich um ein Atom gegeneinander verschoben sind.
Anders formuliert: Durchläuft das zweidimensionale Modell für Eisen einen Zyklus von zwei Phasenübergängen, so kann es auf dieser Reise eine plastische Verformung mitnehmen, da die Energiebarriere für die plastische Verformung nicht größer als die Barriere des Phasenübergangs selbst ist. Die Reise führt also nicht unbedingt zum Ausgangspunkt zurück. Die Transformation ist irreversibel.
Diese Überlegungen lassen sich mit mathematischen Methoden, die aus der Gruppentheorie stammen, auf eine dreidimensionale Situation übertragen. Auf diese Weise kann man zeigen, warum in einem Eisenkristall wegen der Vielfalt der möglichen Umwandlungspfade in der Tat beliebig große Verformungen entstehen. Dies führt zu plastischer Deformation und damit zu Irreversibilität. Diese mikroskopische Überlegung kann durchaus makroskopische Verformungen erklären.
Abseits von Formgedächtnismaterialen und Eisen kann diese mathematische Erkenntnis auch anderweitig nützlich sein: So finden martensitische Phasenübergänge auch in Keramiken und Polymeren statt, und selbst in biologischen Systemen wie dem T4-Bakteriophagen, einem Virus, lassen sie sich beobachten.
© Max-Planck-Gesellschaft
Die Max-Planck-Gesellschaft (MPG) ist eine vorwiegend von Bund und Ländern finanzierte Einrichtung der Grundlagenforschung. Sie betreibt rund achtzig Max-Planck-Institute.


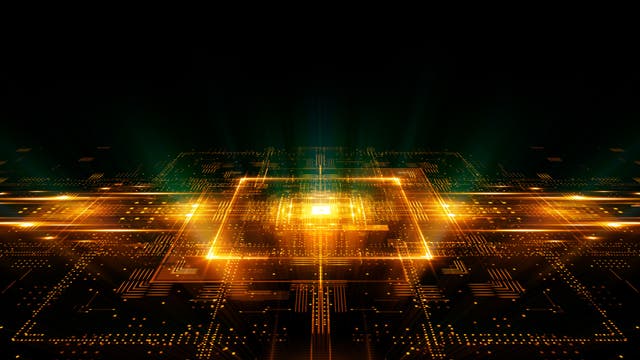

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.