News: Wie der Mensch auf die Stunde kam
Wie die Uhr vom späten Mittelalter an unser Leben bestimmte, wie die Teilung des Tages in 24 gleich lange Stunden erfunden wurde und welche Folgen dies für den Lauf der Geschichte hatte, das erforscht der Chemnitzer Historiker Prof. Gerhard Dohrn-van Rossum seit Jahren.
Für die Menschen früherer Epochen spielte die Zeitmessung keine Rolle – sie standen auf, wenn es hell wurde und gingen bei Dunkelheit zu Bett. Immerhin gab es schon eine künstliche Beleuchtung, etwa in Form von Kienspänen, Öllampen oder Kerzen, aber die waren für den normalen Bürger ohnehin zu teuer. Die Arbeit wurde meist nach Tagen bezahlt. Zwar konnten auch schon die alten Griechen und Römer die Zeit messen: Sie benutzten dazu Sonnen- oder Wasseruhren. Die aber waren schwierig zu bauen, noch schwieriger zu regulieren. Deshalb waren sie recht ungenau und hatten besonders in Mitteleuropa ihre Nachteile.
Auch die Einteilung des Tages in zweimal zwölf Stunden war schon in der Antike bekannt. Dazu wurden der Tag und die Nacht jeweils in zwölf etwa gleich lange Abschnitte geteilt, was schon schwierig genug war. Die Nacht begann, wenn die Sonne unterging, der Tag bei ihrem Aufgang. Als Folge davon waren die Tag- und die Nachtstunden je nach Jahreszeit unterschiedlich lang. Dieser Effekt verstärkte sich noch, je weiter man nach Norden kam.
Für eine Menschengruppe allerdings war es wichtig, die genaue Zeit zu kennen: die mittelalterlichen Mönche, die ihre Gebetsstunden einhalten mußten. Tagsüber war das kein Problem, doch war auch ein Gebet um Mitternacht vorgeschrieben, und dieser Zeitpunkt war schwierig zu bestimmen. Zwar versuchten die Mönche, die antiken Wasseruhren zu verbessern, freilich mit mäßigem Erfolg. Also behalfen sie sich, etwa mit genau abgewogenen Kerzen, die außen Zeitmarkierungen oder auch Nägel trugen, die beim Abbrennen der Kerze mit einem Geräusch zu Boden fielen.
Doch die Lage änderte sich schlagartig gegen Ende des 13. Jahrhunderts. Wer genau die zündende Idee hatte, die letztendlich die Welt verändern sollte, verliert sich im Dunkel der Zeiten – vermutlich wurde sie in einem Kloster geboren, und ebenso vermutlich gleich mehrfach und unabhängig voneinander.
Die Grundprinzipien des mechanischen Uhrwerks waren schon in der Antike bekannt: Der Antrieb durch ein Gewicht an einem Seil, Zahnräder zur Übersetzung und ein Anzeigewerk, das beispielsweise einen Zeiger bewegen konnte. Solche Zeigerwerke hatte man auch schon mit Wasseruhren oder anderen Instrumenten verbunden. Mit einem Gewichtsantrieb über eine Welle konnte man zwar einen Mechanismus in Gang setzen, er hatte aber einen Nachteil – er ließ sich nicht regulieren. Einmal in Gang gesetzt, fällt das Gewicht immer schneller, der Bewegungsablauf läßt sich nicht mehr aufhalten.
Was fehlte, war mithin eine Vorrichtung, die solch eine Regulierung des Fallens des Gewichts ermöglicht, die Uhrwerkhemmung. Dabei ist auf der Welle mit dem Gewicht ein Zahnrad montiert, in das in regelmäßigen Abständen abwechselnd zwei auf einer Spindel angebrachte, rechtwinklig zueinander stehende Metallzungen, die Spindellappen, eingreifen. Die Spindel selbst, die in ihrer einfachsten Form oben einen Waagbalken mit zwei Regulierungsgewichten trägt, schwingt dabei hin und her. Der Zug des Gewichts verursacht immer dann, wenn einer der Spindellappen das Zahnrad freigibt, einen kurzen Vorwärtsruck: Das ist das Ticken der Uhr.
Diese Hemmung kann kaum hoch genug eingeschätzt werden. Sie muß zwischen 1271 und etwa 1300 erfunden worden sein. 1271 nämlich hatte der an der Pariser Universität lehrende Engländer Robertus Anglicus in einem Kommentar zu einem Astronomielehrbuch geschrieben: "Die Macher von Uhrwerken arbeiten an einem Mechanismus, der sich einmal am Tag dreht, aber sie haben es bisher noch nicht geschafft" – zu diesem Zeitpunkt existierte die Hemmung also noch nicht. Andererseits sind uns Berichte von Chronisten überliefert, die um 1300 solche Hemmungen bezeugen. Etwa ab 1330 werden dann auch die ersten Schlagwerke erwähnt.
Mit der Erfindung der Uhrwerkhemmung bricht ein neues Zeitalter an. Die Zeit wird in gleichmäßige Abschnitte eingeteilt, die "Stunde" im heute gebräuchlichen Sinne also gleich mit erfunden. In den folgenden hundert Jahren (so lange etwa dauerte es auch später bei der Dampfmaschine) breiten sich die mechanischen Uhrwerke in ganz Europa aus, zunächst in den reichen Klöstern, den großen Kathedralen, an den Herrscherhöfen.
Doch der Bau ist für die damaligen Verhältnisse extrem aufwendig, zudem verschleißen die aus Weicheisen hergestellten Zahnräder schnell und die Wartung ist teuer. In Bologna etwa murren die Bürger, als ihnen für den Uhrwerksbau eine Sondersteuer auferlegt wird. Dennoch schließen sich aus Prestigegründen die großen deutschen und französischen Städte an, bis 1400 folgen auch die kleineren.
Anfangs dienen die Uhrwerke meist nicht zur Zeitmessung, sie treiben vielmehr Glocken- und Figurenspiele an. Die Kirchen zum Beispiel wollen mit ihnen Neugierige anlocken, die die Mechanik und damit die Schöpfung bewundern sollen.
Die Folgen der Erfindung gehen freilich weit darüber hinaus: Galten die Europäer bisher als primitiv und zurückgeblieben, waren die islamischen Länder und China technisch am weitesten fortgeschritten, so geht der Vorsprung nun auf Europa über. Den Menschen wird plötzlich bewußt, was in den zwei, drei Jahrhunderten zuvor schon alles erfunden wurde, ohne daß sie es groß bemerkt hätten – die Windmühle etwa, das Zaumzeug oder die Sporen. Daß es die früher nicht gab, wußte man, weil sie bei den antiken Schriftstellern nicht erwähnt wurden. Das schafft ein Gefühl für den eigenen Wert. Damit wird plötzlich auch die Person des Erfinders, sein geistiges Eigentum, anerkannt – folglich nennt und bewahrt man auch seinen Namen. Mit anderen Worten: Man erfindet die Idee des Individuums.
Das ist neu, das hat es weder in anderen Kulturen noch vorher in Europa gegeben. In China, im Islam, im Frühmittelalter waren Erfinder noch namenlos. Allenfalls hieß es da "unter der Regierung des Kalifen Harun Ar Raschid", oder es wird der Name eines kaiserlichen Beamten genannt, der gar nicht der eigentliche Urheber war. Wer die Windmühle oder das Spinnrad erfand, beide seit etwa 1200 in Europa verbreitet – wir wissen es nicht. Der erste Brillenschleifer, nur hundert Jahre später, ist dagegen bekannt.
Mit der Anerkennung des Erfinders und der geistigen Leistung ändert sich auch die Einstellung gegenüber Innovationen. Galt noch im frühen Mittelalter alles Neue als schlecht, als des Teufels – schließlich kamen Uhren in der Bibel nicht vor – so setzte sich nun der Gedanke durch, daß, was neu ist, auch gut ist. Diese Haltung führt ab 1330 zu einem gewaltigen Innovationsschub – an allen Ecken und Enden wird plötzlich Neues erfunden. Die Menschen spürten: Es gibt so etwas wie den Fortschritt, wir können unsere eigenen Probleme lösen. Dieses Gefühl hielt bis in die Vorkriegszeit, ja bis zum Club of Rome an – der allgemeine Technikpessimismus ist, von Splittergruppen abgesehen, jüngeren Datums.
Mit der Zeit wandelten sich die Figuren- und Glockenspiele der Anfangsjahre immer mehr zu "richtigen" Uhren. Der öffentliche Stundenschlag von der Rathausuhr auf dem Marktplatz regelte jetzt das Leben. Damit bürgen sich auch feste Zeiten für allerlei Verrichtungen ein. Ratssitzungen beispielsweise konnten auf feste Stunden angesetzt werden, wer zu spät kam, mußte eine Geldstrafe zahlen. Vorher dauerten solche Sitzungen oft sehr lange und konnten dadurch die Existenz der Ratsherren, die oft Handwerker waren, gefährden. In den Schulen tauchen die ersten Stundenpläne auf, zu Ende des 14. Jahrhunderts gibt es in Hamburg die ersten Verordnungen über Beginn und Ende der Arbeit – das Wort "Arbeitszeit" hingegen erscheint erst nach 1800 in unserer Sprache. Damit gibt es auch erstmals so etwas wie Freizeit – die wird erst dadurch möglich, daß sich die Arbeitszeit messen läßt.
Zeiteinheit ist dabei immer die Stunde, allenfalls die Viertelstunde. Erst mit den Eisenbahnen gelangt um die Mitte des 19. Jahrhunderts auch die Minute ins Bewußtsein der Menschen. Die Sekunde muß sogar bis an den Rand des 20. Jahrhunderts warten, als die Zeitungen anfangen, über Sportereignisse zu berichten. Etwa ab 1880 sind auch "normale" Menschen, etwa der kleine Handwerker, nicht mehr auf öffentliche Uhren angewiesen: Uhren werden nicht mehr in Handarbeit, sondern als industrielles Massenprodukt hergestellt.
Sogar vor der Folter machte die neue Zeitrechnung nicht halt: Lagen nämlich keine Beweise, sondern lediglich Indizien vor, konnte ein Angeklagter nur nach einem Geständnis verurteilt werden. Dieses sollte durch die Folter erzwungen werden, die von sadistischen Richtern teilweise exzessiv angewandt wurde. Doch Bedenken dagegen gab es auch damals. Man löste sie zunächst, indem man je nach Schwere des Verbrechens verschiedene Grade der Folter einführte. Nun kam eine zeitliche Befristung hinzu, die meist mit einer Sanduhr kontrolliert wurde – freilich galt dies nicht für Hexenprozesse. Der mutmaßliche Täter durfte die Uhr aber nicht sehen, damit er das Ende nicht abschätzen konnte. Es ist verbürgt, daß Angeschuldigte damals ihre Richter fragten: "He! Wie lange läuft die Uhr noch?"
Diese Beispiele haben eines gemeinsam, so Prof. Dohrn-van Rossum: Sie ersetzen eine Sachdiskussion durch eine formale Diskussion. "Dadurch werden zwar die Probleme nicht lösbar, aber immerhin verhandelbar", so der Wissenschaftler. Inhaltlich könne man über manche Probleme nicht diskutieren, das sei aber möglich, wenn man sie in Zeitprobleme verwandle. Stundenpläne etwa klären nicht, welches Fach das wichtigere ist, sondern weisen statt dessen jedem Fach eine feste Zeitspanne zu. Ein Untersuchungsausschuß kann einen Sachverhalt zwar meist auch nicht aufhellen, er macht aber deutlich: Wir nehmen uns Zeit für ein Problem. Mit Hilfe der Zeit und ihrer Messung lernen die Europäer seit dem Spätmittelalter, wie man organisiert – andere Kulturen haben ein solches Zeitgefühl nicht entwickelt.


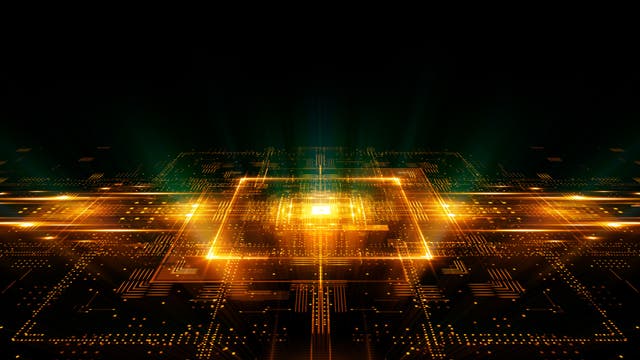
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.