Grusliges Thema
Keine Angst mehr haben, danach sehnen sich viele. Allein in den USA leiden rund 40 Millionen Menschen an einer Angststörung, sei es eine posttraumatische Belastungsstörung, eine Phobie oder eine Panikstörung. Konfrontationstherapien helfen rund 70 Prozent der Betroffenen.
Um Angststörungen in Zukunft noch effektiver behandeln zu können, müsse man die Mechanismen von Angst und Furcht besser verstehen, meint Joseph LeDoux, renommierter Neurowissenschaftler und Professor an der New York University. Doch deren Erforschung befinde sich in einer Sackgasse, da Wissenschaftler die Begriffe uneinheitlich verwendeten. Die einen meinten die körperliche Reaktion auf eine bedrohliche Situation, die anderen das Gefühl, das Menschen in solchen Momenten überkomme. Diese Uneinigkeit sorge für Verwirrung und Missverständnisse unter den Experten.
Angst haben, ohne sich zu fürchten
Empfinden wir Angst, ist der ganze Körper in Alarmbereitschaft. Die physiologischen Reaktionen, die oft mit dem Gefühl einhergehen, etwa hoher Puls und Schweißausbrüche, sind laut LeDoux überlebenswichtige Abwehrmechanismen. Auch richten wir unsere Aufmerksamkeit verstärkt auf die Bedrohung. Gehen wir zum Beispiel durch einen Wald und wissen, dass darin giftige Schlangen leben, achten wir besonders auf schmale, gebogene Objekte auf unserem Weg. Dieses veränderte Verhalten, so der Autor, sei aber nicht gleichzusetzen mit dem Empfinden von Angst (als einem eher diffusen Gefühl) oder Furcht (infolge einer konkreten, äußeren Bedrohung). Wir könnten auf Gefahren reagieren, ohne uns zu fürchten oder Angst zu haben.
Da es bei vielen Tieren bisher keine Belege für ein Bewusstsein gebe, schreibt LeDoux, stelle sich die Frage, ob diese bewusst Angst oder Furcht empfinden, nur weil sie in bedrohlichen Situationen ähnlich reagieren wie wir. Dennoch glaubt der Neurowissenschaftler, dass Tierversuche ihm und anderen Forschern dabei helfen können, die neuronalen Schaltkreise besser zu verstehen, welche die unbewussten, körperlichen Gefahrenreaktionen steuern. Tierstudien trügen so letztlich zu besseren Therapien gegen Angststörungen bei. Doch müsse man sich im Klaren darüber sein, dass man von Tieren nichts über menschlichen Furcht und Angst lernen könne.
LeDoux erläutert und hinterfragt verschiedene Theorien dazu, wie Angst entsteht und warum wir auf bedrohliche Reize so reagieren, wie wir es tun. Er hält Gedächtnis, Bewusstsein und Aufmerksamkeit hierbei für notwendig. Verstehe man Angst als bewusstes Gefühl, sei die Amygdala kein "Furchtzentrum". Um dieses Gefühl und die damit einhergehenden Reaktionen zu wecken, seien dann nämlich weitaus mehr Hirnareale nötig, darunter der Thalamus und der Hippocampus. Den an Angstempfindungen beteiligten Schaltkreisen des Gehirns widmet sich der Neurowissenschaftler sehr ausführlich.
Erschöpfende Darstellung
Auf mehr als 500 Seiten erläutert LeDoux umfassend, was Forscher über die Entstehung von Angst wissen. Wegen der zahlreichen Abbildungen, Tabellen und des streckenweise sehr nüchternen Sprachstils erinnert das Werk vielfach an ein Lehrbuch. Gelegentlich fehlt der rote Faden, so dass es manchmal schwerfällt, den Gedankengängen des Autors zu folgen.
Mit seinem Buch appelliert LeDoux für eine klare wissenschaftliche Trennung der bewussten Gefühle Furcht und Angst von den körperlichen Reaktionen. Nur so könnten Forscher auf diesem Gebiet weiterkommen. Der Autor wünscht sich außerdem, dass die neuro- und verhaltenswissenschaftlichen Erkenntnisse stärker in die Therapien von Angststörungen einfließen, und liefert dafür konkrete Vorschläge. So könne bereits ein Nickerchen nach einer Konfrontationstherapie den therapeutischen Nutzen steigern. Leichter Lesestoff ist das Werk nicht – aber ergiebig für alle Interessierten, die es genau wissen wollen.
Als kleinen und etwas seltsamen Bonus kann man sich als Leser(in) kostenlos das Album "Anxious" herunterladen. Der Hirnforscher versucht sich hier als Musiker.





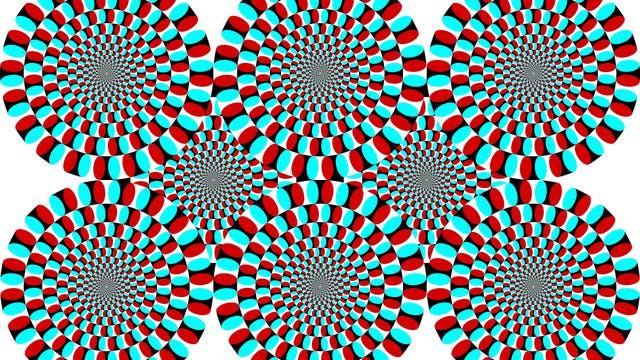
Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben