Kein Einblick in die soziale Neurowissenschaft
In seinem neuen Buch "Das (un)soziale Gehirn" widmet sich der Psychiater Manfred Spitzer neuen Erkenntnissen aus der Psychologie und Hirnforschung. Wie schon bei seinen Vorgängerwerken "Ketchup und das kollektive Unbewusste" oder "Nichtstun, Flirten, Küssen" erschienen die einzelnen Beiträge ursprünglich in der Zeitschrift "Nervenheilkunde", deren psychiatrischen Teil Spitzer herausgibt. Sie richten sich daher eher an ein Fachpublikum, sind aber weit gehend auch für interessierte Laien verständlich.
"Das (un)soziale Gehirn" soll Einblicke in die Wissenschaft hinter unserem täglichen Miteinander liefern. Schon im Vorwort weist der Autor jedoch darauf hin, dass sich das Buch mit "Vermischtem und Versprengtem, aber immer Interessantem" beschäftige. Tatsächlich liest sich Spitzers Werk eher als ein Allerlei aus Psychologie und Hirnforschung denn als "Soziale Neurowissenschaft für Einsteiger", wie auf dem Buchrücken angepriesen.
Die ersten Kapitel drehen sich noch um das menschliche Sozialverhalten. Spitzer erklärt dort anhand aktueller Studien, wie sich politische Einstellungen in unserem Gehirn widerspiegeln und dass jeder Mensch zu Korruption neigt. Zudem beleuchtet er, was in unseren Köpfen passiert, wenn wir mit anderen reden und ihnen zuhören, und welchen Stellenwert Imitation und Kreativität für unser soziales Miteinander haben. Auch soziale Netzwerke im Internet nimmt er ins Visier und kommt zu dem Schluss: Kinder und Jugendliche, die bei Facebook viele Freunde um sich scharen, hätten zunehmend weniger »echte« Freunde und seien insgesamt weniger glücklich.
An dieser Stelle beginnt Spitzer einen – so scheint es – persönlichen Feldzug gegen die digitalen Medien, der fast das halbe Buch beansprucht. Der Autor erklärt, warum das Internet zu mehr Dummheit und Kriminalität führe, Fernsehen schlecht für Kinder sei, "Killerspiele" unsere Kultur verdürben und E-Books und PCs in Schulen unnötig seien. Das Ganze gipfelt in einem Beitrag, der sich um das mediale Echo auf Spitzers Buch "Digitale Demenz" (2012) dreht und in dem der Autor klagt, er sei etwa in Fernsehsendungen absichtlich in ein schlechtes Licht gerückt worden.
Spitzers Kritik an Internet, Computerspielen & Co. mag im Rahmen einzelner Zeitschriftenartikel gut funktionieren. In dem Buch wirkt sie allerdings wegen der schieren Zahl der Beiträge redundant und darüber hinaus einseitig. Zudem führt sie den Leser immer weiter weg vom eigentlichen Thema.
Zwar erfährt man in "Das (un)soziale Gehirn" viel Wissenswertes in kurzweiliger Form. Doch auf dem ausufernden Nebenschauplatz der digitalen Medien verliert sich der rote Faden. Hätte der Autor darauf verzichtet, hätte es ein richtig gutes Buch werden können.


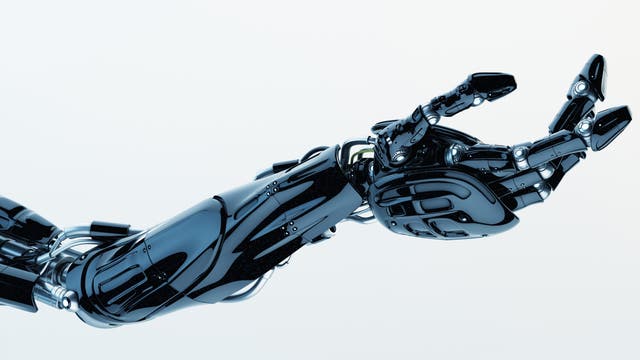
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.