Die Idee von Gott als Kulturleistung
Viele Menschen sind religiös, und viele Menschen haben beruflich mit Naturwissenschaft zu tun. Da bleibt es schon aus statistischen Gründen nicht aus, dass es viele Wissenschaftler gibt, die religiös sind. Die Frage ist, wie beides sich verträgt.
Eine verbreitete Antwort beruft sich darauf, dass die Wissenschaft vieles erklären kann, sogar immer mehr, aber niemals alles. Es gibt nun einmal Bereiche, die sich empirischem Faktensammeln und logischem Schließen entziehen, und dafür fühlt sich traditionell die Religion zuständig. Insbesondere sind moralische Werturteile nicht einfach aus bloßen Fakten abzuleiten. Allein aus der Tatsache, dass in einer Löwenherde das männliche Oberhaupt seine Machtstellung einschließlich des sexuellen Verfügungsrechts über alle weiblichen Mitglieder durch Gewaltanwendung oder Drohung mit derselben aufrechterhält, folgt noch nicht, dass ich diese natürliche Ordnung der Dinge in meiner eigenen Umgebung praktizieren soll.
Solche Fehlschlüsse vom Sein zum Sollen hat der schottische Philosoph David Hume (1711 – 1776) schon im 18. Jahrhundert kritisiert – doch von der Vorstellung, das Sollen werde dem Menschen durch übernatürliche Offenbarung mitgeteilt, hielt dieser skeptische Aufklärer noch viel weniger. Humes "Dialoge über natürliche Religion" waren für damalige Verhältnisse so gewagt, dass er sie zu Lebzeiten nicht publizierte, und die katholische Kirche setzte die postume Schrift auch prompt auf den Index der verbotenen Bücher.
Humes Sakrileg bestand darin, dass er religiöse Phänomene nicht als übernatürliche Erscheinungen betrachtete, sondern als etwas ganz Natürliches. Er fragte: Was bringt Menschen eigentlich auf die Idee, es gebe einen Schöpfer der Welt, der Gebete erhört, Wunder wirkt und Gebote offenbart? Und: Brauchen wir Religion, damit wir uns moralisch verhalten?
Diese Fragen stellt nun der US-amerikanische Philosoph Daniel Dennett erneut. Aktuellen Anlass bieten ihm die Attacken religiöser Gruppen gegen ihnen nicht genehme naturwissenschaftliche Resultate, insbesondere der Schulkampf von Anhängern des "Intelligent Design" gegen die Evolutionslehre. Aber Dennetts breit angelegte Untersuchung kann auch uns tolerante Europäer interessieren, die in der Religion des christlichen Abendlands kaum mehr den Gegner von Vernunft und Wissenschaft erblicken, sondern vielmehr einen Ursprung moralischer Gebote und herrlicher Kathedralen.
Dennett legt keine antireligiöse Streitschrift vor wie die Briten Richard Dawkins ("Der Gotteswahn", siehe Spektrum der Wissenschaft 11/2007, S. 118) und Christopher Hitchens ("Der Herr ist kein Hirte"). Er sucht den Dialog und präsentiert zu diesem Zweck Argumente, die jeder, ob religiös oder nicht, nachvollziehen kann. Eigentlich betreibt er das Handwerk eines vergleichenden Religionswissenschaftlers, angereichert um einen evolutionären Blick auf Kulturphänomene. Da Menschen von Anfang an in Gruppen (über-)lebten, waren sie auf Kooperation angewiesen. Andererseits ist jeder von Natur aus sich selbst der Nächste; darum braucht die Gruppe, um zu bestehen, starke Gründe für ihren Zusammenhalt. Wer nicht kooperiert, muss bestraft werden, Altruismus wird belohnt – auch wenn keiner zusieht? Allwissende Augen, selbst unsichtbar, die imaginär Strafe und Belohnung verteilen, garantieren stabile Gruppen.
Solche natürlichen Erklärungen für Gottesvorstellungen sind plausibel und müssen Gläubige nicht vor den Kopf stoßen. Denn die können achselzuckend sagen: Das mag so sein, aber ich glaube dennoch an einen Gott, der das Zusammenleben der Menschen entsprechend eingerichtet hat. Darauf würde Dennett – wie vor ihm Hume – erwidern: Das kannst du halten, wie du willst, aber frage dich, wozu dein Gott nötig ist. Was erklärt er?
So ist das ganze Buch gebaut. Dennett behandelt ein religiöses Argument nach dem anderen und verschmälert die Basis des Glaubens, bis nur noch ein Gott übrig bleibt, der sich restlos natürlich erklären lässt. Das wäre allerdings, wenn es ihn dennoch gäbe, ein recht perfider Gott, der sich in der Natur versteckt, um den Menschen die größtmögliche Anstrengung abzuverlangen – einen wirklich reinen Glauben, für den kein vernünftiger Grund spricht. Gegen einen solchen Glauben um jeden Preis gibt es freilich auch kein vernünftiges Argument mehr.
Dennetts Schrift ist stets anregend und unterhaltsam, oft sehr erhellend, gelegentlich weitschweifig, aber er arbeitet niemals mit unsauberen Tricks. Die verwundbarste Stelle seines langen Arguments für eine evolutionäre Religionstheorie ist wohl, dass Dennett den von Richard Dawkins geprägten Begriff des Mems aufgreift, um damit die ideelle Widerstandsfähigkeit von Religionen zu erklären. Das Mem als kulturelles Analogon zum biologischen Gen mag für naturwissenschaftlich Geschulte ein passables Sprungbrett ins Reich der Ideen und Ideologien sein. Es erfordert aber viel Überzeugungsarbeit – die Dennett in einem langen Anhang fleißig zu leisten versucht –, den Verdacht auszuräumen, das Mem sei mehr, nämlich eine biologistische Theorie der Kultur.
Ob Religion nun ein Mem ist oder nicht: Dennett beschreibt überzeugend, wie die Gottesidee als dem Menschen nützliche Kulturleistung entstand, sich verselbstständigte, sich dogmatisch gegen Kritik panzerte und nun auf unserer modernen Kultur aufsitzt wie ein Schmuck – oder ein Alb.
Eine verbreitete Antwort beruft sich darauf, dass die Wissenschaft vieles erklären kann, sogar immer mehr, aber niemals alles. Es gibt nun einmal Bereiche, die sich empirischem Faktensammeln und logischem Schließen entziehen, und dafür fühlt sich traditionell die Religion zuständig. Insbesondere sind moralische Werturteile nicht einfach aus bloßen Fakten abzuleiten. Allein aus der Tatsache, dass in einer Löwenherde das männliche Oberhaupt seine Machtstellung einschließlich des sexuellen Verfügungsrechts über alle weiblichen Mitglieder durch Gewaltanwendung oder Drohung mit derselben aufrechterhält, folgt noch nicht, dass ich diese natürliche Ordnung der Dinge in meiner eigenen Umgebung praktizieren soll.
Solche Fehlschlüsse vom Sein zum Sollen hat der schottische Philosoph David Hume (1711 – 1776) schon im 18. Jahrhundert kritisiert – doch von der Vorstellung, das Sollen werde dem Menschen durch übernatürliche Offenbarung mitgeteilt, hielt dieser skeptische Aufklärer noch viel weniger. Humes "Dialoge über natürliche Religion" waren für damalige Verhältnisse so gewagt, dass er sie zu Lebzeiten nicht publizierte, und die katholische Kirche setzte die postume Schrift auch prompt auf den Index der verbotenen Bücher.
Humes Sakrileg bestand darin, dass er religiöse Phänomene nicht als übernatürliche Erscheinungen betrachtete, sondern als etwas ganz Natürliches. Er fragte: Was bringt Menschen eigentlich auf die Idee, es gebe einen Schöpfer der Welt, der Gebete erhört, Wunder wirkt und Gebote offenbart? Und: Brauchen wir Religion, damit wir uns moralisch verhalten?
Diese Fragen stellt nun der US-amerikanische Philosoph Daniel Dennett erneut. Aktuellen Anlass bieten ihm die Attacken religiöser Gruppen gegen ihnen nicht genehme naturwissenschaftliche Resultate, insbesondere der Schulkampf von Anhängern des "Intelligent Design" gegen die Evolutionslehre. Aber Dennetts breit angelegte Untersuchung kann auch uns tolerante Europäer interessieren, die in der Religion des christlichen Abendlands kaum mehr den Gegner von Vernunft und Wissenschaft erblicken, sondern vielmehr einen Ursprung moralischer Gebote und herrlicher Kathedralen.
Dennett legt keine antireligiöse Streitschrift vor wie die Briten Richard Dawkins ("Der Gotteswahn", siehe Spektrum der Wissenschaft 11/2007, S. 118) und Christopher Hitchens ("Der Herr ist kein Hirte"). Er sucht den Dialog und präsentiert zu diesem Zweck Argumente, die jeder, ob religiös oder nicht, nachvollziehen kann. Eigentlich betreibt er das Handwerk eines vergleichenden Religionswissenschaftlers, angereichert um einen evolutionären Blick auf Kulturphänomene. Da Menschen von Anfang an in Gruppen (über-)lebten, waren sie auf Kooperation angewiesen. Andererseits ist jeder von Natur aus sich selbst der Nächste; darum braucht die Gruppe, um zu bestehen, starke Gründe für ihren Zusammenhalt. Wer nicht kooperiert, muss bestraft werden, Altruismus wird belohnt – auch wenn keiner zusieht? Allwissende Augen, selbst unsichtbar, die imaginär Strafe und Belohnung verteilen, garantieren stabile Gruppen.
Solche natürlichen Erklärungen für Gottesvorstellungen sind plausibel und müssen Gläubige nicht vor den Kopf stoßen. Denn die können achselzuckend sagen: Das mag so sein, aber ich glaube dennoch an einen Gott, der das Zusammenleben der Menschen entsprechend eingerichtet hat. Darauf würde Dennett – wie vor ihm Hume – erwidern: Das kannst du halten, wie du willst, aber frage dich, wozu dein Gott nötig ist. Was erklärt er?
So ist das ganze Buch gebaut. Dennett behandelt ein religiöses Argument nach dem anderen und verschmälert die Basis des Glaubens, bis nur noch ein Gott übrig bleibt, der sich restlos natürlich erklären lässt. Das wäre allerdings, wenn es ihn dennoch gäbe, ein recht perfider Gott, der sich in der Natur versteckt, um den Menschen die größtmögliche Anstrengung abzuverlangen – einen wirklich reinen Glauben, für den kein vernünftiger Grund spricht. Gegen einen solchen Glauben um jeden Preis gibt es freilich auch kein vernünftiges Argument mehr.
Dennetts Schrift ist stets anregend und unterhaltsam, oft sehr erhellend, gelegentlich weitschweifig, aber er arbeitet niemals mit unsauberen Tricks. Die verwundbarste Stelle seines langen Arguments für eine evolutionäre Religionstheorie ist wohl, dass Dennett den von Richard Dawkins geprägten Begriff des Mems aufgreift, um damit die ideelle Widerstandsfähigkeit von Religionen zu erklären. Das Mem als kulturelles Analogon zum biologischen Gen mag für naturwissenschaftlich Geschulte ein passables Sprungbrett ins Reich der Ideen und Ideologien sein. Es erfordert aber viel Überzeugungsarbeit – die Dennett in einem langen Anhang fleißig zu leisten versucht –, den Verdacht auszuräumen, das Mem sei mehr, nämlich eine biologistische Theorie der Kultur.
Ob Religion nun ein Mem ist oder nicht: Dennett beschreibt überzeugend, wie die Gottesidee als dem Menschen nützliche Kulturleistung entstand, sich verselbstständigte, sich dogmatisch gegen Kritik panzerte und nun auf unserer modernen Kultur aufsitzt wie ein Schmuck – oder ein Alb.

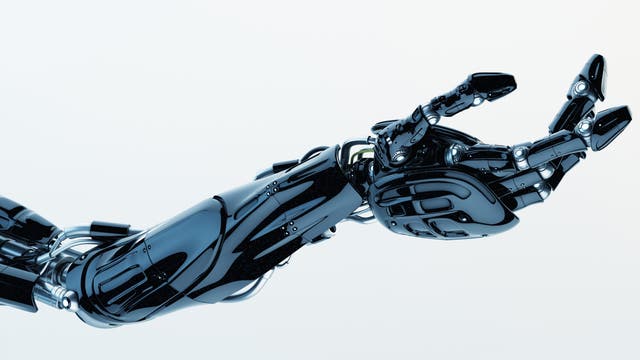

Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben