Springers Einwürfe: Energiewende in der Krise

Angesichts dramatisch steigender Kosten für fossile Energieträger dürfen sich jene Staaten glücklich schätzen, die nicht komplett auf deren Kauf angewiesen sind. Sei es, weil sie wie Frankreich seit dem Ölpreisschock der 1970er Jahre auf Kernenergie setzen, wie die USA ihre eigenen Quellen per Fracking erschließen – oder weil sie die Wende zu erneuerbaren Energien vollenden.
Letzteres, so fest es internationale Vereinbarungen versprechen, bleibt ein frommer Wunsch. Die Wende erfordert eine aufwändige Infrastruktur und ist komplizierter als der Einkauf scheinbar unbegrenzter fossiler Energie auf dem Weltmarkt.
Müsste nicht die aktuelle Kostenexplosion den Abschied von der Treibhauswirtschaft beschleunigen? Warum wird erst recht weiter auf Gasimport und Kohleförderung gesetzt?
Das hat ein internationales Team um den Energiepolitikexperten Jonas Meckling von der University of California in Berkeley zu beantworten versucht. Die Fachleute für Umwelt- und Politikwissenschaft geben zwei Gründe an, weshalb Staaten so unterschiedlich mit der Energiewende zurechtkommen.
Einen Faktor nennen sie englisch »insulation«, was mit Isolation zu grob übersetzt wäre. Gemeint ist eine gewisse Abschottung und Autonomie wichtiger Umweltinstitutionen gegenüber der Tagespolitik. So haben Japan und Frankreich schon auf die Ölkrise der 1970er Jahre mit der Errichtung mächtiger Bürokratien reagiert, was der jeweiligen Regierung relativ freie Hand in Energiefragen verschaffte. In den föderal verfassten USA hat Kalifornien seine Energiewende einer unabhängigen Regierungsbehörde übertragen und ragt seither aus den übrigen Bundesstaaten durch fortschrittliche Umweltpolitik heraus.
Effiziente, aber riskante Unabhängigkeit
Vor allem Schwellenländer profitieren von autonomen Entwicklungsbehörden. Ein Extremfall ist China, das beim massiven Ausbau von Solaranlagen und Windparks kaum Rücksicht auf lokale Einsprüche zu nehmen braucht. Eine totale Isolation der Politik ist freilich riskant. Das abschreckendste historische Beispiel einer Kampagne ohne informationelle Rückkopplung bietet Chinas »Großer Sprung nach vorne« um 1960. Er endete mit Millionen Hungertoten – nicht zuletzt, weil die niederen Parteikader, von der übrigen Bevölkerung ganz zu schweigen, sich scheuten, die sich abzeichnende Katastrophe nach oben zu melden.
Einen zweiten Faktor, der die Energiewende fördert, nennen die Autoren der Studie »Kompensation«: Unternehmen und Konsumenten brauchen Entschädigungen für die Kosten und Mühen, die der Wandel mit sich bringt. Das funktioniert dort am besten, wo Gewerkschaften und Unternehmerverbände längst gewohnt sind, Ausgleichszahlungen auszuhandeln, und wo vom Staat erwartet wird, soziale Härten abzufedern. Deshalb ist es nach dem Befund der Studie kein Zufall, dass die skandinavischen Länder sowie die Niederlande und Deutschland nicht nur Wohlfahrtsstaaten sind, sondern auch Vorreiter bei Maßnahmen gegen den Klimawandel.
Aus demselben Grund bilden die USA und Australien Schlusslichter beim Übergang zu erneuerbaren Energien. Ein schwacher staatlicher Sektor und dürre Sozialleistungen gehen einher mit stagnierendem Wandel.
Außerdem hapert es dort nicht nur mit der Kompensation, sondern auch mit der Autonomie der Umweltpolitik. Sobald eine neue Regierung vorsichtige Ansätze zur Energiewende ausprobiert, zertrampelt die nächste das zarte Pflänzchen gleich wieder.
Nach den Kriterien der zitierten Studie hat Deutschland vergleichsweise gute Chancen, die Energiewende zügig voranzutreiben – und ausgezeichnete Gründe sowieso.





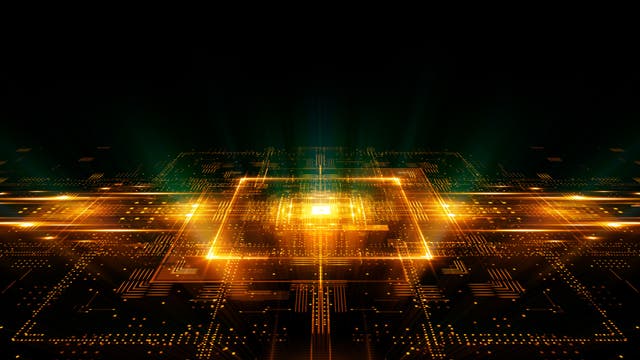
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.