Springers Einwürfe: Intime Verbindungen
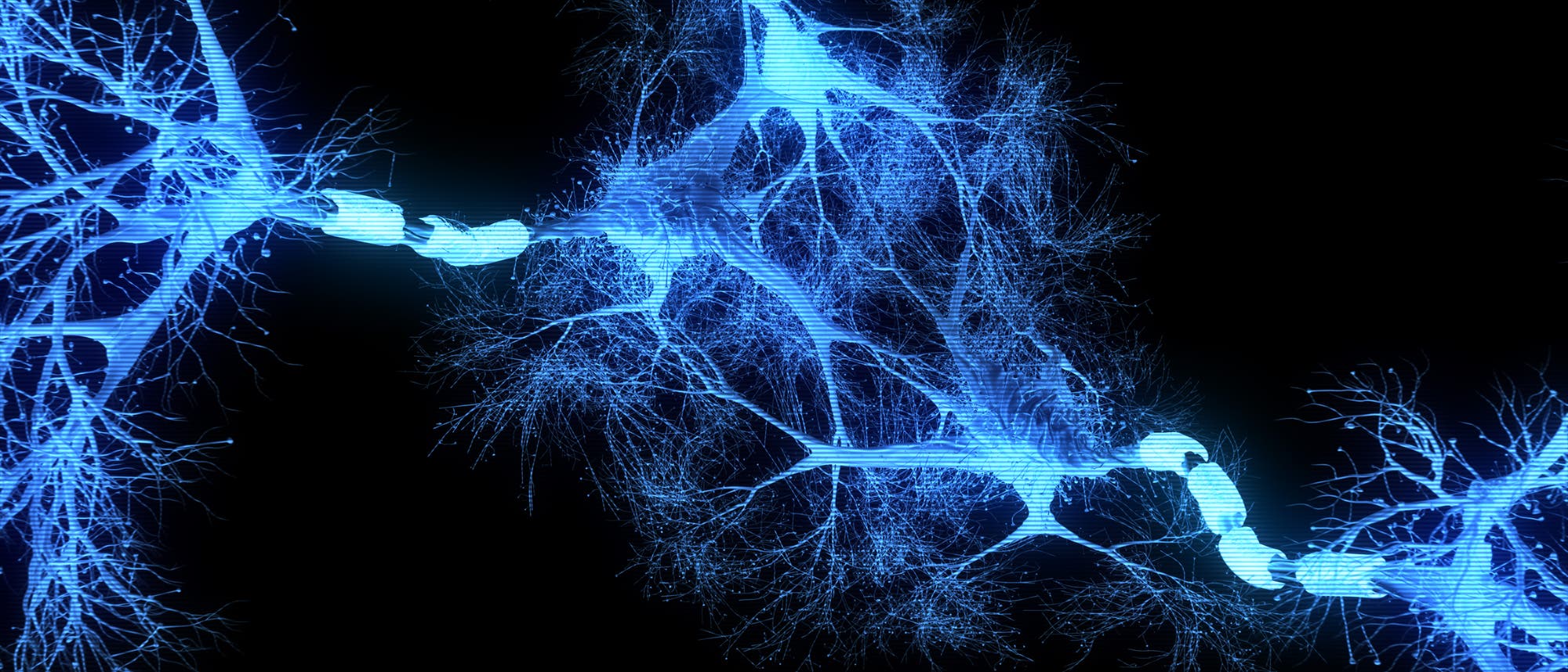
Der Heilige Gral der Neurowissenschaft ist die komplette Kartierung des menschlichen Gehirns – die getreue Abbildung des Gestrüpps der Nervenzellen mit den baumförmigen Verästelungen der aus ihnen sprießenden Dendriten und den viel längeren Axonen, welche oft der Signalübertragung von einem Sinnesorgan oder zu einer Muskelfaser dienen. Zum Gesamtbild gehören die winzigen Knötchen auf den Dendriten; dort sitzen die Synapsen. Das sind Kontakt- und Schaltstellen, lebhafte Verbindungen zu anderen Neuronen.
Dieses Dickicht bis zur Ebene einzelner Zellen zu durchforsten und es räumlich darzustellen, ist eine gigantische Aufgabe, die bis vor Kurzem utopisch anmuten musste. Neuerdings vermag der junge Forschungszweig der Konnektomik (von Englisch: connect für verbinden) das Zusammenspiel der Neurone immer besser zu verstehen. Das gelingt mit dem Einsatz dreidimensionaler Elektronenmikroskopie. Aus Dünnschichtaufnahmen von zerebralen Gewebeproben lassen sich plastische Bilder ganzer Zellverbände zusammensetzen.
Da frisches menschliches Hirngewebe nicht ohne Weiteres zugänglich ist – in der Regel nur nach chirurgischen Eingriffen an Epilepsiepatienten –, hält die Maus als Modellorganismus her. Die evolutionäre Verwandtschaft von Mensch und Nager macht die Wahl plausibel. Vor allem das Team um Moritz Helmstaedter am Max-Planck-Institut (MPI) für Hirnforschung in Frankfurt hat in den vergangenen Jahren Expertise bei der konnektomischen Analyse entwickelt.
Aber steckt in unserem Kopf bloß ein auf die tausendfache Neuronenanzahl aufgeblähtes Mäusehirn? Oder ist menschliches Nervengewebe vielleicht doch anders gestrickt? Zur Beantwortung dieser Frage unternahm die MPI-Gruppe einen detaillierten Vergleich von Maus, Makake und Mensch.
Menschliches Gewebe stammte diesmal nicht von Epileptikern, sondern von zwei wegen Hirntumoren operierten Patienten. Die Forscher wollten damit vermeiden, dass die oft jahrelange Behandlung mit Antiepileptika das Bild der synaptischen Verknüpfungen trübte. Sie verglichen die Proben mit denen eines Makaken und von fünf Mäusen.
Affengehirne sind eher mit sich selbst beschäftigt
Einerseits ergaben sich – einmal abgesehen von den ganz offensichtlichen quantitativen Unterschieden wie Hirngröße und Neuronenanzahl – recht gute Übereinstimmungen, die somit den Gebrauch von Tiermodellen rechtfertigen. Doch in einem Punkt erlebte das MPI-Team eine echte Überraschung.
Gewisse Nervenzellen, die so genannten Interneurone, zeichnen sich dadurch aus, dass sie ausschließlich mit anderen Nervenzellen interagieren. Solche »Zwischenneurone« mit meist kurzen Axonen sind nicht primär für das Verarbeiten externer Reize oder das Auslösen körperlicher Reaktionen zuständig; sie beschäftigen sich bloß mit der Verstärkung oder Dämpfung interner Signale.
Just dieser Neuronentyp ist nun bei Makaken und Menschen nicht nur mehr als doppelt so häufig wie bei Mäusen, sondern obendrein besonders intensiv untereinander verflochten. Die meisten Interneurone koppeln sich fast ausschließlich an ihresgleichen. Dadurch wirkt sich ihr konnektomisches Gewicht vergleichsweise zehnmal so stark aus.
Vermutlich ist eine derart mit sich selbst beschäftigte Signalverarbeitung die Vorbedingung für gesteigerte Hirnleistungen. Um einen Vergleich mit verhältnismäßig primitiver Technik zu wagen: Bei künstlichen neuronalen Netzen – Algorithmen nach dem Vorbild verknüpfter Nervenzellen – genügen schon ein, zwei so genannte verborgene Schichten von selbstbezüglichen Schaltstellen zwischen Input- und Output-Ebene, um die verblüffenden Erfolge der künstlichen Intelligenz hervorzubringen.


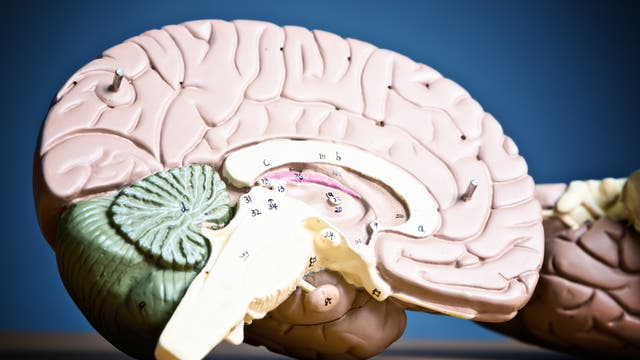



Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.