Springers Einwürfe: Schlechte Luft im trauten Heim

Eigentlich stehen wir in puncto Luftqualität gar nicht schlecht da. Wir hören vom Smog in fernen Millionenstädten Indiens und Chinas, aber vor der Haustür sollen uns ja demnächst Elektroautos von Abgasen verschonen. Nur selten heißt es, man möge wegen eines Chemieunfalls daheimbleiben und alle Fenster schließen. Falls draußen tatsächlich mal dicke Luft herrscht, erleben wir immerhin unsere Wohnung als das letzte ökologische Refugium, als sichere Burg inmitten einer global bedrohten Umwelt.
Aber längst nicht überall ist der Aufenthalt drinnen gesünder als draußen. Milliarden Menschen bereiten ein Leben lang ihre Nahrung über offenem Feuer in den eigenen vier Wänden zu und inhalieren unfreiwillig die aufsteigenden Verbrennungsrückstände. Alles in allem hat die Luft in Innenräumen nach Schätzung der Weltgesundheitsorganisation im Jahr 2020 mehr als drei Millionen Tote gefordert – fast noch einmal so viele wie die schlechte Luft im Freien.
Was tun gegen die hinterhältige Menschheitsgeißel? Zunächst einmal Daten sammeln, mahnt der Brite Christopher J. M. Whitty, als Chief Medical Officer for England so etwas wie der oberste Amtsarzt und Regierungsberater. Zusammen mit Alastair C. Lewis, Professor für Atmosphärenchemie an der University of York, und Deborah Jenkins, Beraterin am britischen Gesundheitsministerium, hat er ein Forschungsprogramm und mögliche Maßnahmen skizziert.
In wohlhabenden Ländern wie England oder Deutschland wird zwar kaum noch mit Kohle geheizt, aber dafür kam in den vergangenen Jahrzehnten Kaminholz in Mode – was die Belastung durch Feinstäube erhöhte. Auch kennt, wer einmal auf den Britischen Inseln weilte, die Gasöfen, die oft ein flackerndes Kaminfeuer imitieren und Stickoxide emittieren. Möbel setzen chemische Schadstoffe wie Formaldehyd frei, und das Radon im Baugrund strahlt radioaktiv. All die für sich genommen geringen Belastungen addieren sich mit der Zeit nennenswert. Für die Luftqualität drinnen gibt es keine verbindlichen Grenzwerte.
Die Gesundheit der Bewohner hängt stark von ihrem Einkommen ab. In halbwegs erschwinglichen, aber dafür überbelegten und tageslichtarmen Wohnungen macht sich gern Schimmel breit. Vor allem wenn man, um Heizkosten zu sparen, selten oder gar nicht lüftet. Nicht zuletzt stellen die Hausgenossen selbst ein Risiko dar: Rundum reichlich ausgeatmetes Kohlendioxid kann einem quasi die Luft nehmen, und die auf kurze Distanz aus Mund und Nase versprühten Aerosole übertragen Krankheitserreger.
Mit steigendem Wohlstand sinken die Belastungen. Der Einbau von Zentralheizungen mindert den Schimmelbefall, elektrische Herde erübrigen die Stickoxidemissionen von Gaskochern, und größere Wohnungen verringern das Ansteckungsrisiko.
So entpuppt sich das Ziel gesunden Wohnens letztlich als Geldfrage. Die Ratschläge der Wissenschaft stoßen auf einen knappen Immobilienmarkt, wo Vermieter angesichts satter Nachfrage von sich aus wenig Anreiz verspüren, in umweltfreundliche Umbauten zu investieren. Solche Initiativen muss die öffentliche Hand anstoßen – etwa nach dem Beispiel der energetischen Sanierung mittels Wärmedämmung, welche erst durch gesetzliche Auflagen und finanzielle Unterstützung in Gang kam.
Eine Sanierung der Innenräume wäre freilich viel komplizierter; sie müsste nicht nur den Wust diverser Daten bewältigen, sondern auch den spezifischen Widerstand überwinden, den Eingriffe in die Privatsphäre hervorrufen.
Vielleicht erweist sich hier die Digitalisierung als Deus ex Machina: So wie immer mehr Menschen mit smarten Uhren umherlaufen, die ihre Gesundheitsdaten speichern, könnten intelligente Sensoren diskret die Umwelt in Innenräumen überwachen.





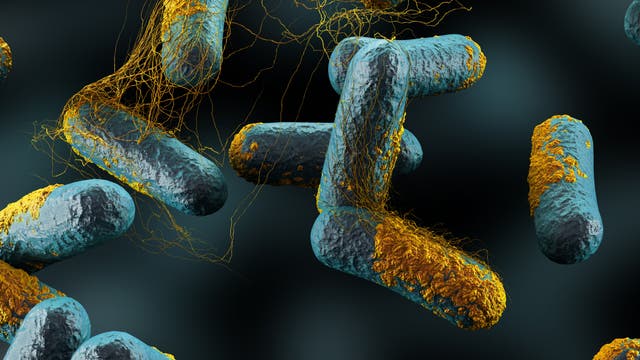
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.