Futur III: Nichts für ungut

Doomboy der Gute hielt eine Ansprache. Das kam nur alle heiligen Zeiten vor. Neugierig liefen wir zusammen und schauten zum Himmel empor, wo er in vollem Ornat die kurzen Arme ausbreitete und feierlich dröhnte. Auf den ersten Blick war schwer zu verstehen, wozu der Gute auf einmal das Wort ergriff, denn was er sagte, erschien ohnehin selbstverständlich und sonnenklar.
»Liebe Leute«, sprach Doomboy zärtlich, »der ewige Frieden war und ist unser oberstes Gebot. Erstens geht es uns gut, und zweitens soll es so bleiben – dafür stehe ich und kann nicht anders.«
In diesem Stil ging es weiter, und wir waren schon drauf und dran, dem himmlischen Zentralbildschirm unsere zackigen Rücken zu kehren, da wechselte Doomboy den Ton. Seine Stimme begann beschwörend zu gurgeln: »Wären da nicht die Unguten. Sie dräuen an unseren Grenzen und wollen unser Leben umkrempeln. Das ist ungut. Deshalb müssen wir gleich zu den Waffen greifen und uns zur Wehr setzen. Eilt alle in eure Höhlen und Hütten! Öffnet die alten Kisten und nehmt heraus, was drin ist! Die Klingen und Säbel, die Schwerter und Schilde, die Spieße und Schleudern! Bringt alles auf den Hauptplatz und sammelt euch in Reih und Glied! Dann wartet auf weitere Befehle!«
Wir standen noch ein Weilchen herum und fragten einander, ob wir uns Sorgen machen sollten; schließlich gingen wir nach Hause und kamen bis an die Zähne bewaffnet zurück. Alle stellten sich ordentlich auf, zwei Armlängen Abstand links und rechts, je eine Schwanzlänge vorne und hinten. Der Himmel brachte mitreißende Marschmusik, und wir röhrten feierliche Kriegslieder mit dem Refrain: »Alles für gut, nichts für ungut!«
Als die Zeit verging, die bunten Sonnen sanken und nichts weiter geschah, wandte ich mich an meinen Nachbarn. Das heißt, natürlich drehte ich ihm nicht den Kopf zu, das gehört sich nicht auf einem Exerzierplatz, sondern zischte aus meinem schiefen Schnauzenwinkel: »Wann geht es denn endlich los mit dem Krieg? Wie lange sollen wir noch so unnütz herumstehen?«
Mein Nachbar zischte zurück: »Schnauze!« Ich nahm augenblicklich stramme Haltung an und schämte mich. Nach einer langen Pause setzte er hinzu: »Ein Krieg besteht zu 99 Prozent aus Warten.« Begeistert nickte ich. Er hatte anscheinend Kampferfahrung, der alte Hase …
»Also mein junger Freund, so geht das nicht«, murmelte der Zensor, »Sie müssen sich schon entscheiden, wie Ihre Spezies aussehen soll. Sie verleihen den Akteuren Attribute von Schrecksauriern – und die sollen sich anerkennend mit Hasen vergleichen, mit vegetarischen Beutetieren? Abgesehen davon tritt Ihre Simulation buchstäblich auf der Stelle. Legen Sie einen Zahn zu, wenn ich bitten darf, höhö.« Der Zensor schmunzelte über sein albernes Wortspiel. Ich lachte pflichtschuldig, prüfte den Sitz der Sensorsaugnäpfe an meinem Kopf und schloss konzentriert die Augen …
Mein Nachbar auf dem Exerzierplatz hatte anscheinend Kampferfahrung; dafür sprach der Extrazahn, der seine Halskette zierte. Gerade als ich mich auf eine lange Nacht zwischen Halbschlaf und Habacht einstellte, unterbrach eine dringende Meldung das Potpourri aus patriotischen Wiegenliedern: »Achtung, Achtung, hier spricht Doomboy der Gute höchstpersönlich. Verzweifelt versucht der Feind zu uns vorzudringen, aber er wird an unserer heldenhaften Gegenwehr scheitern. Wir sind jetzt dabei, alle unguten Kräfte tief in deren eigenes Territorium zurückzutreiben, während es wenigen versprengten Feindhäufchen gelungen ist, ausnahmsweise unser Kernland zu streifen. Daher erkläre ich hiermit den lokalen Ausnahmezustand. Zu den Waffen! Der Feind steht vor den Toren!«
Kaum hatte Doomboy das verkündet, da strömte schon die gegnerische Armee auf den Exerzierplatz und nahm uns alle gefangen …
»Als ich sagte, Sie sollen einen Zahn zulegen, dachte ich nicht an einen Affenzahn«, schmunzelte der Zensor, ganz verliebt in seine Gebissmetaphorik. »Sie brauchen mir zwar nicht unbedingt Kampfhandlungen auszumalen, aber ein bisschen mehr über die Hintergründe des Konflikts sollten Sie in einer soziologischen Prüfungsarbeit schon andeuten …«
… und nahm uns alle gefangen. Der Feind sah eigentlich nicht anders aus als wir, bis auf die dunklere Pigmentierung des Trommelbauchs und die hässlichen gelben Rückenstreifen. Aber seine Zähne waren unansehnlich nach innen gekrümmt, während unserer Beißer prächtig vorstehen. Deshalb lispelte der mich vernehmende Offizier auch derart komisch, dass ich mir ein Glucksen kaum verkneifen konnte.
Erst wollte er Namen und Dienstgrad wissen, was ich unter Berufung auf das in der Nacht zuvor noch eilig ausgerufene Kriegsrecht natürlich strikt verweigerte. Dann lockerte er seinen Waffengürtel, bot mir eine Katzenpfote zum Knabbern an und spielte den Kumpel.
»Warum bekriegen wir uns eigentlich?«, flötete er, »Saurier sind wir doch alle. Für eure ekelhaften weißen Bäuche und langweiligen Rücken könnt ihr ja nichts, das ist nur eine Laune der Natur … Aber was wir euch echt übel nehmen«, aus seinem Rachen drang nun ein drohendes Knurren, »das ist euer grober Umgang mit den armen Warmblütern. Was haben sie euch nur getan, all die Kätzchen und Igel, die Frettchen und Marder, die Schweinchen und Biber, die Äffchen und so weiter?«
Das fand ich wirklich empörend. »Aha«, rief ich unklug, »um die Pelztiere geht es euch also! Die wollt ihr ganz allein nur für euch behalten. Wovon sollen wir uns denn bitte schön ernähren? Und wie unsere Blöße bedecken, wenn die Kälte unser Blut zu gefrieren droht?« Mühsam fasste ich mich und versuchte die Lage zu entspannen: »Und der Pelzmantel, auf dem Ihr sitzt? Hat der Bär den freiwillig ausgezogen und Euch überreicht?«
Der Vernehmer hielt sich mit der einen Kralle die Schnauze vor Lachen, während er mit der anderen strafend einmal fest auf meine empfindlichen Lippen schlug. »Du vergisst, in welcher Lage du dich befindest«, rasselte er streng. »Dein Krieg ist verloren, unser Tierschutz hat obsiegt. Alle Pelzwesen sind konfisziert und werden ausschließlich von uns verarbeitet. Häute und Knochen, Pansen und Schinken, Bries und Hirn, Brust und Keule sind ab sofort kontingentiert.« Er begann wieder freundlich zu lispeln. »Keine Angst, verhungern werdet ihr schon nicht, auch nicht erfrieren. Eure Arbeit ist uns wertvoll, euer Wohlergehen – in gewissen Grenzen – ein Anliegen. Und jetzt verschwinde!«
Ich überlegte. Irgendetwas an der Logik dieses Siegs schien mir zweifelhaft. Fest stand nur eines: Wir hatten den Krieg verloren – nicht nur militärisch, auch moralisch.
Draußen zeigte sich am rosigen Himmel ein riesengroßer Unguter mit einwärts gewachsenen Zähnen. Er hielt ein Kätzchen im Arm und streichelte mit der Kralle das zarte Fell, während er zu Harfen und Streichern ein Loblied auf den Tierschutz anstimmte. Auf dem Platz boten mehrere Verkaufsstände Käfige mit Hunden und Katzen an. Große Tafeln warnten: »Haustiere! Nicht zum Verzehr bestimmt!«
»So lala«, murmelte der Zensor. »Alles mit heißer Nadel gestrickt. Aber immerhin. Den Konflikt haben Sie soziologisch notdürftig motiviert mit dem unterschiedlichen Äußeren der Kontrahenten sowie mit dem einseitig instrumentalisierten Tierwohl. Eine glänzende Arbeit wird das nicht, für ein knappes ›Gut‹ sollte es jedoch reichen.«
»Mehr brauche ich gar nicht«, rief ich, schaltete den Zensursimulator ab und riss mir die Sensoren vom Kopf. Für die morgige Prüfung in theoretischer Konfliktgestaltung durfte ich mir ganz ordentliche Chancen ausrechnen.
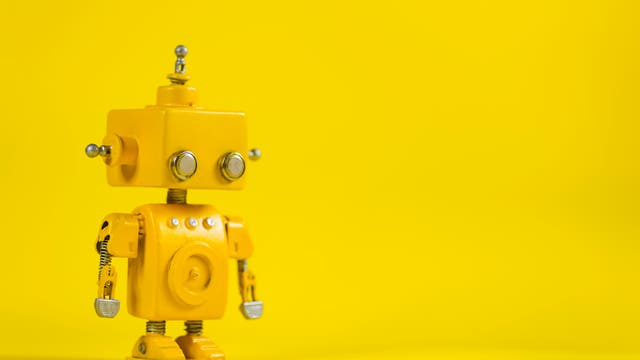



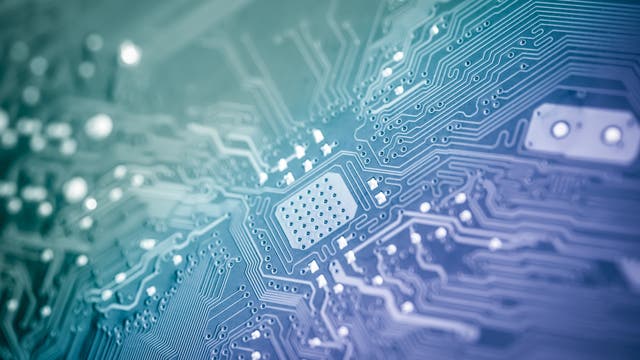


Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.