Metzler Lexikon Philosophie: Ich
In der antiken und ma. Philosophie wird dem Begriff des I. kein nur ihm eigentümlicher Bedeutungsgehalt zugeordnet. Ein philosophisch bedeutsamer Begriff des I. entwickelt sich erst im Zuge der Entstehung der neuzeitlichen Erkenntnistheorie und Metaphysik. – Bei Descartes bezeichnet das Pronomen »i.« eine in ontologischer Hinsicht von der Welt materieller Objekte (»res extensa«) grundsätzlich verschiedene, denkende immaterielle Ego-Substanz, die alleiniger Träger von Bewusstseinszuständen ist (»res cogitans«). In epistemischer Hinsicht zeichnet sich diese Ich-Substanz dadurch aus, dass sie zwar an den Inhalten ihres Wissens zweifeln kann, nicht jedoch daran, dass sie selbst es ist, die zweifelt. Im Denken des Zweifelns ist das I. unmittelbar seiner Existenz gewiss. – Bei Locke bezeichnet der Ich-Begriff das »bewußt denkende Wesen, gleichviel aus welcher Substanz es besteht (ob aus geistiger oder materieller, einfacher oder zusammengesetzter)« (Versuch über den menschlichen Verstand II, 27, 17). Locke fragt also nicht nach dem ontologischen Status des I.; stattdessen führt er den Begriff des I. als das in Zeit und Raum fortdauernde Identitätsbewusstsein der Person ein, ohne das deren Verantwortbarkeit für ihre Handlungen nicht zu denken ist. Für diese Identität ist weder der Begriff des Menschen als individuelle Substanz hinreichend noch der Begriff einer immateriellen Seelensubstanz notwendig. – Leibniz definiert den Ich-Begriff durch das Merkmal der Selbstreflexion (als Nachdenken über sich selbst), das das I. von allem anderen Beseelten unterscheidet. Die Selbstreflexion befähigt die vernünftige Seele zur theoretischen Einsicht. – Hume wendet sich gegen die Auffassung, dass das I. eine vom Körper abtrennbare selbstbewusste Seelensubstanz sei, die als exklusiver Träger von Bewusstseinszuständen in Frage kommt. Auf der Basis seines Empirismus macht die Rede von einem solchen I. keinen Sinn, da eine solche Seelensubstanz nicht Gegenstand der Erfahrung sein kann. Das I. ist nach Hume nichts als eine Summe von assoziativ zusammengefassten Gedankeninhalten. – Diese Kritik am Begriff einer immateriellen Ego-Substanz wird von Kant mit seiner Unterscheidung von empirischem und transzendentalem I. aufgegriffen und differenziert. Das empirische I. ist Gegenstand der Erfahrung nur, insofern es Objekt des inneren Sinnes ist. Dabei wird keine immaterielle Seelensubstanz erkannt, sondern nur eine Abfolge von Bewusstseinszuständen. Das empirische I. ist dadurch ebenso Erscheinung wie andere Gegenstände der Erfahrung. Wie das empirische I. ist auch das transzendentale I. keine Seelensubstanz. Ebenso wenig ist es aber eine Erscheinung und kann daher nicht erfahren werden. Mit dem Begriff des transzendentalen I. als dem »Ich denke«, das alle meine Vorstellungen begleiten können muss (KrV, B 132), drückt Kant die formale Bedingung der Einheitlichkeit aus, die für alle Erfahrung notwendig vorauszusetzen ist, und wodurch sie kategorial strukturiert und synthetisiert wird. Insofern das I. sich auf seine inneren Zustände erkennend bezieht, ist es Teil der Erscheinungswelt und deren Gesetzen unterworfen; insofern es sich jedoch als praktisches frei zum Handeln bestimmt, ist es intelligibel. – Fichte greift sowohl die kantische Vorstellung des Ich als die Einheitsbedingung des Denkens, als auch die seit Descartes bestehende Forderung, dass das Wissen eine unbezweifelbare Basis haben müsse, auf: Das I. der »Wissenschaftslehre« wird zum absoluten Prinzip des Wissens. Dieses I. ist weder eine Seelensubstanz noch ein individuelles I., sondern eine sich in allem Wissen ausdrückende spontane Aktivität, die sich im »Sich selbst Setzen« und im »Setzen« des Nicht-I. durch eine »Thathandlung« ihre eigene Wirklichkeit als Wissen von sich selbst und von ihren »Gegenständen« gibt. »Absolut« ist dieses Prinzip »I.«, weil es aus keinem höherem abgeleitet werden kann und weil es sich im Wissen gleichsam selbst organisiert. Das absolute I. ist nicht zu verwechseln mit dem Begriff des I. als empirisches, individuelles Selbstbewusstsein, der bei Fichte dem Begriff der Person entspricht.
Auch Husserl unterscheidet mehrere Ich-Begriffe: Zwar kommt jedem empirischen I. ein transzendentales zu; dennoch ist das reine I. nicht mit dem »I. als der realen Person, mit dem realen Subjekt des realen Menschen« (Ideen, Hua. Bd.IV, S. 104) zu verwechseln. Das reine I. stellt als die Bedingung der Möglichkeit von Bewusstseinsakten das diese Akte vollziehende identische Subjekt dar. Es steht mit der Welt in einer antithetischen Beziehung, bei der die Thesis des I. eine »notwendige« ist, insofern der Gedanke des Nichtseins der »leibhaft gegebenen Erlebnisse« des I. in sich widersprüchlich ist, während die Thesis der Welt eine »zufällige« ist, weil das »leibhaft gegebene Dingliche« (Ideen, Hua Bd.III.1, S. 98) sein oder nicht sein kann. In dieser antithetischen Beziehung zeigt sich das Wesensmerkmal der Gerichtetheit des I. auf Gegenständlichkeit, die sich in jedem Bewusstseinsakt ausdrückt: jedes cogito fordert ein cogitatum, Bewusstsein ist immer Bewusstsein von etwas. Neben der Intentionalität des I. ist die »Möglichkeit einer originären Selbsterfassung« (Ideen, Hua Bd.IV, S. 101) ein weiteres Wesensmerkmal des I.
Die sprachanalytische Philosophie (Sprachphilosophie, analytische) untersucht die mit dem Gebrauch des Pronomens »i.« einhergehende Funktion der Selbstreferenz des Sprechers sowie die damit verbundenen epistemischen Einstellungen, um u.a. auf diese Weise Anhaltspunkte für eine Klärung des Sachverhalts »Selbstbewusstsein« zu gewinnen. Nach Strawson ist nicht eine körperlose Ego-Substanz das ausgezeichnete Referenzobjekt des Ausdrucks »I.«, sondern der Sprecher, der mittels dieses Pronomens auf sich verweist. Folgt man Strawson, so ist die Idee einer reinen Ego-Substanz das Ergebnis einer Fehlinterpretation des Sachverhalts, dass die Selbstzuschreibung von Bewusstseinszuständen weder auf Beobachtung beruht noch hinsichtlich der »Identifikation« des Referenzobjektes fehlgehen kann. Diese beiden Besonderheiten im Gebrauch des Ausdrucks »i.« bei der Selbstzuschreibung mentaler Zustände berechtigen nicht dazu, auf eine distinkte Ego-Substanz zu schließen. Mit dem Pronomen »i.« wird also nicht identifiziert (wie etwa äußere Gegenstände identifiziert werden), sondern eine identifizierbare Person gemeint. – Shoemaker knüpft seine Überlegungen an die beiden genannten Besonderheiten des Gebrauchs von »i.« bei der Selbstzuschreibung mentaler Zustände an. Demnach ist die Verwendung des Pronomens »i.« bei dieser Art Selbstzuschreibung fundamentaler als bei seiner Verwendung in der Selbstzuschreibung von Prädikaten, die physische Sachverhalte ausdrücken, insofern diese auf der Möglichkeit nicht-perzeptiver Selbstreferenz beruht. Beide Verwendungsweisen sind spezifische Merkmale seines Gebrauchs als Referenzausdruck. – Castañeda schließt aus der epistemischen und referentiellen Besonderheit im Gebrauch von »i.« gegenüber anderen Indikatoren auf eine ontologische Priorität: Weder bei der Identifikation der Entität noch bei der Bestimmung der Klasse von Entitäten kann sein richtiger Gebrauch fehlschlagen. – Chisholm expliziert die Besonderheiten von »i.« nicht als Merkmale der Sprachverwendung, sondern als Merkmale von Referenz und Intentionalität. Demnach ist jeder intentionale Fremdbezug eines Subjekts als Relation Gegenstand einer propositionalen indirekten Attribution, während sich das Subjekt dieses »In-Beziehung-Stehen mit anderem« selbst direkt als Eigenschaft zuschreibt.
Literatur:
- P. Bieri (Hg.): Analytische Philosophie des Geistes. Königstein/Ts. 1981
- H.-N. Castañeda: Sprache und Erfahrung. Frankfurt 1982
- R. M. Chisholm: The First Person. Brighton (Suss.) 1981
- P. F. Strawson: Einzelding und logisches Subjekt. Stuttgart 1972.
RK

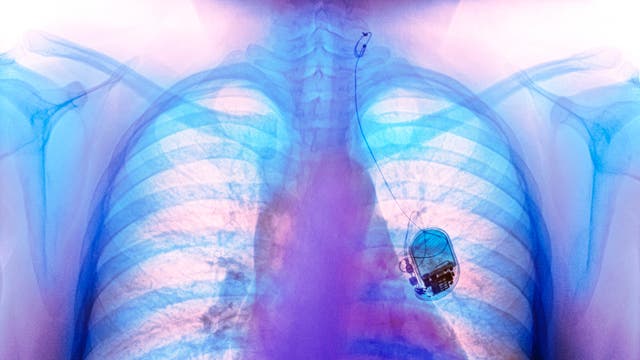





Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.