»Zuhören«: Zuhören allein reicht nicht
»Du hörst mir nicht zu!« ist ein beliebter Topos bei streitenden Paaren. »Hört uns endlich zu!«, skandieren zunehmend Bürger auf Demonstrationen, weil sie sich von Politikern nicht wahrgenommen fühlen und die Distanz der Politik zu den eigenen Sorgen beklagen. Aber wie hört man wirklich zu? Worin liegt die »Kunst, sich der Welt zu öffnen«, wie Medientheoretiker Bernhard Pörksen das Zuhören im Untertitel seines Buchs nennt?
Das Werk besteht aus drei sehr unterschiedlichen Teilen. Im ersten, ausgehend von eigenen Erfahrungen, entfaltet der Autor seine »Philosophie des Zuhörens«. Bei seinen Eltern stößt Pörksen auf die Autobiografie von Hartmut von Hentig. Der Reformpädagoge erzähle hier zwar ausführlich von Begegnungen mit Größen aus Literatur und Wissenschaft, aber nur »diffus und schwer fassbar« vom eigenen Lebenspartner Gerold Becker, dem langjährigen Direktor der Odenwaldschule. Becker ist laut dem unabhängigen Abschlussbericht zweier Juristinnen von 2010 als »Haupttäter« bei der sexuellen Ausbeutung von Schülerinnen und Schülern anzusehen.
Problematisches Weghören
Pörksen verstört das. Wie können Menschen so systematisch ignorieren? Wie kann es sein, dass niemand den hunderten betroffenen Jungen und Mädchen zugehört hat? Er erinnert sich an die eigene Schulzeit an einer Waldorfschule, wo ein Lehrer ihn und andere Mädchen und Jungen sadistisch peinigte. Wie er selbst mit dieser Erfahrung habe jeder eine Tiefengeschichte. »Wir hören, was wir fühlen […] und wir fühlen, was wir selbst erlebt und erfahren haben«, lautet seine zentrale These. Etwas wirklich zu hören, hieße, »etwas in veränderter Form erneut [zu] hören«. In der Dichotomie von »Ich-Ohr« und »Du-Ohr« bilde Letzteres die entscheidende Komponente. Echtes Zuhören entstehe, wenn man sich frage: »In welcher Welt ist das, was der andere sagt, plausibel, sinnvoll, wahr?« Man müsse genauer beobachten, anstatt vorschnell zu urteilen oder zu verallgemeinern.
Vier große Erzählungen bilden den Kern des zweiten Teils. Die erste ist der jahrzehntelang vertuschten Missbrauch an der Odenwaldschule und die Frage, unter welchen Bedingungen »wissende Ignoranz« in eine neue Wahrnehmung umschlägt, so dass ein Skandal öffentlich, also tatsächlich ›gehört‹ wird. Bereits 1999 veröffentlichte ein Journalist in der Frankfurter Rundschau einen Artikel über die Missbrauchsvorfälle an der Schule. Doch zehn Jahre lang passierte trotzdem nichts. Die Betroffenen wurden nicht gehört – weder von Entscheidungsträgern noch von der Öffentlichkeit. Die Vorgänge an der Odenwaldschule wurden, so der Autor, erst zur Affäre, nachdem Pater Mertes Missbräuche in der katholischen Kirche öffentlich gemacht und sich die Medienwelt mit dem Aufstieg und unter dem Druck der »sozialen Medien« verändert hatte. Pörksens weitere Beispiele sind der Krieg in der Ukraine, der zunehmend weniger Aufmerksamkeit bekommt, die Entstehung der Utopien im Silicon Valley und schließlich die »unbequemen Wahrheiten der Klimakrise«.
Ein persönliches Buch
Basis dieser Erzählungen sind persönliche Begegnungen, Gespräche und die Reisen zu den Handelnden und Orten der Geschehnisse. So spricht der Autor etwa mit Margarita Kaufmann. Sie wurde 2007 neue Leiterin der Odenwaldschule und hat maßgeblich dazu beigetragen, dass der systematische sexuelle Missbrauch aufgeklärt wurde. Pörksen berichtet von lang gepflegten Freundschaften; bei manchen Passagen fühlt man sich wie in einem Roman: Hartmut von Hentig serviert formvollendet Tee; Stewart Brand, eine Kultfigur aus der »San Francisco Bay Area«, plaudert aus der Frühzeit des Computers, während er mit dem Autor übers Gelände flaniert; die Künstlerin Jenny Odell führt ihn durch einen Park und in das »Deep Listening« und »Nichtstun« ein. In diese Erzählungen eingeflochten sind theoretische Reflexionen über das Zuhören. Pörksen sucht hier nach Antworten auf die Frage: Wie höre ich richtig zu, wie öffne ich mich meinem Gegenüber?
Sie münden in ein Schlusskapitel, das von der »Politik des Zuhörens« handelt. Es analysiert eine Paradoxie unserer Zeit: Heutzutage ist jeder in der Lage, mit dem Smartphone sofort eigene Gedanken und Erlebnisse in die ganze Welt zu senden – aber niemand hört einem mehr wirklich zu. Pörksen erkennt hier drei Konfliktlinien: die Gleichzeitigkeit des Verschiedenen; die Tatsache, dass echtes Zuhören Zeit und Ruhe benötige, aber kommerziell eine »Programmierung der Ungeduld« dominiere; und drittens, dass es früher schwer gewesen sei zu sprechen, es dagegen heute schwer sei, gehört zu werden: »Alle sprechen, um gehört zu werden, fluten die öffentliche Welt mit immer neuen, immer anderen Stellungnahmen – bis am Ende kaum jemand noch zuhören mag.« Trotzdem ist es möglich, dass einzelne Ereignisse weltweite Wirkung zeitigen. Das illustriert er am Fall der Ermordung von George Floyd und der »Black Lives Matter«-Bewegung.
Zu guter Letzt warnt der Autor vor der »Furie der Abstraktion« und den Schubladen, in denen sie Menschen ganz schnell stecke, sowie vor den Folgen des »Empörungstribalismus«. Wirkliches Zuhören erfordere, gerade Nuancen wahrzunehmen. Dafür seien die Bedingungen in der großen Politik kaum gegeben. Wirkliches Zuhören sei gelebte Demokratie im Kleinen, bedeute Anerkennung und Akzeptanz von Verschiedenheit und die »Erfindung einer Welt, die überhaupt erst im Miteinander-Reden und Einander-Zuhören entsteht«.
Das Buch ist – in wissenschaftlichen Diskursen unüblich bis verpönt – ein äußerst persönliches Buch, das von zahlreichen privaten Erlebnissen handelt. Es ist leicht geschrieben und spannend zu lesen, aber in manchen Passagen nicht ganz frei von Plauderton. »Zuhören« ist letztlich eine Metonymie für die genaue Wahrnehmung der Welt. Diese aber erfordert tatsächlich alle Sinne – einschließlich des Ich-Ohrs und des Du-Ohrs.
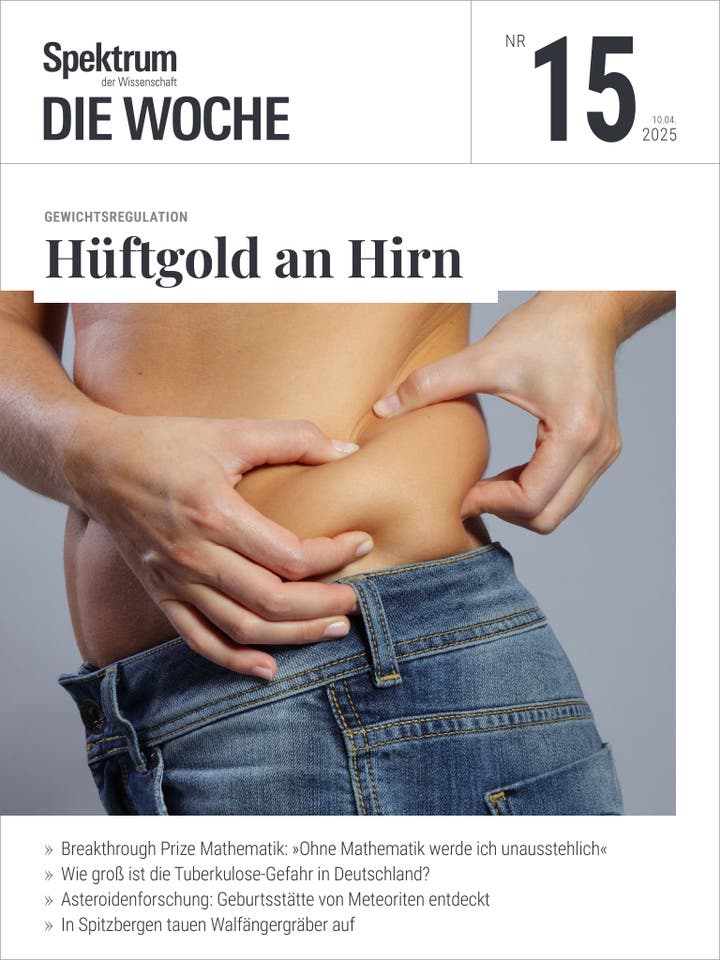
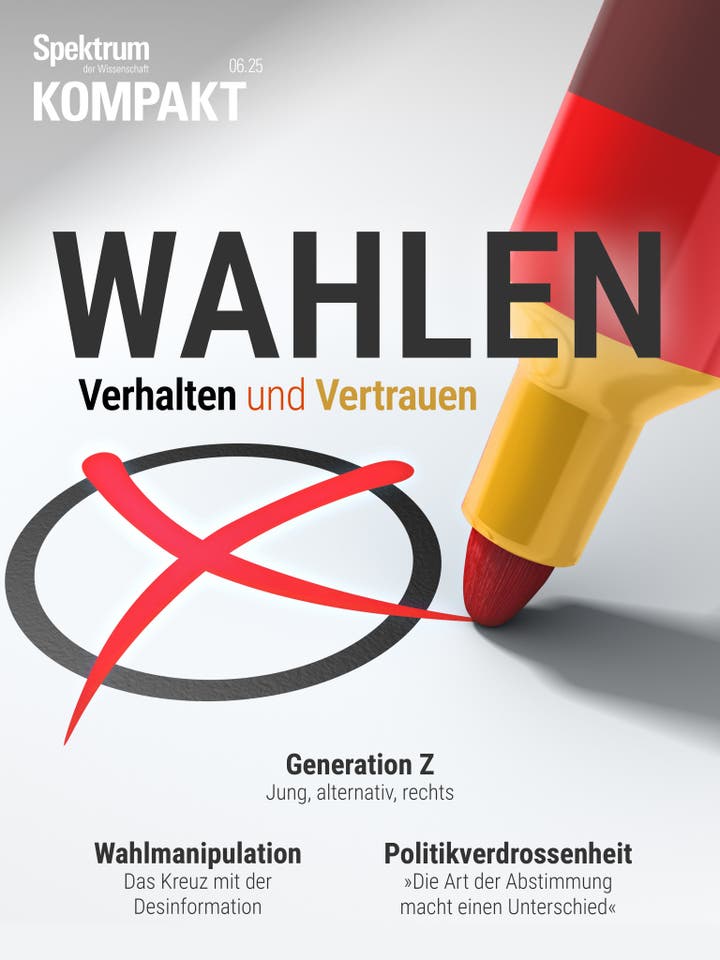
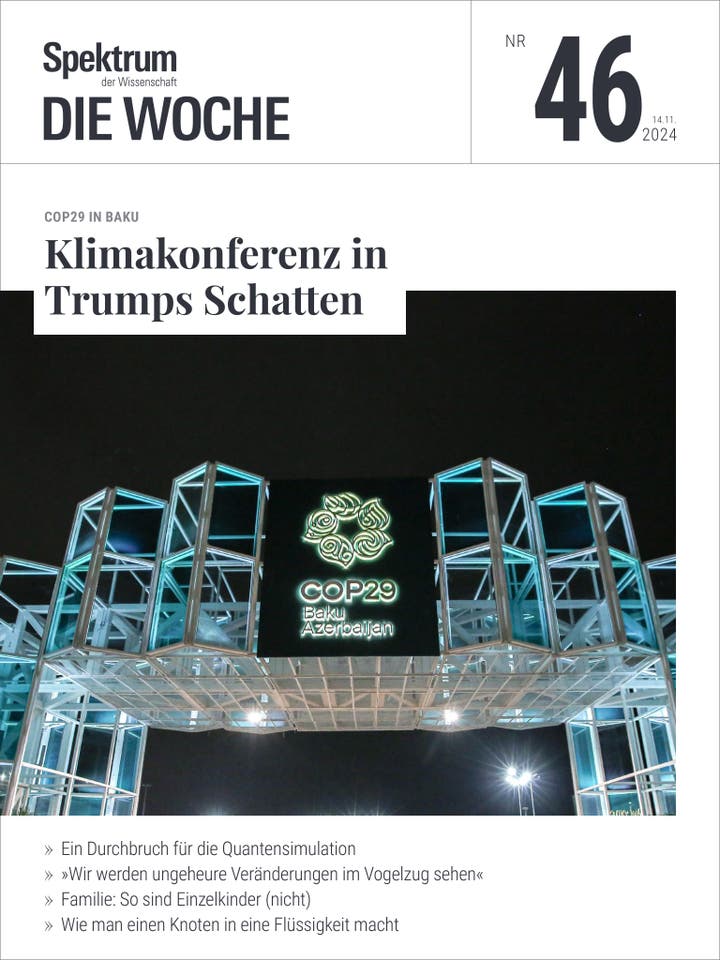


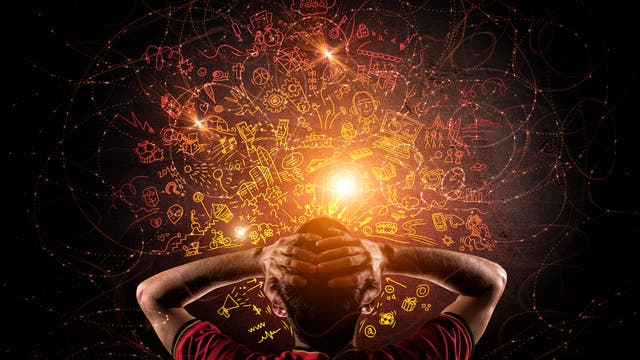
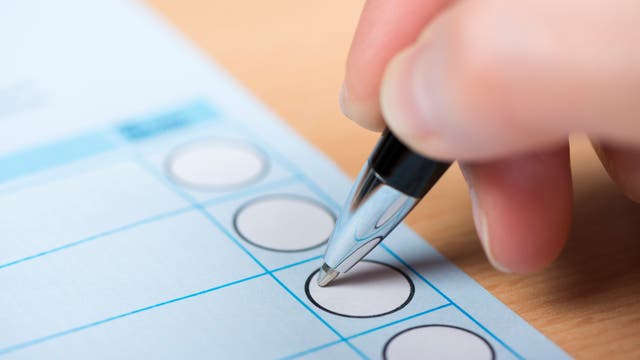


Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben