Brennstoffzellen: Wasserstoff für’s Handy
Unsichtbare, kleine Helfer sollten unsichtbar bleiben und sich auch sonst möglichst nicht bemerkbar machen. Das gilt insbesondere für die kleinen Stromlieferanten, ohne die es keine Handys, Laptops, Camcorder, Walkmen und all die anderen tragbaren Geräte gäbe. Doch Batterien, wiederaufladbar Akkus genannt, erfüllen diese Forderung oft nicht: Manche sind klotzig groß und schwer, allen ist die begrenzte Kapazität zu Eigen, und landen sie schließlich im Müll, stellen diese chemischen Kraftwerke ein nicht geringes Problem dar.
Vor 200 Jahren hat Alessandro Volta (1745–1827) sie an der Universität in Pavia (Italien) erfunden, inspiriert durch elektrophysiologische Experimente des Arztes Luigi Galvani (1737–1798). Die zu Grunde liegenden Mechanismen waren ihm noch unbekannt: Bei manchen chemischen Reaktionen werden Elektronen freigesetzt, die sich, sofern ein Elektrolyt die beiden Partner trennt, über einen angeschlossenen Stromkreis abziehen und nutzen lassen. Fachlich gesprochen oxidiert das Material, das die Ladungsträger abgibt, während das andere, das sie bei einem geschlossenen Stromkreislauf dann aufnimmt, reduziert wird.
Auch der englische Gelehrte Sir William Grove (1811–1896) verstand die Elektrochemie noch nicht im Detail, als er im Februar 1839 berichtete, Wasser elektrisch in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten und diese Reaktion dann als kalte Verbrennung umgekehrt zu haben. Der Basler Chemiker Christian Friedrich Schönbein (1799–1868) hatte diesen Effekt zwar schon im Monat zuvor ausführlich beschrieben, doch Grove war es, der drei Jahre später die ersten funktionsfähigen Brennstoffzellen baute.
Beide Energiequellen, Batterien und Brennstoffzellen, wandeln zwei Reaktionspartner in einer elektrochemischen Reaktion um, doch bei der Batterie verbleiben die Produkte, während die Brennstoffzelle sie bespielsweise als Wasserdampf entlässt. Zudem entnimmt sie einen der Reaktionspartner – den Sauerstoff – einfach aus der Luft, statt ihn zu speichern. Um einen Akku zu laden, legt man eine elektrische Spannung an und kehrt die Reaktion um, bis der Ausgangszustand wieder erreicht ist, und das kann Stunden dauern. Eine Brennstoffzelle wird schlicht frisch betankt.
Erst Mitte des 20. Jahrhunderts erreichten die Systeme einen Reifegrad, der sie trotz hoher Kosten für Militär und Raumfahrt interessant machte. In den letzten Jahren wurden erhebliche Mittel in die Entwicklung von Brennstoffzel-len als Energiequellen für Automobile sowie für dezentrale Blockheizkraftwerke gesteckt. Mittlerweile gibt es Prototypen, und die Markteinführung solcher Systeme dürfte nicht mehr lange auf sich warten lassen (Spektrum der Wissenschaft 7/1995, S. 88).
Der Gedanke liegt nahe, auch tragbare elektronische Geräte damit elektrisch zu versorgen. Die Technologien lassen sich aber nicht eins zu eins übertragen, denn der Leistungsbereich ist ein anderer: Ein Handy im Ruhemodus verbraucht gerade mal 20 Milliwatt, ein aktiver Laptop 20 Watt. Brennstoffzellen für Automobile sind auf das mehr als 4000fache optimiert. Entsprechende Techniken können aber nicht einfach auf die Anwendung in tragbaren Geräten sozusagen "herabskaliert" werden.
Für den Betrieb nahe der Raumtemperatur kommt vor allem die PEM-Brennstoffzelle in Frage. Namensgebend ist die Polymermembran, die als Elektrolyt fungiert. Sie vermag Protonen, also elektrisch positiv geladene Wasserstoff-Ionen, abzuleiten, weil sie negative Ionen-Gruppen enthält: Der Ladungsausgleich erlaubt den Protonen ihren Aufenthalt in der Membran. Dazu kommt noch ein geringer Wassergehalt, der die Wasserstoff-Ionen beweglich macht. Um die Reaktionspartner an Kathode und Anode voneinander zu trennen, muss dieser Kunststoff gasdicht sein. Eine hohe chemische Stabilität garantiert eine lange Gebrauchsdauer.
Die Elektroden sind poröse, gasdurchlässige Strukturen aus Graphitfasern oder -pulvern, die auf der Membranseite mit fein verteilten, nur Nanometer großen Platin-Partikeln beschichtet sind, an denen die elektrochemischen Reaktionen ablaufen.
Wasserstoff eignet sich für diese Anwendung besonders gut, denn von keinem anderen Brennstoff lassen sich bei Betriebstemperaturen von weniger als 50 Grad Celsius so leicht Elektronen abspalten. Das liegt natürlich am einfachen Aufbau des Wasserstoff-Moleküls aus nur je zwei Protonen und Elektronen. Dennoch erfordert selbst dessen Spaltung einen Katalysator, also einen Stoff, der die Reaktion sozusagen auf einen schnelleren Weg umleitet. Das Edelmetall Platin hat sich dafür besonders bewährt, schon Grove nutzte dieses Material.
Platin beschleunigt auchdie Reduktion des Sauerstoffs zu Wasser an der Kathode. Die ist deutlich komplexer, da bereits zehn Teilchen beteiligt sind: zwei Sauerstoffatome sowie jeweils vier Elektronen und Protonen. Um ein Wassermolekül zu bilden, müssen fünf davon zusammentreffen. Das geschieht auch auf einem hochaktiven Katalysator wie Platin nur langsam. Um dies auszugleichen, wird Energie aufgewendet, geht mithin für die Umwandlung in Elektrizität verloren. Diese Verluste wachsen mit dem Strom, der aus der Brennstoffzelle abgezogen wird, und die gelieferte elektrische Spannung sinkt im Gegenzug. Theoretisch kann eine Wasserstoff/Sauerstoff-Zelle 1,23 Volt liefern, wäre also beispielsweise einem Nickel/Metallhydrid-Akkumulator vergleichbar. In der Praxis verringern die Verluste diesen Wert je nach Strombelastung auf 0,6 bis 1,0 Volt. Im ersten Fall beträgt der Wirkungsgrad fünfzig Prozent, das heißt die Hälfte der im Brennstoff enthaltenen Energie wird verstromt.
Um eine Spannung von 3, 4, 6 oder 12 Volt zu erreichen, wie sie die diversen tragbaren Geräte erfordern, schalten die Entwickler einzelne Zellen hintereinander, sodass sich ihre Spannungen addieren. Dafür gibt es zwei Varianten. In Anlehnung an die leistungsoptimierten Brennstoffzellen für Automobile nutzen beispielsweise die Forscher des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE in Freiburg die so genannte bipolare Bauweise: Die positive Elektrode einer Zelle wird dort über eine elektrisch leitende, aber die Gase trennende flächige Verbindung – die Bipolarplatte – mit der negativen Elektrode der jeweils nächsten Zelle verbunden. So entsteht ein Stapel von Brennstoffzellen (englisch stack).
Diese Bauform ermöglicht großflächige Elektroden und damit einen geringen Innenwiderstand, also hohe Leistung der Gesamtanordnung, hat dafür aber einiges an Gewicht. Außerdem müssen die durch Bipolarplatten separierten Zellen einzeln mit Gas versorgt werden. Auf der Hannover-Messe präsentierte das ISE in diesem Jahr ein streichholzschachtel-großes Modul, das mit zehn Watt Leistung bei acht Volt ausreichend Strom für einen Camcorder liefern soll.
Sind die Zellen noch klein genug, kann Sauerstoff ohne Gebläse aus der Luft in die Kathode eindiffundieren und auch der Wasserdampf entweicht ohne Hilfsmittel. Problematisch ist es, Wasserstoff-Zuleitungen und Elektroden jeder Zelle gasdicht nach außen abzuschließen. Das Material der stromdurchflossenen Bipolarplatten darf sich in Kontakt mit der chemisch sauren Membran und dem Wasser oder Wasserdampf, der in den Zellen bei der Reaktion entsteht, zudem nicht zersetzen. Denn die Korrosionsprodukte könnten den Katalysator deaktivieren oder die Protonenleitfähigkeit der Membran beeinträchtigen. Rostfreier Stahl wäre deshalb der Baustoff der Wahl: Er ist billig und lässt sich durch Pressen und Stanzen in Platten mit weniger als einem Zehntel Millimeter Stärke bringen.
Einfacher als diese Bipolar-Bauweise ist meines Erachtens eine Reihenschaltung: Mehrere Zellen werden in einem Modul mit gemeinsamer Gasversorgung so verschaltet, dass jeweils die positive Elektrode der ei-nen "Einzelzelle" quer durch die Membran mit der negativen Elektrode der nächsten Zelle verbunden ist. Wasserstoff gelangt nun zu allen Einzelzellen gleichzeitig, und nur die komplette Anordnung ist abzudichten. Denn anders als bei der Verwendung von Bipolarplatten muss das Außengehäuse zudem keinen Strom leiten und kann somit aus leichtem Kunststoff bestehen.
Wasserstoff ist aber ein problematischer Brennstoff. Bei Raumtemperatur und normalem Umgebungsdruck gasförmig, wiegt ein Liter davon 0,089 Gramm. Theoretisch enthält diese Menge 2,9 Wattstunden Energie. Lässt sich die Hälfte davon wirklich nutzen, könnte eine Brennstoffzelle mit dieser Menge Wasserstoff eine Stunde lang bei einer Spannung von 1,5 Volt einen Strom von einem Ampere liefern; das entspricht einer Strommenge, die für 75 Stunden Stand-by-Betrieb eines Handys ausreicht. Wie aber wäre diese Menge Gas zu speichern?
Wo immer Wasserstoff in der Industrie benötigt wird, komprimiert man ihn durch hohen Druck von bis zu 300 bar. Dementsprechend stabil muss ein Tank gebaut sein, zwangsläufig wird er dabei schwer. Auch Ventile, die das Gas für den Gebrauch entspannen, haben ihr Gewicht. Den gleichen Effekt hat auch die Abkühlung auf minus 253 Grad Celsius: Der Wasserstoff wird flüssig. Doch die erforderliche Isolation macht auch diese Art der Speicherung im Wortsinne für die gewünschte Anwendung untragbar, darüber hinaus gibt es Verluste durch verdampfenden Wasserstoff.
Alternative Wege werden intensiv erforscht. Vielversprechend sind vor allem so genannte Metallhydride. Das sind bestimmte Metalle, die Wasserstoff vorübergehend in ihr Kristallgitter einbauen können, und zwar an Plätze, die zwischen den Metallatomen sitzen. Die Aufnahmekapazität ist begrenzt, derzeit liegt sie bei maximal zwei Prozent des Gesamtgewichts. Um den Speicher zu beladen, wird das Metall unter leichtem Druck dem Gas ausgesetzt, das dann eindiffundiert. Das Entladen erfolgt unter Wärmezufuhr und Normaldruck. Die genauen Werte lassen sich recht gut über die chemische Zusammensetzung des Metallhydrids einstellen, sodass keine Ventile notwendig sind. Es ist denkbar, dass ein Kunde im Elektrofachgeschäft einen leeren Metallhydrid-Speicher gegen einen vollen tauscht oder ihn zu Hause zum Aufladen an einen – momentan noch recht teuren – Elektrolyseur anschließt.
Mit einem solchen Tank erreichen die Entwickler zur Zeit Energiedichten von 0,2 Wattstunden pro Gramm Gesamtsystem. Das übertrifft bereits die Werte von Nickel-Metallhydrid-Batterien, schöpft das Potenzial dieser Technik aber noch nicht aus. Die Entwickler glauben, dass die Wasserstoff-Kapazität des Speichermediums fünf Prozent erreichen könnte.
Die Grundlagenforscher untersuchen einen anderen viel versprechenden Werkstoff: Kohlenstoffröhrchen mit nur einem Nanometer Durchmesser, so genannte Carbon Nano Tubes (CNT), könnten bis zu 15 Prozent ihres Gewichtes an Wasserstoff zu speichern. Damit würden Brennstoffzellen mit einer Energiedichte von über einer Wattstunde pro Gramm möglich, mehr als konventionelle Akkus erreichen. Ein so ausgerüstetes Handy könnte 80 Tage auf Stand-by stehen.
Eine solche neue Tanktechnologie würde den Durchbruch für Wasserstoff-Luft-Brennstoffzellen bedeuten. Noch ist es nicht so weit, deshalb werden alternativ dazu Systeme mit anderen Energieträgern wie Methanol untersucht. Dieses Molekül ist mit nur einem Kohlenstoff-, einem Sauerstoff- und vier Wasserstoffatomen der einfachste Alkohol (CH3OH). Man gewinnt es aus Erdgas, aber auch aus nachwachsenden Rohstoffen. Bei Raumtemperatur und normalem Umgebungsdruck ist Methanol flüssig und lässt sich ohne größeren Aufwand abfüllen und aufbewahren. Da es giftig ist, würde man vermutlich bereits gefüllte Tanks im Laden erwerben. Obwohl es komplexer als Wasserstoff (H2) ist, vermögen bekannte Katalysatoren das Molekül doch bei Temperaturen unter 50 Grad Celsius elektrochemisch zu oxidieren. Für die energiereicheren höherwertigen Alkohole wie Ethanol (C2H5OH) oder reinen Kohlenwasserstoffe wie Propan (C3H8) sind solche Katalysatoren derzeit nicht bekannt.
Die Schattenseite: Die Oxidation von Methanol verläuft wesentlich langsamer als die von Wasserstoff, deshalb lässt sich auf vergleichbaren Katalysatorflächen weniger Strom erzeugen. Wo in erster Linie Leistung zählt wie bei Automobilen, wird dieser Energieträger deshalb nicht direkt "verbrannt", sondern nur als leicht handhabbare Speicherform für Wasserstoff verwendet. Den gewinnt energieaufwendig eine Reformer genannte Komponente solcher Systeme. Bei tragbaren Geräten mit ihrem geringeren Leistungsbedarf lässt sich der Nachteil langsamerer Oxidation aber in Kauf nehmen. Immerhin: Theoretisch ist wieder eine Wattstunde pro Gramm Gesamtgewicht möglich.
Der Aufbau einer Direct Methanol Fuel Cell (DMFC) ist dem einer Wasserstoff-Luft-Brennstoffzelle sehr ähnlich. Als Elektrolyt kommt ebenfalls eine Protonen leitende Membran zum Einsatz, und an der Kathode wird wieder Sauerstoff der Luft zu Wasser reduziert. Der Unterschied zeigt sich an der Anode: Dort füllt man ein Gemisch aus Methanol (CH3OH) und Wasser (H2O) ein; bei der Oxidation entstehen Protonen (H+), Elektronen (e-) und Kohlendioxid (CO2) nach der Formel CH3OH + H2O —> 6 H+ + 6 e- + CO2. Die Elektrode ist wieder porös und enthält den Katalysator, muss aber nun von den Flüssigkeiten benetzbar und für Kohlendioxid durchlässig sein.
Eine solche Zelle liefert 0,4 bis 0,8 Volt, zur Erhöhung der Spannung werden einzelne DMFC-Zellen wieder seriell verschaltet. Nutzt man dabei erneut das eingangs geschilderte Prinzip, ergeben sich sehr dünne Brennstoffzellen. In einer amerikanischen Studie für Handys liegen sie an der Außenseite des Gehäuses, damit die Luftzufuhr zur Kathode gewährleistet ist. Ein 17 Kubikzentimeter großer Methanol/Wasser-Tank liefert 54 Wattstunden, von denen – vorsichtig angenommen – 30 Prozent verstromt werden. Ein solches Modul würde also zehnmal so viel Energie speichern wie eine Lithiumbatterie mit vergleichbarem Gewicht. Die Leistung dieses Prototyps – also die Energieabgabe pro Zeit – ist auf Grund der langsamen Methanol-Oxidation aber selbst für ein Handy im Sendemodus zu gering. Deshalb bauten die Entwickler einen Akkuein, den die Brennstoffzelle auflädt.
(Auch am Forschungszentrum Jülich arbeiten Wissenschaftler an der DMFC. Besondere Aufmerksamkeit widmeten sie in den letzten drei Jahren den Strömungsverhältnissen in der Zelle, schließlich fließen auf derselben Seite ein Methanol-Wassergemisch und Kohlendioxid. Derzeit erreichen die Forscher eine Leistung von 500 Watt und eine Leistungsdichte von 120 Watt pro Liter. Im Betrieb erwies sich die Zelle zudem als sehr robust. Die Redaktion)
Praktische Probleme machen bei allen DMFC-Projekten noch die Polymermembranen, denn sie sind etwas durchlässig für Methanol. Eine geringe Menge kann somit von der Anode zur Kathode diffundieren und dort mit Sauerstoff reagieren, ohne Strom zu produzieren. Dieser Cross over verbraucht Brennstoff; er entspricht der Selbstentladung konventioneller Batterien. Eine Möglichkeit, dies zu verhindern, wäre eine Barriere etwa in Form einer dünnen methanolundurchlässigen, aber Protonen leitenden Schicht auf der Anodenseite der Membran.
Der letzte Weg passt gut in das Konzept einer Massenproduktion solcher Systeme. Da Elektroden, Membran und Methanol-Diffusionssperre aus Schichten dünner als ein Zehntel Millimeter bestehen, und zum Teil auch noch strukturiert sind, könnten ähnliche Fertigungsmethoden wie in der Halbleiterindustrie zum Einsatz kommen.
Mehr Energie und schnelleres Nachladen – das sind theoretisch die Vorteile von Brennstoffzellen gegenüber Akkus. Vermutlich dürften noch einige Jahre vergehen, bis diese Probleme gelöst sind und Brennstoffzellen für tragbare Geräte in Massen gefertigt werden. Dann wird sich zeigen müssen, ob weiterentwickelte Batterien konkurrieren können. Das Rennen ist noch offen.
Aus: Spektrum der Wissenschaft 7 / 2001, Seite 48
© Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH



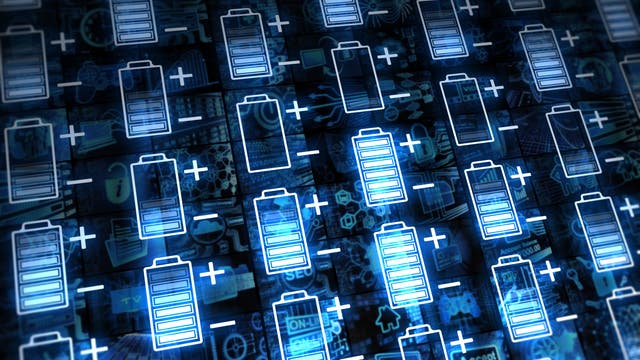


Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben