News: Anpassungsfähiger Nanostaub
Wenn Molekülklümpchen aus nur noch wenigen hundert Teilchen bestehen, kommen ansonsten zu vernachlässigende Randeffekte ganz groß raus. So bilden Nanokügelchen der Zinkblende in Methanol nicht mehr das gewohnte Kristallgitter, sondern eine unregelmäßigere Struktur. Mit Hilfe dieses Effektes könnten Robotersonden am Aufbau des Staubes vielleicht erkennen, ob es auf fremden Planeten Wasser gibt.

© Bild (Ausschnitt)
Klein und groß sind nicht immer gleich strukturiert. So stehen in Dörfern die Häuser oft entlang der einzigen Durchgangsstraße, in Kleinstädten um den zentralen Ortskern, während Großstädte einem übergeordneten Plan folgen. In Metropolen gibt es eben genug Straßen und Plätze, da muss man sich keine Gedanken um den guten Anschluss machen.
Ähnlich sorgenfrei können sich die Bausteine von großen Kristallen aneinanderlagern. Der überwiegende Anteil von ihnen ist rundum von Gleichartigen umgeben und fest in das Gitter eingebaut. Wie es draußen am Rand aussieht, erfahren nur die wenigsten, und Störungen begegnet man mit vereinten Kräften.
Das Bild ändert sich, wenn die Ansammlungen von Atomen oder Molekülen winzig klein werden. Im Bereich von wenigen Nanometern Durchmesser umfasst so ein Haufen nur einige Hundert Teilchen. Das Verhältnis von Oberfläche zu Volumen ist hier recht groß, "draußen" ist von jedem Platz aus gesehen sehr nah und die Anzahl interner Bindungen so gering, dass Angriffe des umgebenden Mediums ernsthaften Einfluss auf den ganzen Komplex haben könnten.
"Man hat festgestellt, dass Nanopartikel oft unerwartete Strukturen haben, und nahm an, es könnte an den Oberflächen-Effekten liegen", sagt der Physiker Benjamin Gilbert von der University of California in Berkeley. Zusammen mit einer Gruppe von Chemikern, Mineralogen und Physikern unter der Leitung von Jilian Banfield untersuchte er diese Vermutung genauer. Nach seiner Ansicht liefern die Ergebnisse "eine klare Demonstration dafür, dass Oberflächen-Effekte bei Nanopartikeln wichtig sind."
Am Beginn der Studie stand eine Simulation auf dem Computer. Wie verhielte sich Zinksulfid, das auch als Zinkblende bekannt ist, wenn es als Kügelchen von drei Nanometern Durchmesser verschiedenen Umgebungsmedien ausgesetzt wäre? Dem Modell zufolge, das die Dynamik der rund 700 Atome berechnete, sollte die kristallografische Welt in Wasser noch in Ordnung sein. Befände sich das Kügelchen jedoch in Methanol, käme es an den Randbereichen zu Störungen des Gitters, die sich bis tief in den Kristall fortsetzten. Entsprach diese Vorhersage dem tatsächlichen Verhalten des Zinkblendestaubs?
Zur Kontrolle stellten die Wissenschaftler die Nanopartikelchen im Labor her und untersuchten die Anordnung der Atome mit Röntgenstrukturanalysen. Tatsächlich war bei den Kügelchen, die in Methanol gelöst waren, nur der innerste Kern geordnet. Um ihn herum zeigten die Bilder starke Unregelmäßigkeiten. Wurde das Methanol mit Wasser versetzt, fand das Zinksulfid wieder mehr zu einer geordneten Struktur. Nur die äußersten Randbereiche blieben wirr.
Sollten diese Beobachtungen ausschließlich für Zinkblende zutreffen, wären sie keine große Aufmerksamkeit wert. Doch der Physikochemiker Hengzhong Zhang aus dem kalifornischen Team sagt: "Wir glauben, dass dieser strukturelle Übergang für einige Systeme kleiner Nanopartikel von vielleicht zwei bis drei Nanometern Durchmesser durchaus üblich sein könnte."
Womit es eine gute und eine schlechte Nachricht für Wissenschaftler gäbe. Positiv betrachtet, hätten sie die Möglichkeit, die Bauteile ihrer Nanotechnologie noch nach abgeschlossener Produktion zu verändern. Nur leider wären sie auch gezwungen, bereits vor dem Herstellungsprozess zu überlegen, unter welchen Bedingungen ihre Wunderwerke später eingesetzt werden sollen und wie sich dabei die Strukturen verhalten könnten.
Die Gedanken der Forscher aus Berkeley gehen aber noch weiter – nämlich bis in den freien Weltraum und auf ferne Planeten. An beiden Lokalitäten findet man hinreichend Staub für Experimente. Und da ein guter Teil davon im richtigen Größenmaßstab angesiedelt sein dürfte, so überlegen die Wissenschaftler, müssten sich aus der Struktur auch Aussagen über die Bedingungen am Herkunftsort machen lassen. "Nanopartikel sind möglicherweise weit verbreitet im Kosmos", sagt Banfield, "und die Umgebungen ihrer Oberflächen mögen sich deutlich unterscheiden, zum Beispiel in der An- oder Abwesenheit von Wasser oder organischen Molekülen." Ein automatisiertes Labor könnte mit spektroskopischen Verfahren selbst weit entfernt vom heimatlichen Institut eigenständig Proben vermessen und auswerten.
Vielleicht würde es sogar einen ersten Hinweis auf fremdes Leben liefern können, denn bestimmte sulfatreduzierende Bakterien produzieren durch ihre Stoffwechselvorgänge winzige Kügelchen von Eisensulfid, Eisenoxid oder sogar Uranoxid. Allerdings sollten in so einem Fall noch weitere gründliche Untersuchungen mit anderen Methoden folgen, bevor es einen weiteren Reinfall gibt, wie damals bei den "Mikroben" im Marsmeteoriten. Denn gerade bei den ganz kleinen Dingen sollte man vorsichtig sein – sie gehorchen eben ihren eigenen Gesetzen.
Ähnlich sorgenfrei können sich die Bausteine von großen Kristallen aneinanderlagern. Der überwiegende Anteil von ihnen ist rundum von Gleichartigen umgeben und fest in das Gitter eingebaut. Wie es draußen am Rand aussieht, erfahren nur die wenigsten, und Störungen begegnet man mit vereinten Kräften.
Das Bild ändert sich, wenn die Ansammlungen von Atomen oder Molekülen winzig klein werden. Im Bereich von wenigen Nanometern Durchmesser umfasst so ein Haufen nur einige Hundert Teilchen. Das Verhältnis von Oberfläche zu Volumen ist hier recht groß, "draußen" ist von jedem Platz aus gesehen sehr nah und die Anzahl interner Bindungen so gering, dass Angriffe des umgebenden Mediums ernsthaften Einfluss auf den ganzen Komplex haben könnten.
"Man hat festgestellt, dass Nanopartikel oft unerwartete Strukturen haben, und nahm an, es könnte an den Oberflächen-Effekten liegen", sagt der Physiker Benjamin Gilbert von der University of California in Berkeley. Zusammen mit einer Gruppe von Chemikern, Mineralogen und Physikern unter der Leitung von Jilian Banfield untersuchte er diese Vermutung genauer. Nach seiner Ansicht liefern die Ergebnisse "eine klare Demonstration dafür, dass Oberflächen-Effekte bei Nanopartikeln wichtig sind."
Am Beginn der Studie stand eine Simulation auf dem Computer. Wie verhielte sich Zinksulfid, das auch als Zinkblende bekannt ist, wenn es als Kügelchen von drei Nanometern Durchmesser verschiedenen Umgebungsmedien ausgesetzt wäre? Dem Modell zufolge, das die Dynamik der rund 700 Atome berechnete, sollte die kristallografische Welt in Wasser noch in Ordnung sein. Befände sich das Kügelchen jedoch in Methanol, käme es an den Randbereichen zu Störungen des Gitters, die sich bis tief in den Kristall fortsetzten. Entsprach diese Vorhersage dem tatsächlichen Verhalten des Zinkblendestaubs?
Zur Kontrolle stellten die Wissenschaftler die Nanopartikelchen im Labor her und untersuchten die Anordnung der Atome mit Röntgenstrukturanalysen. Tatsächlich war bei den Kügelchen, die in Methanol gelöst waren, nur der innerste Kern geordnet. Um ihn herum zeigten die Bilder starke Unregelmäßigkeiten. Wurde das Methanol mit Wasser versetzt, fand das Zinksulfid wieder mehr zu einer geordneten Struktur. Nur die äußersten Randbereiche blieben wirr.
Sollten diese Beobachtungen ausschließlich für Zinkblende zutreffen, wären sie keine große Aufmerksamkeit wert. Doch der Physikochemiker Hengzhong Zhang aus dem kalifornischen Team sagt: "Wir glauben, dass dieser strukturelle Übergang für einige Systeme kleiner Nanopartikel von vielleicht zwei bis drei Nanometern Durchmesser durchaus üblich sein könnte."
Womit es eine gute und eine schlechte Nachricht für Wissenschaftler gäbe. Positiv betrachtet, hätten sie die Möglichkeit, die Bauteile ihrer Nanotechnologie noch nach abgeschlossener Produktion zu verändern. Nur leider wären sie auch gezwungen, bereits vor dem Herstellungsprozess zu überlegen, unter welchen Bedingungen ihre Wunderwerke später eingesetzt werden sollen und wie sich dabei die Strukturen verhalten könnten.
Die Gedanken der Forscher aus Berkeley gehen aber noch weiter – nämlich bis in den freien Weltraum und auf ferne Planeten. An beiden Lokalitäten findet man hinreichend Staub für Experimente. Und da ein guter Teil davon im richtigen Größenmaßstab angesiedelt sein dürfte, so überlegen die Wissenschaftler, müssten sich aus der Struktur auch Aussagen über die Bedingungen am Herkunftsort machen lassen. "Nanopartikel sind möglicherweise weit verbreitet im Kosmos", sagt Banfield, "und die Umgebungen ihrer Oberflächen mögen sich deutlich unterscheiden, zum Beispiel in der An- oder Abwesenheit von Wasser oder organischen Molekülen." Ein automatisiertes Labor könnte mit spektroskopischen Verfahren selbst weit entfernt vom heimatlichen Institut eigenständig Proben vermessen und auswerten.
Vielleicht würde es sogar einen ersten Hinweis auf fremdes Leben liefern können, denn bestimmte sulfatreduzierende Bakterien produzieren durch ihre Stoffwechselvorgänge winzige Kügelchen von Eisensulfid, Eisenoxid oder sogar Uranoxid. Allerdings sollten in so einem Fall noch weitere gründliche Untersuchungen mit anderen Methoden folgen, bevor es einen weiteren Reinfall gibt, wie damals bei den "Mikroben" im Marsmeteoriten. Denn gerade bei den ganz kleinen Dingen sollte man vorsichtig sein – sie gehorchen eben ihren eigenen Gesetzen.
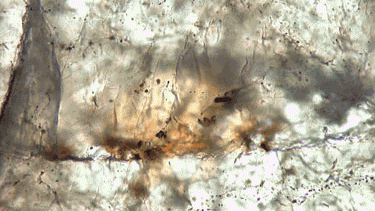




Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.