Immunsystem: Wenn Krebs ansteckend wird
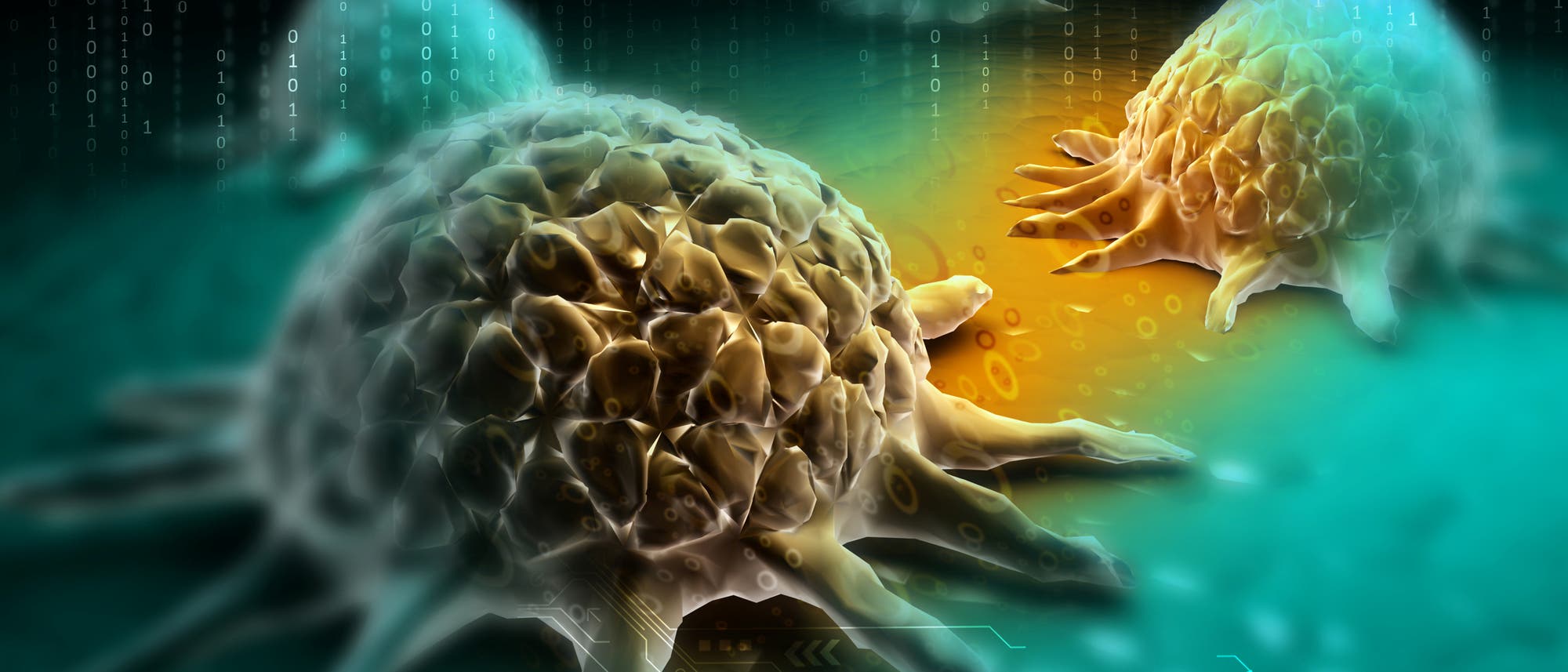
Die älteste bekannte Krebszelllinie überhaupt führt nach Sibirien und beginnt vor etwa 11 000 Jahren: Ein Hund, der einem Husky ähnelte, war der erste Betroffene. In dem Tier wuchs ein Tumor. Einer, dessen Krebszellen sich bis heute teilen. Denn der Krebs wanderte von einem Hund zum nächsten. Deshalb wissen Forscher heute erstaunlich genau, wie dieser Hund ausgesehen haben muss.
Dieser Krebs heißt CTVT (Canine transmissible veneral tumor) oder auch Sticker-Sarkom. Die Krankheit ist zwar weltweit verbreitet, befällt aber hauptsächlich streunende Hunde. Erstmalig beschrieben wurde sie 1876 von M. A. Novinsky. Zunächst wollte kaum jemand glauben, dass übertragene Krebszellen die an den Genitalien wachsenden Tumore auslösen. Viren standen lange Zeit auf der Liste möglicher Ursachen. Ausgerechnet ein Virologe, Claudio Murgia, bewies dann aber, dass die Krankheit nicht durch Viren ausgelöst wird. In seiner Doktorarbeit zeigte er 2004, dass alle untersuchten CTVT-Proben – egal ob aus Nairobi, Italien oder Indien – einen gemeinsamen Ursprung haben.
Zehn Jahre später entdeckt Elizabeth Murchison, wo genau dieser gemeinsame Ursprung liegt: in Sibirien. Die gebürtige Tasmanierin leitet eine Arbeitsgruppe am Institut für Veterinärmedizin der Universität von Cambridge, die übertragbare Krebsarten erforscht. Als sie mit dieser Arbeit anfing, waren nur zwei ansteckende Krebsarten in der Natur bekannt, nun sind es acht. Sie befallen Hunde, verschiedene Muschelarten und Tasmanische Teufel.
»Als ich meine Arbeit vor etwa zehn Jahren begann, wollte ich den Teufeln helfen«, erzählt Murchison bei einer Tasse Tee in ihrem kleinen Büro im zweiten Stock. An der gegenüberliegenden Wand hängt die Titelseite einer tasmanischen Zeitung vom 30. Dezember 2015. Ein dicker Schriftzug, alles großgeschrieben, kein Bild: »NEW CANCER HITS DEVILS – SCIENTISTS SHOCKED«. Seit den Neunzigern grassiert ein besonders aggressiver Gesichtskrebs unter den Tasmanischen Teufeln, dem bis zu 90 Prozent der Tiere bereits erlegen sind. Vor ein paar Jahren entdeckten Forscher auch noch eine zweite Form.
Was als Versuch begann, die Teufel vor dem Aussterben zu bewahren, wurde ein viel größeres Projekt. »Mit der Zeit wollte ich verstehen, wie Krebs überhaupt ansteckend werden kann«, sagt die Genetikerin. Und ob Krebs beim Menschen vielleicht auch ansteckend werden könnte. Murchison arbeitet gerade an ihrer Doktorarbeit in den USA, als die Forscherin Clare Rebbeck das Labor besucht und ihr von CTVT erzählt. Und davon, dass die Krankheit vermutlich durch einzelne Krebszellen verbreitet wird. Murchison ist fasziniert. Schließlich bleiben Tumorzellen normalerweise in dem Körper, in dem sie entstehen – auch wenn sie streuen. Wie waren sie in der Lage, in einen fremden Körper zu gelangen und dort weiter zu wachsen? Dazu müssten sie nicht nur die Körpergrenzen, sondern auch das Immunsystem des neuen Wirts überwinden. Sie brauchen also einen Übertragungsweg und eine Taktik.
Raffinierte Übertragung
Ersteres ist scheinbar leicht zu identifizieren. Der Tumor wächst bei den meisten Hunden an den Genitalien. Somit fangen sie sich die Krebszellen beim Geschlechtsverkehr mit einem infizierten Tier ein. Obwohl der Deckakt weniger als eine Minute dauert, können die Hunde durch anatomische Besonderheiten bis zu 30 Minuten später noch immer miteinander verbunden sein. Der Rüde hängt im wahrsten Sinne des Wortes in der Vagina der Hündin fest, bis sein Penis vollkommen abgeschwollen ist. Voreilige Trennungsversuche können zu Verletzungen führen. Eine Theorie ist, dass solche Verletzungen den Krebszellen helfen, in den Körper des nächsten Tiers zu wandern und sich dort festzusetzen. »Ich glaube aber nicht, dass es notwendig ist«, sagt Murchison, »denn manchmal findet man CTVT auch an anderen Körperstellen.«
Bei etwa fünf Prozent der Fälle tritt der Tumor beispielsweise in den Augen, im Mund, der Nase oder auf der Haut auf. »Das macht es dann so schwer zu diagnostizieren«, erzählt Murchison. Möglicherweise handelt es sich dabei um Metastasen eines primären CTVT-Tumors an den Genitalien. Möglicherweise haben sich diese Hunde die Krebszellen aber auch durch Lecken oder Schnüffeln an solchen Geschwüren eingefangen. In ein paar Fällen haben sich Welpen offenbar bei der Geburt mit CTVT infiziert. Sie tragen Tumore auf der Haut, die Muttertiere den typischen Genitaltumor.
»Mit der Zeit wollte ich verstehen, wie Krebs überhaupt erst ansteckend werden kann.«Elizabeth Murchison
Das Immunsystem des neuen Wirts überlisten die Krebszellen geschickt. Dieses sollte körperfremde Zellen eigentlich erkennen und bekämpfen, da ihnen die passenden MHC-Moleküle (Major histocompatibility complex, zu Deutsch: Haupthistokompatibilitätskomplex) fehlen. So gut wie alle Zellen eines Säugetiers bilden klassische MHC-Moleküle der Klasse I an ihrer Zelloberfläche. Davon gibt es beim Menschen drei Typen und insgesamt über 9000 Versionen. Jeder Mensch besitzt sechs Gene dafür, jeweils zwei von jedem Typ. Die Zellen eines Menschen tragen somit eine individuelle Kombination an MHC-Molekülen. Damit weisen sie sich gegenüber den T-Zellen des Immunsystems als legitime Bewohner eines Körpers aus.
Der ansteckende Krebs überlistet das Immunsystem
Zellen, die einen anderen Ausweis zeigen, da sie eine andere Kombination dieser MHC-Moleküle bilden, werden von den umherpatrouillierenden T-Zellen als Fremdlinge erkannt und attackiert. Das passiert beispielsweise auch mit einem fremden Organ: Passen die MHC-Moleküle von Spender und Empfänger nicht überein, wird das Organ als fremd erkannt und abgestoßen. Da die MHC-Moleküle von zwei Menschen so gut wie nie vollständig übereinstimmen, müssen Transplantatempfänger ihr Leben lang Medikamente nehmen, die das Immunsystem unterdrücken, damit ihr Körper das fremde Organ nicht bekämpft.
CTVT versteckt sich vor den T-Zellen seines Wirts, indem es seinen Ausweis erst gar nicht vorzeigt. Die Krebszellen scheinen in ihrer Wachstumsphase die Produktion von MHC-Molekülen zu unterdrücken. Da die körperfremden Zellen kaum MHC-Moleküle an ihrer Oberfläche bilden, haben T-Zellen es schwer, die fremden Zellen als solche zu erkennen. Außerdem produzieren die Krebszellen Stoffe, welche die Aktivität des Immunsystems hemmen – so genannte entzündungshemmende Cytokine.
MHC-Moleküle sind aber nicht nur Ausweis für die Immunpolizei, sie dienen auch als Schaukasten für das, was in der Zelle vor sich geht. Auf ihnen präsentieren Zellen Bruchstücke der in ihrem Inneren produzierten Bausteine. T-Zellen können so erkennen, ob die Zelle beispielsweise typische Tumorzellteile herstellt oder ob sie von einem Virus gekapert wurde, der die Zelle dazu zwingt, seine eigenen Bausteine zu produzieren. Erkennen T-Zellen solche Bruchstücke, attackieren sie die präsentierende Zelle. Deshalb gibt es Viren, welche die Produktion der MHC-Moleküle ihrer Wirtszelle unterdrücken, damit sie unerkannt bleiben können. CTVT scheint eine ähnliche Strategie zu fahren, um sich nicht nur als fremde Zelle zu tarnen, sondern auch als Tumorzelle.
»Wir glauben, dass CTVT die perfekte Balance gefunden hat.«Elizabeth Murchison
Zellen ohne MHC-Moleküle und somit ohne Ausweis sollten eigentlich von so genannten Natürlichen Killerzellen erkannt und eliminiert werden. Wie CTVT diese Attacke des Immunsystems umgeht, verstehen Murchison und ihre Kollegen noch nicht genau. »Wir glauben, dass CTVT die perfekte Balance gefunden hat«, erläutert die Genetikerin. »CTVT produziert nur sehr wenige MHC-Moleküle an seiner Oberfläche – genug damit die Natürlichen Killerzellen nicht alarmiert werden, aber so wenig, dass die T-Zellen sie nicht in ausreichender Anzahl erkennen.« Den Mechanismus würde sie gerne im Labor erforschen. Doch paradoxerweise wächst CTVT zwar seit Tausenden von Jahren in Hunden verschiedenster Rassen. Aber im Labor überleben sie nur wenige Tage.
Evolution eines parasitären Tumors
Doch wie hat CTVT überhaupt den Sprung von einer »normalen« Krebszelle zu einer geschafft, die erst ihrem Körper und dann einem fremden Immunsystem entkommt? Das fragt sich auch Murchison. »Ich würde wirklich gern in der Zeit zurückreisen und die Hundepopulation untersuchen, in der CTVT entstand«, sagt sie und blickt auf eine Zeichnung auf ihrem Schreibtisch. In einem hölzernen Rahmen mit goldenem Rand steht ein Hund mit gestreckter Rute. Es ist der CTVT-Ursprungshund. Eine Studentin – Emma Werner – hat ihn für sie gezeichnet.
Auch ohne Zeitmaschine erfuhr Murchison, wie dieser Hund aussah, wann und wo er lebte – mit Hilfe der Gene von CTVT. Denn diese stammen ja aus dem Tier, in dem CTVT erstmalig entstand. Damit konnte die Genetikerin zeigen, dass das Ursprungstier vermutlich aus einer Hundepopulation mit hohem Grad an Inzucht entstanden ist. Seine Eltern waren stark miteinander verwandt. »Möglicherweise hat diese nahe Verwandtschaft CTVT dabei geholfen zu entstehen« meint Murchison.
Je näher verwandt zwei Individuen miteinander sind, umso mehr klassische MHC-Moleküle der Klasse I teilen sie miteinander und umso schwieriger wird es für das Immunsystem, fremde Zellen zu erkennen. Theoretisch könnte CTVT so den ersten Sprung zu einem anderen Tier geschafft haben. Erst im Laufe der Evolution fand es dann einen Weg, das Immunsystem von anderen, weniger verwandten Tieren auszutricksen. Bei den Tasmanischen Teufeln, die nur auf einer Insel vorkommen und nachweislich eine geringe MHC-Vielfalt haben, passierte möglicherweise etwas Ähnliches.
Krebsübertragungen bei Menschen
Und was ist mit uns? Können auch menschliche Krebszellen von einer Person zur nächsten wandern? Wenn sie Hilfe bekommen, ja. Wenige Studien und ein großes unethisches Experiment zeigen das. Der US-amerikanische Arzt Chester Southam spritzte in den fünfziger und sechziger Jahren Krebszellen unter die Haut von Probanden – darunter Gefängnisinsassen und Krebskranke – und beobachtete, ob die Zellen im fremden Körper weiterwachsen würden. Nur informierte er seine Versuchspersonen nicht darüber, was genau er ihnen im Namen der Krebsforschung unter die Haut spritzte. Als sich drei junge Ärzte weigerten, seine Versuche durchzuführen und kündigten, wurde die unethische Art und Weise, wie Southam seine Experimente durchführte, publik.
Bis dahin hatte er bereits hunderten Menschen Krebszellen injiziert. Bei einem Teil von ihnen bildeten sich an den Einstichstellen harte Knoten: Tumore. Er entfernte sie, um sie genauer zu untersuchen. Ein paar der Geschwüre kamen aber immer wieder zurück – sie wuchsen in Probanden, die bereits zuvor Krebs im Endstadium hatten. Sie konnten die körperfremden Krebszellen nicht so gut abwehren.
»Dass die Zellen angewachsen sind und nicht abgestoßen wurden, ist erstaunlich«, sagt Hans-Reimer Rodewald, Professor für Immunologie am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ). »Aber man muss bedenken: Die Untersuchungen stammen aus einer Zeit, in der man die Immunologie noch nicht verstanden hat.« So waren weder die MHC-Typen der Probanden noch der Tumorzellen bekannt. Zudem ist unklar, ob die Krebszellen eventuell virusinfiziert waren. Beides beeinflusst, ob ihr Körper die Zellen abstößt oder nicht. »Deshalb sind die Ergebnisse aus heutiger Sicht schwer zu beurteilen«, meint Rodewald. Dass die fremden Tumorzellen bei den krebskranken Probanden eher wachsen, wundert ihn aber nicht. Schließlich hätten sie, je nach körperlicher Verfassung, ein schwächeres Immunsystem und die fremden Krebszellen somit ein leichteres Spiel.
Ein blinder Passagier
Das erklärt auch, wieso Krebs in seltenen Fällen durch Organtransplantationen von einem Menschen zum nächsten wandern kann. Hier trifft ein absichtlich geschwächtes Immunsystem auf Zellen, die dem Körper des Empfängers sehr ähnlich sind. Seitdem erste Berichte solcher Übertragungen von Krebs in den 1970er Jahren bekannt wurden, transplantieren Ärzte keine Organe von akut Krebskranken mehr. Das Risiko, dass sich metastasierende Krebszellen darin befinden, ist zu groß. Es gibt aber Ausnahmen: Organe von Verstorbenen mit primären Hirntumoren oder Hauttumoren, die nicht metastasieren, können laut der Deutschen Stiftung Organtransplantation in bestimmten Fällen zur Transplantation zugelassen werden. Mutmaßlich geheilte Krebspatienten kommen nach einer gewissen Zeit und gründlicher Prüfung ebenfalls wieder für die Organspende in Frage.
Doch auch wenn der Spender noch nie krebskrank war, können erste Krebszellen, die noch keine Symptome zeigen, in seinem Körper schlummern. Somit bleibt ein gewisses Restrisiko. Dieses ist aber sehr gering. Wie gering, untersuchte eine US-amerikanische Studie zwischen 1994 und 2001 systematisch: von 108 062 Menschen, die ein Organ transplantiert bekamen, entwickelten nur 13 einen Tumor, der auf den Spender zurückzuführen war. Das ist ein übertragener Tumor pro 8312 Transplantate – oder 0,01 Prozent der Organspenden.
Wie groß das Risiko in Deutschland ist, sich mit dem Krebs eines Organspenders zu infizieren, ist schwer zu beziffern, da Organspender und -empfänger zwar ein Leben lang von ihrem Transplantationszentrum begleitet werden. Doch ihr Gesundheitszustand kann nicht systematisch verfolgt werden. Erkrankt einer von beiden nach der Transplantation beispielsweise an Krebs und verstirbt, wird das nicht in jedem Fall dem Transplantationszentrum mitgeteilt. »Es gibt keine Richtlinie, dass das betreuende Transplantationszentrum dann auch benachrichtigt wird«, erläutert Danilo Fliser vom Transplantationszentrum des Saarlandes. »Wenn wir Krebserkrankungen nicht gemeldet bekommen, können wir sie auch nicht erfassen.«
Auch wenn keine soliden Organe, sondern Stammzellen transplantiert werden, könnten theoretisch klinisch unauffällige Vorstufen von Krebs mit übertragen werden. Für Stammzelltransplantationen muss das Immunsystems des Empfängers zuvor sogar komplett gelöscht werden. »Wenn dann ein Tumor aus dem Transplantat wächst – zum Beispiel ein Blutkrebs – gibt es keine Zellen, die den Tumor als fremd erkennen und dagegen angehen«, erläutert Rodewald.
Krebs von der Mutter auf das Ungeborene übertragen?
Dies sind aber alles Beispiele, in denen die Krebszellen auf künstliche Weise von einem Körper zum anderen wandern und einen meist immungeschwächten Menschen mit Krebs anstecken. Auf natürliche Art und Weise kann dies aber auch während der Schwangerschaft passieren. Jedoch zählen Forscher insgesamt nur 17 Fälle, in denen vermutlich Krebszellen der Mutter auf das ungeborene Kind metastasierten.
Einer davon passierte vor etwa zehn Jahren in Tokio. Bei der Mutter diagnostizierten Ärzte etwa einen Monat nach der Geburt eine Leukämie. Zehn Monate später wuchs ein Tumor im Kiefer ihres Kindes. Genetische Untersuchungen bestätigten, dass die Krebszellen mütterlichen Ursprungs waren. Das kindliche Immunsystem hatte die Tumorzellen nicht bekämpft, weil es sie nicht als fremd erkannt hatte: Die Krebszellen waren so mutiert, dass sie genau die beiden klassischen MHC-I-Gene verloren hatten, die das Kind nicht geerbt hatte. Sie waren für die T-Zellen »unsichtbar«.
In seltenen Fällen können Krebszellen auch vom Fötus zur Mutter wandern. Beim so genannten Chorionkarzinom entarten die plazentabildenden Zellen des Fötus zu einem aggressiven Tumor, der in den Körper der Mutter metastasieren kann. Auch diese Krebszellen bilden keine klassischen MHC-Moleküle der Klasse I, so dass das Immunsystem sie nicht als fremd erkennt.
»Es muss schon viel Pech zusammen kommen, damit eine Übertragung zwischen Menschen passiert.«Elizabeth Murchison
Es gibt also Fälle, in denen menschliche Krebszellen ansteckend wurden. Dies ist aber nur in einem ganz engen Rahmen möglich und beschränkt sich auf die Übertragung von Krebszellen von einer Person zur anderen. Aber nicht darüber hinaus. So eine ansteckende Krebserkrankung, wie sie bei Tasmanischen Teufeln oder Hunden auftritt, kommt bei Menschen nicht vor.
Könnten menschliche Tumore denn so ansteckend werden? »Ich denke es wäre prinzipiell möglich«, sagt Murchison, »aber extrem unwahrscheinlich. Schließlich sind dazu gleich zwei Dinge nötig: Es passiert nur selten, dass Krebszellen überhaupt die Gelegenheit bekommen in einen anderen Wirt zu wandern. Geschweige denn noch weiter. Und dort müssten sie auch noch dem Immunsystem trotzen und weiter wachsen. Da müsste schon viel Pech zusammenkommen, damit das passiert.« Sie macht eine Pause, blickt auf das Bild des CTVT-Ursprungshundes. Rechts daneben die Titelseite der Boulevardzeitung. »Auch wenn wir in den letzten Jahren mehrere solche Erkrankungen entdeckt haben – im Großen und Ganzen sind sie doch selten.«
Zwei Wochen später steht Murchison in einem steil gebauten Konferenzsaal im DKFZ in Heidelberg. Vor knapp 250 Krebsforschern hält sie einen Vortrag über den aktuellen Stand ihrer Forschung. Sie ist die einzige, die keine menschlichen Krebserkrankungen erforscht. Trotzdem wollen ihre Zuhörer mehr darüber wissen, wie die Krebszellen bei Hunden und Teufeln das Immunsystem umgehen. Denn das zu verstehen, könnte auch wichtige Erkenntnisse für die humane Krebsforschung und die Transplantationsmedizin liefern. So selten übertragbare Krebserkrankungen sind – unwichtig sind sie nicht.
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.