Onkologie: Impfen gegen Krebs
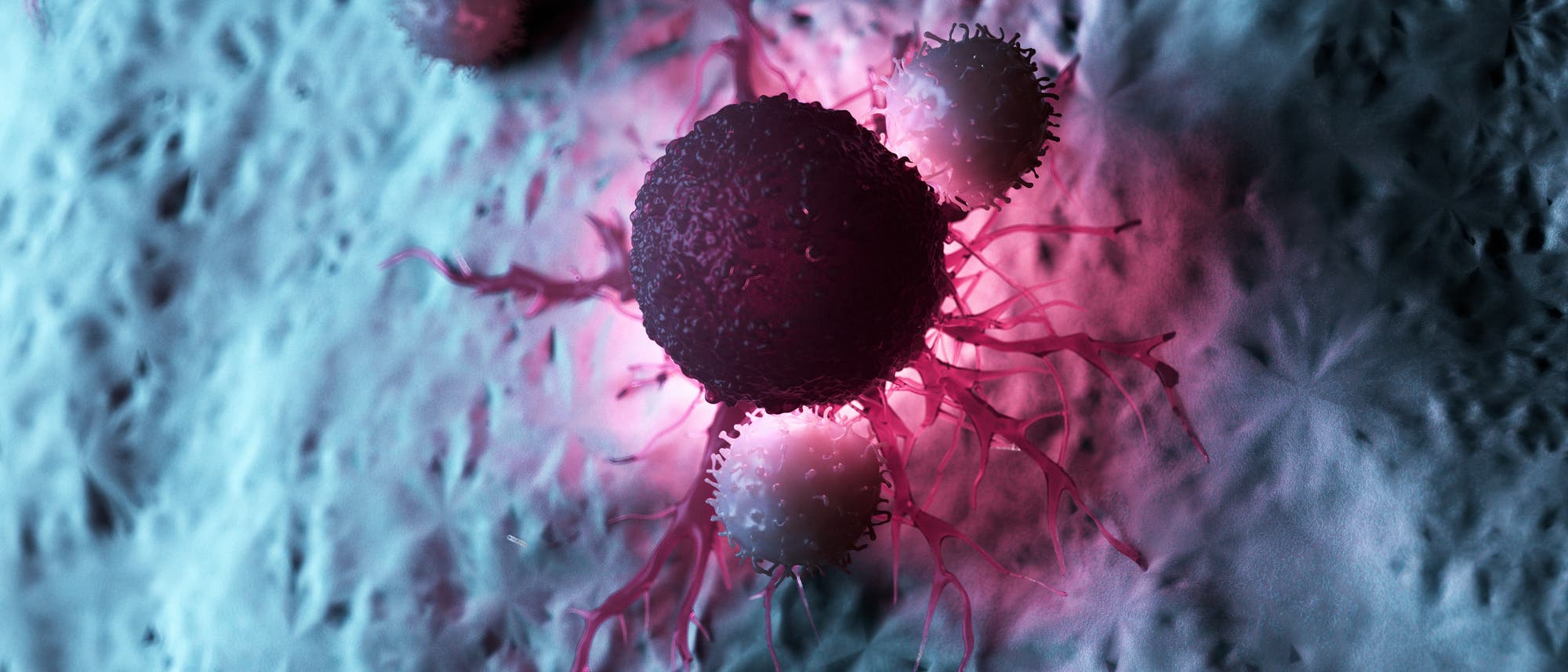
»Ich wollte etwas dagegen tun, ein unnötig kurzes Leben zu haben.« So formulierte es Barbara B. gegenüber dem amerikanischen Fernsehsender CNN im Sommer 2023. Die damals 77-Jährige ist eine der ersten Patientinnen weltweit, die einen personalisierten Impfstoff verabreicht bekam, um eine Rückkehr ihres Krebses zu verhindern. Sie litt unter einem Pankreaskarzinom, das sich mit der üblichen operativen und medikamentösen Behandlung meist nicht dauerhaft heilen lässt.
Im September 2020, inmitten der Covid-19-Pandemie, wurde ihr Bauchspeicheldrüsentumor am Memorial Sloan-Kettering Cancer Center in New York operativ entfernt. Die Mediziner schickten eine Probe des Tumorgewebes an das Unternehmen Biontech nach Deutschland, wo Fachleute daraus einen personalisierten Impfstoff namens Autogene Cevumeran herstellten, der sich gezielt gegen die Krebszellen der Patientin richtete. Barbara erhielt acht Dosen des Impfpräparats, bevor sie sich zusätzlich einer Standard-Chemotherapie unterzog. Anfang 2023 berichtete ein Team um ihren behandelnden Arzt Vinod Balachandran, dass Barbara immer noch frei von der Tumorerkrankung sei – ebenso wie sieben weitere ehemalige Pankreaskarzinom-Patienten, die einen personalisierten Impfstoff dagegen erhalten hatten. Im Februar 2025 hat das Forschungsteam einen neuen Zwischenstand veröffentlicht, demzufolge die Immunabwehr der meisten dieser Probanden immer noch aktiv die Tumorerkrankung abwehrt.
Personalisierte Krebsimpfstoffe sind Vakzine, die zielgerichtet eine Immunreaktion gegen das Tumorgewebe individueller Patienten entfachen. Durch eine Sequenzierung des Tumorgenoms werden sämtliche Mutationen ermittelt, die während der Entartung entstanden sind. Aus den resultierenden defekten Proteinen suchen dann Algorithmen diejenigen aus, die als »Neoantigene« gut identifizierbare Angriffsziele für das Immunsystem abgeben. Der Impfstoff schaltet die Körperabwehr dagegen scharf, womit sich die Hoffnung verbindet, dass die Abwehrtruppen die Merkmale auf den Tumorzellen erkennen und beginnen, sie zu attackieren.
Erfolgreiche Zieldarbietung
Schon im Jahr 2017 berichteten eine deutsche und eine amerikanische Forschungsgruppe unabhängig voneinander, dass personalisierte Krebsimpfstoffe in Kombination mit so genannten Immuncheckpoint-Inhibitoren (Arzneistoffen, die Immunbremsen aufheben und so die Körperabwehr ankurbeln), den Krankheitsverlauf bei Melanompatienten zu verbessern schienen. Während das erste Team um Ugur Sahin vom Mainzer Unternehmen Biontech auf mRNA als Impfstoff gesetzt hatte, hatte die zweite Gruppe um Catherine Wu und Patrick Ott vom Dana-Farber Cancer Institute in Boston kleine Proteinbruchstücke verwendet, um dem Immunsystem die Neoantigene zu präsentieren. Mittlerweile laufen weltweit Dutzende von Forschungsstudien, die den Einsatz von personalisierten Impfstoffen gegen verschiedene Tumorarten erproben.
Mehrere Studien haben mittlerweile gezeigt, dass Krebsimpfstoffe – egal ob auf mRNA-Basis oder aus Proteinbruchstücken – starke Immunantworten hervorrufen können. Besonders eindrucksvoll belegt haben das die bereits erwähnten Fachleute vom Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, die solche Vakzine gegen das Pankreaskarzinom einsetzen. Anhand von Einzelzell-Untersuchungen und speziell dafür entwickelten bioinformatischen Werkzeugen ließen sich im Blut der behandelten Patienten gezielt jene T-Lymphozyten aufspüren, die durch den Impfstoff aktiviert worden waren und sich daraufhin um ein Vielfaches vermehrt hatten. Ihr Anteil an der gesamten Lymphozytenmenge im Blut erreichte dabei Werte, die mit der Zahl aktivierter Immunzellen nach typischen Schutzimpfungen vergleichbar war. Bei etlichen der Behandelten ließ sich diese Wirkung noch nach drei Jahren nachweisen; möglicherweise hält sie sogar lebenslang an, wie manche Mediziner vermuten. Zwei der therapierten Krebspatienten erlitten während des Studienzeitraums allerdings einen Rückfall; bei ihnen hatten die vom Impfstoff ausgelösten Immunreaktionen merklich nachgelassen.
Mehrere Studien belegen, dass personalisierte Krebsimpfungen die Rückkehr der Erkrankung verhindern beziehungsweise verzögern können. Zu ihnen gehört eine größere klinische Phase-II-Studie mit Melanompatienten, bei denen nach chirurgischer Entfernung des Tumors ein hohes Rückfallrisiko besteht. Die Ergebnisse wurden 2024 veröffentlicht. Ihnen zufolge waren bei Erkrankten, die den personalisierten mRNA-Impfstoff V940 zusammen mit einem Immuncheckpoint-Inhibitor erhalten hatten, das Rückfall- und das Sterberisiko um beinahe 50 Prozent vermindert (verglichen mit alleiniger Gabe des Checkpoint-Inhibitors). Auch bei Nierenzellkarzinom-Patienten könnten personalisierte Krebsvakzine zu einem niedrigeren Rückfallrisiko führen: Alle neun Studienteilnehmer, die am Dana-Farber Cancer Institute den Impfstoffkandidaten NeoVax erhalten hatten, blieben während der dreijährigen Beobachtungszeit tumorfrei – obwohl hierbei ein etwa 60-prozentiges Rückkehrrisiko besteht. Sämtlichen Patientinnen und Patienten wurden im Rahmen dieser Studien die Tumoren zunächst möglichst vollständig chirurgisch entfernt, bevor die Impfstoffgabe erfolgte. Das Vakzin sollte dann eventuell vorhandene restliche Krebszellen ausschalten.
Wettlauf gegen die Zeit
Gegen fortgeschrittene Tumorerkrankungen wirken personalisierte Krebsimpfstoffe bislang weniger gut. Laut neueren Studiendaten sprachen von 183 Patienten mit verschiedenen Tumorerkrankungen in einem späteren Stadium, die Autogene Cevumeran gemeinsam mit einem Checkpoint-Inhibitor erhielten, etwa sechs Prozent auf die Behandlung an. In der Regel bildeten sich dabei die Tumoren nur vorübergehend zurück. Allerdings handelte es sich um eine Phase-I Studie, und es ist noch unklar, inwieweit sich ihre Ergebnisse verallgemeinern lassen. Die Behandlung fortgeschrittener Krebserkrankungen sei ohnehin schwierig, wie der Direktor der Inneren Klinik am Westdeutschen Tumorzentrum der Universitätsmedizin Essen Martin Schuler erklärt, der an der Studie beteiligt war. Denn je mehr Zeit verstreiche, umso mehr Gelegenheiten habe ein Tumorgewebe, zu mutieren, verschiedene Krebszelltypen hervorzubringen und Metastasen (Tochtertumoren) abzusondern – erst recht unter dem Selektionsdruck diverser verabreichter Therapien. Das erschwere die Suche nach geeigneten Angriffszielen, da sich die verschiedenen Zellpopulationen und Metastasen im Körper mit fortschreitender Krankheit immer stärker in ihren Neoantigenen unterscheiden könnten.
Das belegte unter anderem die Studie eines Forschungsteams um Charles Swanton vom University College London: Eine Lungenkrebspatientin hatte nach mehreren Standardtherapien einen personalisierten Impfstoff erhalten, der sich gegen einen erneut aufgetretenen Tumor in einem Lymphknoten richtete. Wenige Monate nach Beginn der Impfung tauchten Metastasen in der Leber auf, gegen die das Vakzin keine Wirkung zeigte; die Patientin starb schließlich daran. Erbgutuntersuchungen ergaben, dass die entarteten Zellen in den Lebermetastasen infolge von Mutationen jene Neoantigene verloren hatten, auf die der Impfstoff abzielte. Um so etwas zu verhindern, ließen sich personalisierte Krebsimpfstoffe theoretisch fortlaufend an die Entwicklung der Tumorzellen anpassen – doch im fortgeschrittenen Krankheitsstadium sei das nicht aussichtsreich, wie Schuler erläutert. Denn wegen des umfangreichen Reservoirs an unterschiedlichen Zellpopulationen sei dann die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass einige Zellen der Behandlung trotzen.
Daher ist es weiterhin vorteilhaft, zunächst die Tumormasse so weit wie möglich zu entfernen. Das macht den Verbleib behandlungsresistenter Zellpopulationen weniger wahrscheinlich und etwaige Restbestände des Tumorgewebes für die Körperabwehr leichter zugänglich. Im Optimalfall wurde das Immunsystem der Patientin oder des Patienten noch nicht durch Chemo- oder Strahlentherapie in Mitleidenschaft gezogen, was bei fortgeschrittenen Erkrankungen allerdings eher selten zutrifft. Nichtsdestoweniger testen Fachleute personalisierte Impfstoffe auch weiterhin gegen solche Krebswucherungen.
Infolge der bisher positiven Ergebnisse bei Anwendung von Autogene Cevumeran gegen das Pankreaskarzinom haben Biontech und sein Kooperationspartner Roche eine größere Phase-II-Studie damit aufgelegt, die 260 Teilnehmerinnen und Teilnehmer einschließt und in zehn Ländern (darunter Deutschland mit vier beteiligten klinischen Zentren) läuft. Parallel dazu testet Moderna zusammen mit dem Pharmaunternehmen MSD den Einsatz der Krebsvakzine V940 gegen das Melanom in einer Phase III-Studie mit über 1000 Patientinnen und Patienten weltweit. Fünf weitere große Phase-II/III-Studien sind mittlerweile mit V940 gestartet; unter anderem gegen das nicht kleinzellige Lungenkarzinom, das Nierenzell- sowie das Blasenkarzinom. Voraussichtlich um das Jahr 2030 herum dürfte sich endgültig entscheiden, ob personalisierte Krebsimpfstoffe einen festen Platz im Arsenal der Tumortherapien bekommen.




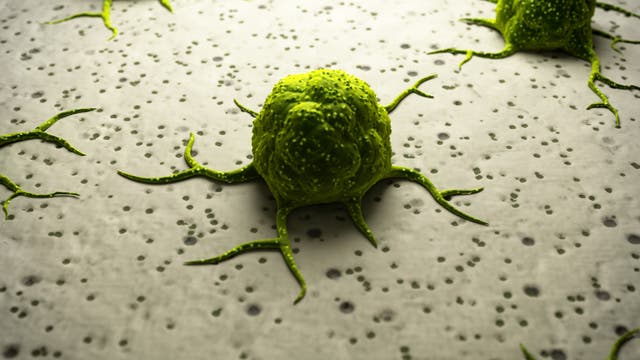

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.