Neurowissenschaften: Mein Leben mit Parkinson
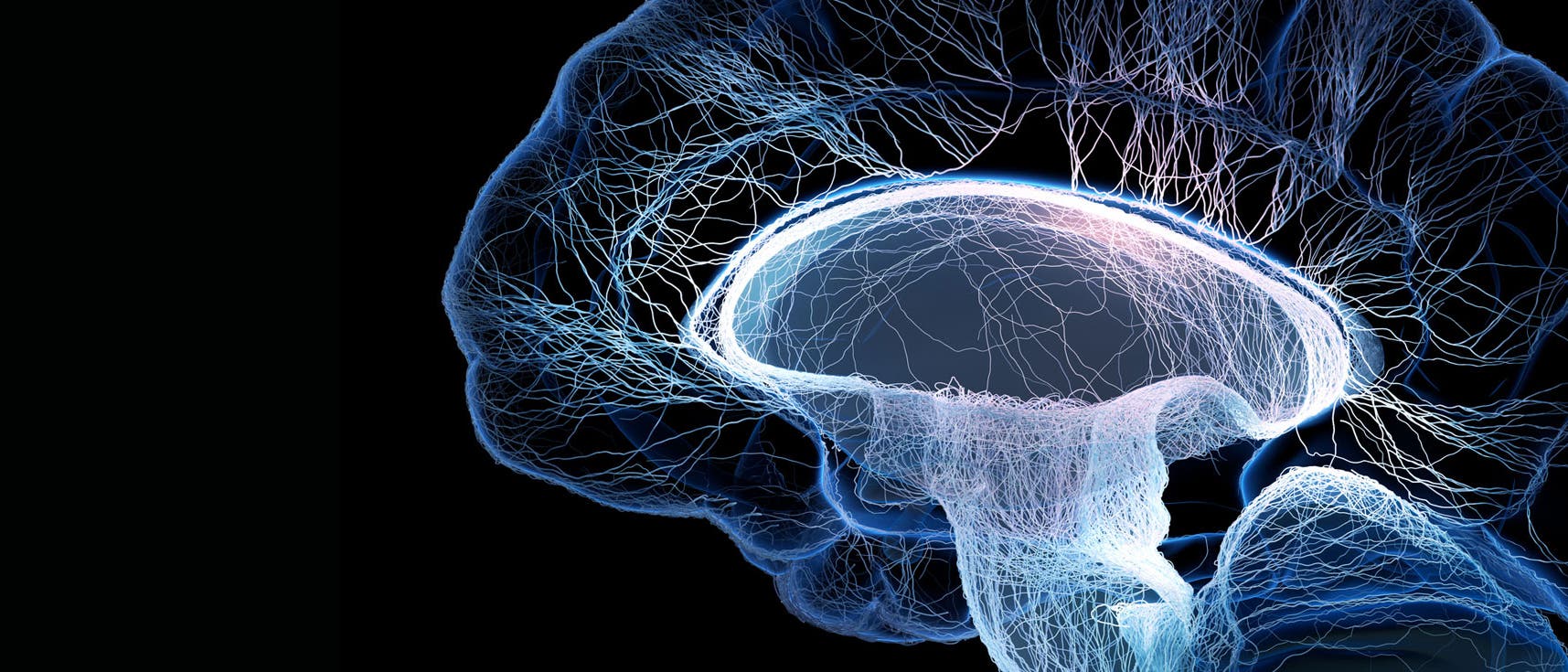
Vor rund einem Jahr saß ich in illustrer Runde beim Dinner, zusammen mit einigen ziemlich reichen und relativ bekannten Menschen. Wir – meine Frau und ich, der junge, aufstrebende Professor eines bekannten Forschungsinstituts – waren zum Plausch mit den örtlichen Geldgebern eingeladen. Und jeder Außenstehende hätte mich auf dem Karriereweg nach oben vermutet. Ich hatte mich, seit ich erwachsen war, hartnäckig und mit Leidenschaft der Wissenschaftswelt verschrieben und schließlich meinen Traumjob ergattert: Leiter meiner eigenen neurowissenschaftlichen Forschungsabteilung.
Ein Geschäftsmann nutzte die Gelegenheit, mich auf Verwandte mit ernstlichen gesundheitlichen Problemen anzusprechen: "Sie, als Neurowissenschaftler: Was wissen Sie über die Parkinsonkrankheit?"
Sofort habe ich den Blick meiner Frau gesucht, aber die war anderswo ganz ins Gespräch vertieft. Ich war auf mich gestellt, musste erst einmal kurz nachdenken und mich sammeln – denn ich hatte ein Geheimnis.
Was zuvor kein Kollege erfahren hat: Ich leide unter der Parkinsonkrankheit.
Also stehe ich am Beginn einer faszinierenden, Furcht einflößenden und letztlich lebensbestimmenden Reise als Hirnforscher mit einer schweren Hirnkrankheit. Das hat mir schon jetzt andere Blickwinkel auf meine Arbeit eröffnet. Ich bringe dem Leben größere Wertschätzung entgegen. Und mir ist klar geworden, dass ich etwas bewegen könnte, was niemand erwarten würde. All das ist mir allerdings erst nach und nach wirklich bewusst geworden.
Die ersten Anzeichen
Ich erinnere mich genau an den ersten Augenblick, in dem ich spürte: Irgendetwas ist faul. Das ist vier Jahre her, ich war gerade dabei, einen Riesenstapel Bestellformulare für neue Laborgeräte abzuarbeiten – als plötzlich, nach ein, zwei Seiten, meine Schreibhand in einen unkontrolliert zitternden und rettungslos verkrampften Klumpen aus Knochen und Fleisch mutierte. Dann, ein paar Tage später, habe ich mich bei einer merkwürdigen Veränderungen im Gehen ertappt: Statt meine Hände locker an den Seiten pendeln zu lassen, hielt ich sie fest vor dem Körper, ja krallte sie vorn ins Hemd. Zudem zuckten zwei Finger immer mal wieder autonom vor sich hin.
Da war ich gerade 36 geworden – und steckte auch ohne körperliche Ausfallerscheinungen in der anstrengendsten Phase meines Lebens. Innerhalb von gerade mal einem halben Jahr hatte ich den neuen Job angenommen, auf den ich mein ganzes Leben hingearbeitet hatte, war zum zweiten Mal Vater geworden, von einem zum anderen Ende des Landes umgezogen und in einer Stadt gelandet, in der ich niemanden kannte. Und ich schuftete auf mich allein gestellt im Labor, ohne wirklich zu wissen, wer mich hier eigentlich zum Chef gemacht hatte. Mein Forschungsgegenstand waren chemische Neuromodulatoren, etwa Dopamin, und wie sie die neuronale Aktivität und unsere Verhaltensweisen beeinflussen. Und jetzt rebellierten die chemischen Botenstoffe in meinem eigenen Hirn.
Ich vermutete Verschiedenes als Ursache. Ein Hirntumor? Dystonie? Eine motoneuronale Erkrankung? Chorea Huntington? Multiple Sklerose? War ich vielleicht schlicht stressbedingt überlastet?
Ein junger Neurologenkollege hat schließlich die Diagnose gestellt. Er arbeitete an einem der weltweit führenden Zentren für Bewegungsstörungen, und auf mich wirkte er eher wie ein Kollege als wie eine medizinische Autorität. Genau wie ich hatte er viel Zeit im Labor verbracht, Grundlagenforschung getrieben und in einigen Journals publiziert, in denen meine Studien auch veröffentlich worden sind; wir hätten uns genauso gut auf einem Fachkongress über den Weg laufen könne. Das Erlebnis meiner Diagnose war auf gewisse Weise bizarr kollegial.
Und sofort habe ich mich gefragt, wie lange ich meinen Kollegen nichts sagen können werde. Ich machte mir Sorgen um Bewilligungen von Forschungsgeldern – die Gutachter würden mein Labor nicht finanzieren, wenn sie nicht mit Sicherheit in meine Zukunft investieren könnten. Ich machte mir Sorgen, ob Postdocs und Studenten Angst hätten, in meiner Gruppe mitzuarbeiten. Und – vielleicht am entscheidendsten – ich fragte mich, wie lange ich selbst wohl noch Experimente würde durchführen können, also das tun, was ich immer am liebsten getan habe.
Unbeweglichkeit, Zittern, Müdigkeit. Unkontrolliertes Zucken. Umfallen und sabbern. Undeutliche, mühsame Aussprache; dieser merkwürdig maskenhafte Gesichtsausdruck des Parkinsonkranken: die Summe all meiner möglichen Zukunftsaussichten.
Gedanken machen den Unterschied
Seit meiner Parkinsondiagnose sind mehr als zwei Jahre vergangen. Seit dem Tag hat sich das Verhältnis zwischen mir und dem Gehirn verändert – meinem Forschungsgegenstand der letzten 20 Jahre. Ich weiß jetzt, wie es ist, an einer Hirnerkrankung zu leiden; und ich kann die Folgen aus erster Hand beurteilen. Zum Beispiel dieses typische ruckartige Erstarren mitten in einer Bewegung: Es trifft mich gelegentlich, wenn ich die Hand heben will und … sie es einfach nicht tut. Wohlgemerkt: Ich sage "tut", nicht "kann". Denn mein Arm funktioniert wunderbar: Er ist kräftig und kann sich durchaus bewegen; nur muss ich mich anstrengen, sogar konzentriert anstrengen, damit er sich auch wirklich bewegt. Und das ist gelegentlich derart aufreibend, dass ich alles andere kurz sein lassen muss, was mein Hirn gerade beschäftigt, etwa zu sprechen oder zu denken. Manchmal – wenn keiner zuschaut – bewege ich dann meine eine mit der anderen Hand.
Als Neurowissenschaftler ist es ebenso faszinierend wie verstörend, unmittelbar zwischen die Fronten des neurophysiologischen und des philosophischen Konstrukts von "Willen" zu geraten: Wie Körper und Geist in mir selbst miteinander ringen, zwingt mir das eigentlich überholte Bild des Homunkulus auf, jener (zumindest aus neurowissenschaftlicher Sicht) pejorativ angehauchten Karikatur eines winzigen Männleins, das in meinem Kopf an Schaltknüppeln zieht, einlaufende Daten notiert und Resultate nach außen verlautbart. Quasi alles, was wir über die Organisation unseres Gehirns wissen, spricht gegen ein solches Bild – und dennoch passt diese Dualität genau zu meiner täglichen Erfahrung.
Parkinson ist, gerade bei jüngeren Patienten, vor allem eine Störung der motorischen Kontrolle und nicht des Denkens. Dessen ungeachtet macht meine eigene, wiewohl begrenzte Erfahrung mich nachdenklich: Wie ist es, im Inneren eines aus dem Ruder gelaufenen Denkapparats gefangen zu sein? Wenn man die Fähigkeit zur Interaktion mit der Umwelt zu verlieren beginnt; wenn man seine Begabung zu klarer Wahrnehmung und Analyse einbüßt – was bleibt dann noch von unserem bewussten Selbst?
Das bringt mich zu einem der Hauptgründe, meine Krankheit geheim zu halten: dem Stigma "Geisteskrankheit". Weil die meisten Menschen den Morbus Parkinson nicht einordnen können, wird er mit kognitionsbeeinträchtigenden Krankheiten verwechselt, etwa mit Schizophrenie oder der Alzheimererkrankung. Ich selbst fühle mich geistig fit und produktiv wie immer – allerdings war ich mir gar nicht sicher, ob andere ihr Vertrauen in mich setzen würden, obwohl meine Laufbahn auf einem schmalen Grat balanciert. Das hat jedem Augenblick meines Lebens eine schauspielerische Leistung abverlangt, bei der ich meine Symptome zu verstecken suche. In der Arbeit und beim Gemüsehändler, im Vorgarten und sogar gegenüber meinen Kindern – immer bin ich mir meiner eigenen Bewegungen sehr bewusst. Und nirgendwo mehr als bei Vorträgen auf wissenschaftlichen Tagungen wie der der Society of Neuroscience (SfN). Wahrscheinlich würden Sie in meiner Gegenwart nicht darauf achten, was ich mit meinen Händen anstelle – ich sehr wohl. Meist sitze ich drauf.
Beeinflusst die Parkinsonkrankheit auch meine Herangehensweise an die wissenschaftliche Arbeit? Jedenfalls die tägliche Routine beim Experimentieren. Die Techniken in meiner Arbeitsgruppe verlangen gelegentlich ein gehöriges Maß an motorischer Geschicklichkeit. Ich musste daher mein Vorgehen anpassen, mir etwa mehr Zeit nehmen, einiges mit meiner besser funktionierenden Hand kompensieren oder die Gerätschaften anders halten. Ich schlage mich so immer noch bemerkenswert gut am Labortisch: Laborgeschick ist, so viel habe ich gelernt, mehr eine Frage von Erfahrung, Detailbesessenheit und methodischer Flexibilität als von bloßer Fingerfertigkeit. Wirklich hilfreich sind auch meine niedrig bis mittelstark dosierten Medikamente – und genauso auch ausreichend Schlaf und körperliche Betätigung. Alles deutet darauf hin, dass ich noch viele Jahre produktiv in der Forschung tätig sein kann, vielleicht sogar das ganze Arbeitsleben hindurch.
Es stellt sich auch die Frage, ob meine Diagnose die Ausrichtung meiner Forschungsbemühungen verändert. So fragt man mich ab und an, ob ich mich ganz oder teilweise auf die Erforschung von Parkinson konzentrieren werde. Kann sein, wenn denn ein Projekt einmal spannend genug ist – bis dahin aber neige ich dazu, bei selbst gesteckten Zielen zu bleiben. Manchmal werde ich auch gefragt, ob meine Krankheit die Ungeduld verstärkt, mit der ich auf Forschungsfortschritte warte, die einmal zur Heilung meiner Krankheit beitragen könnten. Hier fällt mir die Antwort leicht: Die Doppelperspektive eines Betroffenen und aktiv Forschenden verstärkt meinen Glauben an die Dringlichkeit wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns. Mir ist nur allzu bewusst, dass sich die Aussicht auf Heilung erst nach Jahrzehnten intensiver Grundlagenforschung erfüllt kann. In jedem Fall aber treibt mich meine Diagnose an – zur bestmöglichen Untersuchung der spannendsten wissenschaftlichen Fragen. Das Privileg, forschen zu können, kann für jeden von uns jeden Augenblick vorbei sein.
Verraten oder verschweigen?
Zurück zu diesem Moment auf der Dinnerparty, als alle Augen auf mich gerichtet waren, um meine Meinung über Parkinson zu erfahren. Ich wollte allen Kollegen rundum verraten, was ich durchmachte. Ich wollte unserem Geldgeber in die Augen schauen und sagen: "Lustig, dass Sie ausgerechnet danach fragen. Schließlich bin ich nicht nur Neurowissenschaftler – sondern ich habe auch die Parkinsonkrankheit." Ich wollte eine fein ausgearbeitete Ansprache anstimmen, eloquent und mit persönlicher Note wissenschaftliche Fakten der neurodegenerativen Erkrankung zusammenfassen. Und schließen wollte ich mit den Worten: "Und genau deshalb ist Grundlagen-Hirnforschung so wichtig." Aber: Ich habe es nicht getan.
Stattdessen habe ich eher lustlos einiges zur Pathologie und den charakteristischen Symptomen von Morbus Parkinson heruntergespult. Ein intellektuell durchaus fruchtbarer Austausch folgte – nur eben nicht die Art von Gespräch, das hätte geführt werden können. Und aus genau diesem Grund habe ich entschieden, mich nicht länger zu verstecken.
Dieses Jahr habe ich der Institutsleitung die Wahrheit gesagt. Ein paar Tage später dann der Verwaltung, meinen Laborkollegen und vielen Mitarbeitern. Das hat mir einiges abverlangt, war am Ende aber eine der besten Entscheidung, die ich in meinem Leben getroffen habe. Jeder in der Arbeit hat mich unterstützt – so, dass es mir rasch ziemlich blöd vorkam, mich vier Jahre lang – seit den ersten Symptomen – mit Sorgen getragen zu haben, wie wohl mein Umfeld auf die Krankheit reagieren könnte. Nach ein paar Monaten war die Krankheit für meinen täglichen Umgang kein Thema mehr. Man behandelt mich wie jeden anderen Kollegen – und es ist sehr befreiend, nicht ständig darüber nachgrübeln zu müssen, wer Bescheid weiß und wer nicht. Es fühlt sich immer noch etwas komisch an, mich gegenüber einem Unbekannten zu erklären – aber ich bemühe mich nicht länger, ständig meine Symptome zu verstecken; höchsten gerade so viel, dass sie nicht ständig ins Auge springen. Ich würde gerne jedem in einer ähnlichen Situation, der diesen Artikel liest, einen Rat mit auf den Weg geben: Das Leben ist zu kurz, um vor sich selbst davonzulaufen. Vielleicht überraschen Ihre Kollegen Sie – und womöglich können Sie trotz aller Beeinträchtigung ein toller Wissenschaftler sein
.Bleibt noch die Frage, warum ich diesen Artikel eigentlich anonym verfasse: Ich möchte einfach nicht als "dieser Parkinson-Typ" in der Wissenschaftswelt Karriere machen, bevor ich das durch Leistung erreicht habe. Nichtsdestoweniger: Ich verstecke mich nicht länger – wenn Sie herausfinden wollen, wer ich bin, dürften Sie das hinbekommen. Von meiner Seite aus ginge das auch in Ordnung.
Der Artikel ist im Original unter dem Titel "My life with Parkinson's" in "Nature" erschienen.



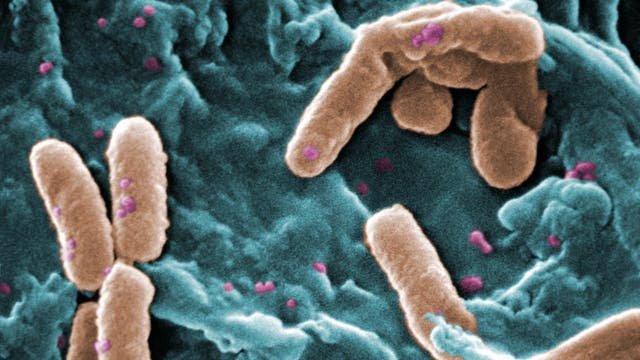
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.