Sciencefiction: Blume unter Verdacht
»Anstrengend.« Das dürfte für viele Zuschauer einer der ersten Eindrücke im Sciencefiction-Thriller »Little Joe« sein, der heute in den Kinos anläuft. Denn ein schriller Dauerton begleitet jeden Auftritt der gentechnisch veränderten Blume »Little Joe«. Doch gerade dieser penetrante Klang macht das Werk – neben vielen anderen herausstechenden Stilmitteln – interessant. Denn er erweckt schon früh den Eindruck, dass mit der Pflanze etwas nicht stimmt. Zu Recht?
Die eigentliche Protagonistin Alice ist Pflanzenzüchterin. Sie hat mittels Gentechnik eine purpurrote Blume erschaffen, die bei idealer Raumtemperatur und viel Zuwendung eine Vorstufe des so genannten Bindungshormons Oxytozin produziert und in die Luft absondert. Oxytozin spielt eine wichtige Rolle bei Glücksempfindungen. Die gentechnisch veränderte Blume soll ihre Besitzer damit glücklich machen und steht kurz vor der Markteinführung. Alice, die allein erziehend ist, hat das Gewächs nach ihrem 13-jährigen Sohn Joe benannt. So weit, so gut.
Unerprobte virale Genfähre
Bald jedoch verhalten sich Menschen, die den Pollen von Little Joe eingeatmet haben, seltsam. Sie scheinen bestrebt, die steril gezüchtete Pflanze zu beschützen, und ihr Sozialverhalten gegenüber anderen Menschen ändert sich. Bella, eine Kollegin von Alice, die schon früh Bedenken hatte, spricht den Verdacht aus: Was, wenn Little Joe nicht einfach nur glücklich macht? Und hat Alice, entgegen ihrer Behauptung, nicht vielleicht doch die neue, unerprobte virale Genfähre genutzt, um die Blume zu verändern? Könnte das Virus mutiert und krank machend geworden sein? Die Zeit drängt, denn es naht die Verkaufsmesse mit Little Joes geplanter Markteinführung.
Spätestens jetzt kehren die Gedanken der Zuschauer zu dem penetranten Ton zurück, der das Erscheinen des Gewächses ständig begleitet. Ist er Sinnbild dafür, wie die Pflanze mit ihrer Umwelt kommuniziert? Vertont er die Gefahr, die von ihr ausgeht? Man hat genügend Zeit, darüber nachzudenken, denn die meiste Zeit ist der Film sehr still, verzichtet weitgehend auf Musik, und die Kameraeinstellungen haben für heutige Sehgewohnheiten eine fast schon epische Länge. Ihre geschickt gewählten Blickwinkel lassen viel vermuten und wenig wissen.
Getragen wird die Geschichte von starken Bildern und Dialogen. Handlung oder gar Action gibt es kaum. Wenn doch, dann im Zusammenspiel mit unvermittelten Soundeffekten, die erschrecken – allerdings leider eher wie in einem billigen Horrorfilm. Das ist einer der wenigen Schwachpunkte des sonst handwerklich gelungenen Werks.
Der Film berührt eine Reihe gesellschaftlicher Fragen. Da ist das Verhältnis zwischen der allein erziehenden, voll berufstätigen Mutter und ihrem pubertierenden Sohn: Alice fühlt sich zwischen ihrer Zuneigung zu ihrem echten und ihrem »erschaffenen Kind«, der Wunderblume, hin- und hergerissen. Auch geht es darum, was Glück ausmacht – ist man mit biochemisch induzierten Gefühlen ohne äußeren Anlass nicht bloß ein grinsender Zombie? Nicht zuletzt handelt der Film über Unsicherheiten in der Wissenschaft. Was wissen wir wirklich über Organismen, die wir gentechnisch verändert haben? Welche Nebenwirkungen sind möglich?
In wissenschaftlicher Hinsicht wirkt der Film nicht völlig überzeugend. Selbst die wildeste Mutation eines viralen Vektors dürfte es Menschen schwerlich befehlen, eine bestimmte Blumensorte zu beschützen – dennoch zieht Pflanzenzüchterin Alice diese Option ernstlich in Betracht. Andererseits fühlt man sich auch als wissenschaftlich vorgebildeter Zuschauer mitunter verunsichert. Dass Pheromone oder auch Viren menschliches Verhalten modifizieren können, ist Fakt. Und die Indizien gegen Little Joe erscheinen im Film erdrückend.
Emily Beecham spielt die zweifelnde Wissenschaftlerin Alice im Wortsinn ausgezeichnet: Sie erhielt für ihre Leistung bei den Filmfestspielen in Cannes 2019 die Palme als beste Darstellerin. Ben Whishaw und Kerry Fox überzeugen als Alices Kollegen Chris und Bella ebenso wie Kit Connor, der Sohn Joe verkörpert. Alle drei lassen das Publikum wunderbar im Ungewissen darüber, ob sie gerade eine Persönlichkeitsentwicklung durchmachen oder tatsächlich unter dem Einfluss von Little Joes Pollen stehen. Regisseurin Jessica Hausner, die zusammen mit Géraldine Bajard das Drehbuch schrieb, hat hervorragende Mittel gefunden, die Zuschauer zu manipulieren und eine durchgehend spannende Geschichte zu erzählen, obwohl kaum etwas passiert.
Wer schnelle Schnitte und eine treibende Handlung bevorzugt, sollte einen großen Bogen um »Little Joe« machen. Auch tief gehende Charakterstudien gibt das Drehbuch nicht her. Wer aber Vergnügen daran findet, Indizien zu sammeln und zu rätseln, was wirklich vor sich geht, und wer Programmkino mag, wird sich bestens unterhalten fühlen und danach einigen Gesprächsstoff haben.
Der österreichische Film ist ab dem 9. Januar 2020 zu sehen.



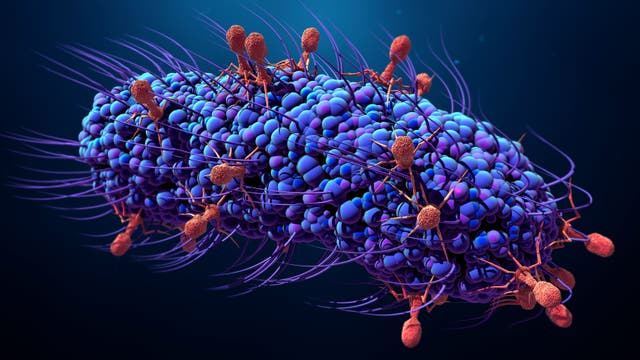


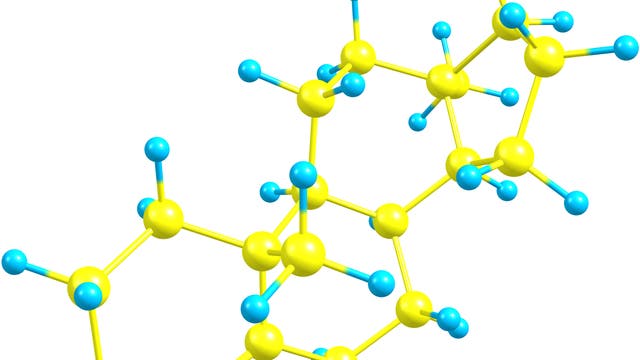
Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben