Träume: Der Nutzen des Irrealen
Falls Außerirdische jemals die Erde besuchen, stutzen sie womöglich über etwas Sonderbares: Überall verbringen Menschen einen Großteil ihrer Zeit mit Dingen, die nicht real sind. So begeistern sie sich leidenschaftlich für Geschichten, die lediglich in Filmen, Romanen oder Videospielen stattfinden. Woher rührt unsere Liebe zur Fiktion?
Vielleicht, so könnten die Aliens annehmen, sind Menschen zu dumm, um zwischen Fantasie und Realität zu unterscheiden. Noch verwirrender dürften es die Besucher aus dem All finden, dass wir uns auch im Schlaf mit Irrealem beschäftigen. Träumen kostet den Organismus Zeit und Energie. Vermutlich hat es also einen evolutionären Zweck. Nun fragen sich die Außerirdischen so langsam, ob sie etwas übersehen, was die Tragweite des nicht realen Erlebens erklären könnte.
Als Schriftsteller interessiert auch mich diese Frage brennend, und als Neurowissenschaftler habe ich hierzu eine Hypothese entwickelt, die auf Erkenntnissen zu künstlichen neuronalen Netzen fußt. Möglicherweise verbessert Träumen unsere Leistungen im Wachzustand gerade dadurch, dass wir in ihnen Schräges erleben. Trifft meine Hypothese zu, könnte sie zugleich die erstaunliche Anziehungskraft des Irrealen am helllichten Tag erklären…


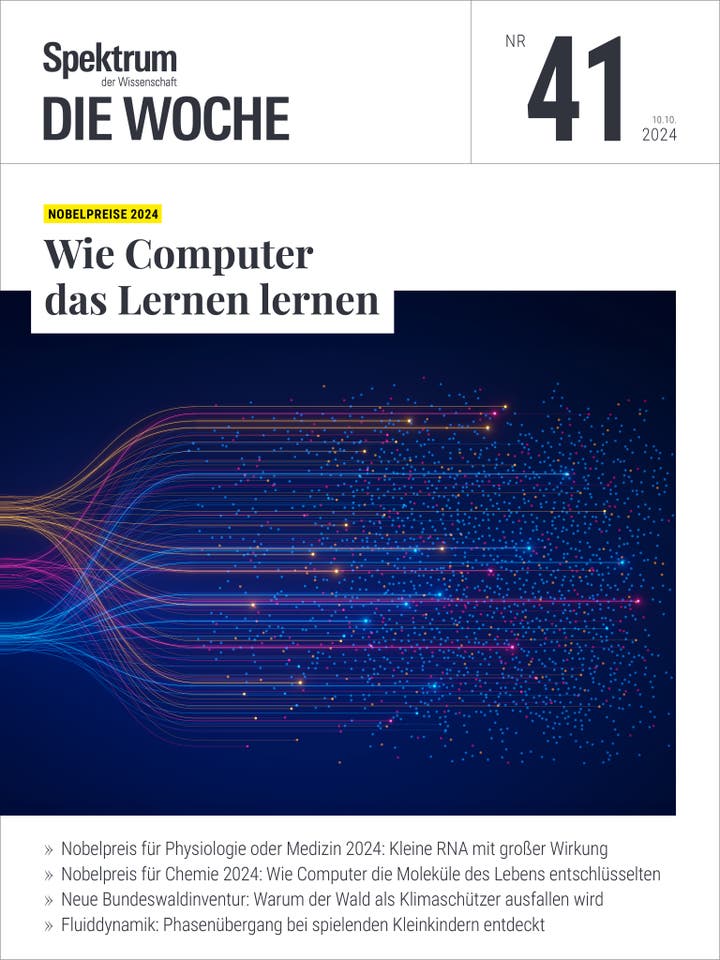
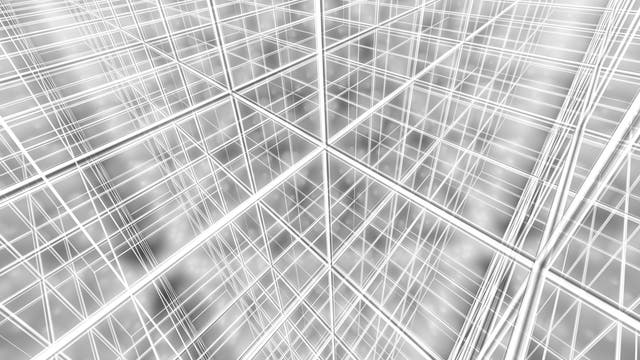





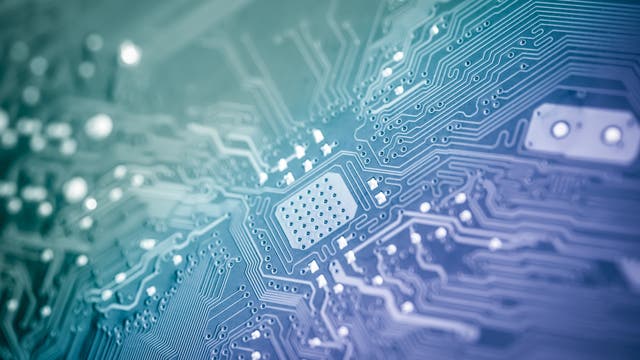


Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben