Placebooperationen: Ansturm auf die Scheinblockade
Auch für Eingriffe am Hirn gilt: Die Wirksamkeit einer Therapie kann nur der Vergleich mit einer Placebogruppe erweisen. Doch die dazu nötigen Scheinoperationen sind nicht nur ethisch fragwürdig, sie könnten auch wertvolle Therapien verhindern.
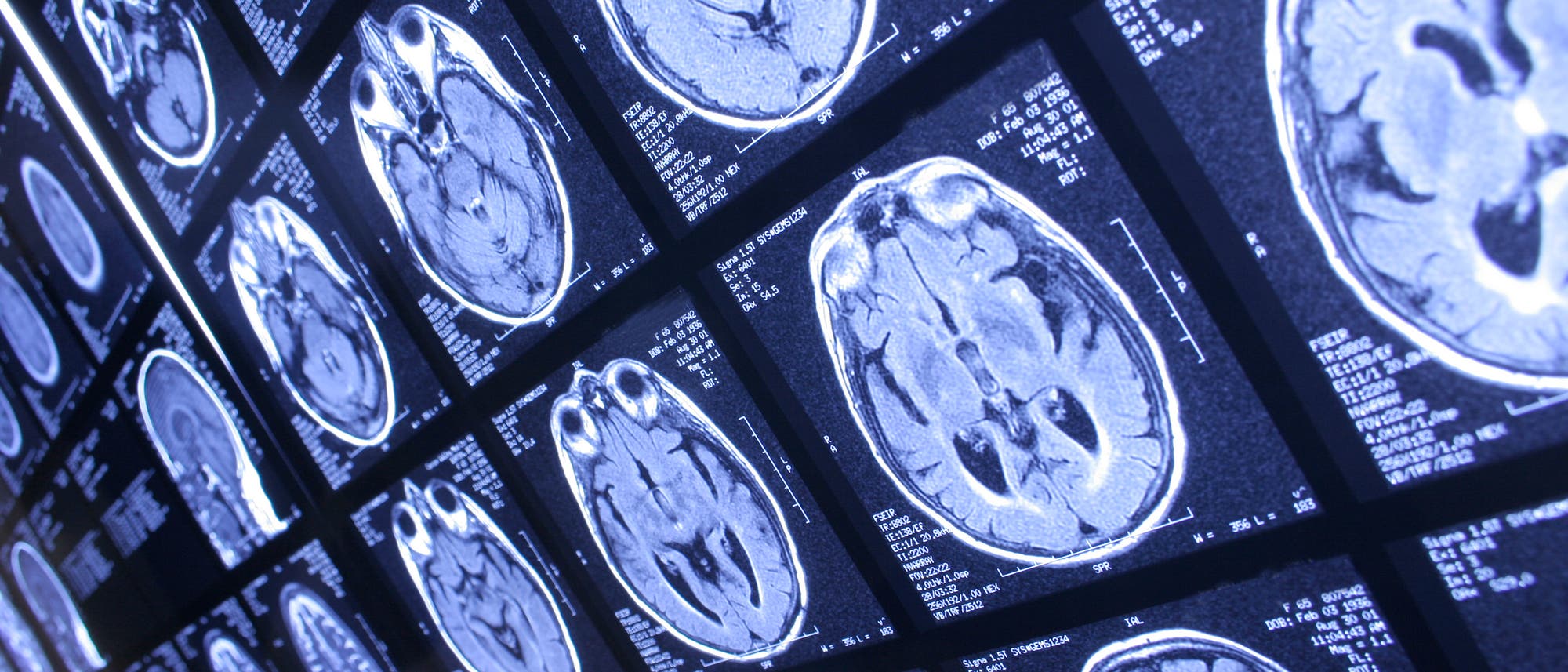
© iStockphoto / Jason Woodcock (Ausschnitt)
Peggy Willocks war 44 Jahre alt, als man bei ihr die Parkinsonkrankheit diagnostizierte. Schnell verschlechterte sich ihr Zustand, und schon vier Jahre später gab sie ihren Beruf als Grundschulleiterin auf. Bald darauf konnte sie kaum noch essen oder durch ihr Zimmer gehen, geschweige denn sich anziehen oder waschen.
Dann entschied sich Willocks, an der Erprobung einer neuartigen Therapie teilzunehmen. Das Verfahren mit dem Namen Spheramine hatte ein kalifornisches Biotechnologieunternehmen, Titan Pharmaceuticals in San Francisco, entwickelt: Im Labor kultivierte Netzhautzellen aus dem Retinaepithel wurden an künstlich hergestellte Trägermoleküle gebunden und in das Gehirn implantiert. Dort sollen sie, so die Hoffnung der Mediziner, Levodopa erzeugen, ein Vorläufermolekül für den Neurotransmitter Dopamin. Er liegt bei Parkinsonpatienten in zu geringen Mengen vor – die implantierten Zellen sollten die Vorräte aufstocken und die Symptome der Erkrankung lindern.
Im August 2000 unterzog sich Willocks als zweite Person überhaupt der Behandlung. Die Ärzte schraubten einen so genannten stereotaktischen Rahmen an ihren Schädel und versetzten sie in Vollnarkose. Das Stahlgerüst um ihren Kopf erlaubte es den Chirurgen, den exakten Punkt für die Bohrung wiederzufinden, wie er zuvor auf der Basis von Magnetresonanztomografien bestimmt worden war. Über einen Katheter führten sie dann die Zellen in das Striatum ein.
Eine Wirkung blieb zunächst aus. Doch dann, nach sechs bis acht Monaten, habe sie sich allmählich besser gefühlt, erzählt Peggy Willocks. Es sei langsam und stetig bergauf gegangen – und einmal, etwa neun Monate nach dem Eingriff, zeigte sich eine sprunghafte, laut ihrem Arzt "radikale" Verbesserung des Gleichgewichtssinns.
Nach nunmehr zehn Jahren bemerkte sie laut eigener Aussage eine erneute Verschlechterung ihres Zustands, aber es gehe ihr noch immer weitaus besser als vor der OP. Zweifel, dass die Behandlung wirkt, hat sie nicht.
Fragliche Wirkung
Forscher sind jedoch ganz anderer Meinung: Spheramine wurde 2008, nach einer Phase-II-Studie, zu den Akten gelegt. Bei einer Doppelblindstudie hatte es sich als nicht wirksamer als eine Placebobehandlung erwiesen [2]. Im Rahmen dieser Studie hatten Forscher die eigentliche Behandlung mit einer Scheingehirnoperation verglichen, die nahezu alle Aspekte der Therapie, die Willocks erhielt, umfasste – bis auf das Einbringen der Zellen ins Gehirn.
Schein-OPs als Kontrolle? Vor allem Wissenschaftler, die diese Therapien entwickeln, halten die Idee für wenig überzeugend. Und das, obwohl sich das Verfahren in den nächsten Jahren noch ausweiten dürfte, da immer häufiger mit stark invasiven Therapien experimentiert werden wird.
Kleinere Verträglichkeitsstudien, wie die, an der Peggy Willocks beteiligt war, können die Wirksamkeit einer Behandlung nahelegen, sie jedoch nicht beweisen. Da sie zudem "offen" sind, weil also sowohl Arzt als auch Patient wissen, dass das Medikament verabreicht wird, unterliegen sie zahllosen neigungsbedingten Einflüssen, die die Ergebnisse verfälschen könnten. "Es ist absolut offensichtlich, dass die Daten aus offenen Studien unzuverlässig sind. Ich kann mir kaum vorstellen, dass seriöse Wissenschaftler ihre Daten oder Hypothesen nicht in Doppelblindstudien geprüft sehen möchten", meint etwa Warren Olanow, ein Neurologe am Mount Sinai Center in New York, der sich seit mehr als zwei Jahrzehnten mit zellbasierten neurochirurgischen Behandlungsmethoden für Parkinson befasst.
Für manche seiner Kollegen sind Scheinoperationen hingegen teure, potenziell gefährliche und womöglich ethisch fragwürdige Possen. Zudem könnten sie unnötig sein. Denn sowohl die Vorgehensweisen als auch die Reaktionen der Patienten variieren in den Vorabstudien erheblich, so dass eigentlich die Behandlungsvorschriften zunächst in weiteren offenen Studien verfeinert werden müssten, bevor man zur nächsten Entwicklungsstufe schreite, sagt der klinische Neurowissenschaftler Roger Barker von der University of Cambridge. Da jedoch Kosten und Komplexität sowie die geringe Anzahl in Frage kommender Probanden solche Studien von vornherein im Umfang beschränken, würden Scheinkontrollen oft nur statistisch unzureichende Ergebnisse bieten.
Kontrolle mit Komplikationen
Barker unterzieht derzeit gemeinsam mit Kollegen aus ganz Europa Patienten im Rahmen einer 12-Millionen-Euro-Studie einer Parkinsonbehandlung mit fötalen dopaminergen Nervenzellen. Für diese Behandlungsmethode wird möglicherweise niemals eine Kontrolle mit Scheinoperationen erfolgen. Historisch gesehen seien Placebokontrollen eine verdienstvolle Praxis, gibt Barker zu. Aber ob sie deshalb auch für neurochirurgische Studien taugen, zweifelt er an. Patienten wie Willocks und andere Betroffene gehen sogar noch einen Schritt weiter: In ihren Augen sind placebokontrollierte Studien nicht nur unnötig, sondern auch ein Hemmschuh für zahlreiche, womöglich wertvolle Behandlungsformen.
In den letzten 25 Jahren haben chirurgische Behandlungsmethoden für die Parkinsonkrankheit einen steinigen Weg zurückgelegt. Im Jahre 1987 beschrieben mexikanische Chirurgen einen durchschlagenden Behandlungserfolg bei zwei schwer an Morbus Parkinson erkrankten Patienten. Die Ärzte hatten ihnen Dopamin erzeugendes Nebennierengewebe transplantiert [3]. In den folgenden Jahren erhielten Hunderte von Patienten die gleiche Behandlung, von denen einige später einer Autopsie unterzogen wurden. Dabei stelte sich heraus, dass bei ihnen die Zellen überhaupt nicht überlebt hatten [4].
Schmierentheater im OP
Scheineingriffe am Gehirn sind keine Zuckerpillen. Sobald der stereotaktische Rahmen am Kopf befestigt ist, wird der Patient normalerweise betäubt, und die Chirurgen bohren durch die Schädeldecke. In den meisten Fällen enden die Bohrlöcher an der Dura Mater, der schützenden äußersten Hirnhaut. Manchmal reichen sie jedoch tiefer: In einer Phase-II-Prüfung zur Erprobung des Nervenwachstumsfaktors GDNF legten die Forscher allen Teilnehmern Katheter, injizierten bei den Kontrollpatienten jedoch nur eine Salzlösung statt GDNF [9].
"Wir müssen alles so vortäuschen, dass von außen überhaupt nicht erkennbar ist, ob es sich um die echte Operation handelt", erklärt Joao Siffert, medizinischer Leiter bei Ceregene, einem kalifornischen Unternehmen in San Diego, das eine Behandlungsmethode entwickelt, die mit Hilfe eines viralen Vektors das Gen für einen Nervenwachstumsfaktor namens Neurturin liefert. In der Regel müssen bei Scheinoperationen alle im Operationssaal, vom Chirurgen bis zum Hilfspersonal, so tun, als seien sie voll mit der Operation beschäftigt. Teilweise werden sogar Geräte eingeschaltet, um die entsprechende Geräuschkulisse beizusteuern. Ein hochkomplizierter Ablaufplan stellt sicher, dass niemand außerhalb des Operationsteams erfährt, wer welche Behandlung erhielt. "Es ist furchtbar kompliziert", sagt Siffert, man könne kaum alles gleichzeitig im Blick behalten.
All das treibt die Kosten in die Höhe. Siffert schätzt, dass sich eine 50-Patienten-Studie inklusive der Kosten für den Operationssaal, Nachbehandlung und die aufwändige Infrastruktur für die Datenverwaltung im Bereich von 7 Millionen Euro bewegt.
Mehrheit für Scheinoperationen
Zumindest in Nordamerika befürwortet jedoch laut einer Umfrage aus dem Jahr 2004 mit 94 Prozent immer noch die überwältigende Mehrheit der Parkinsonforscher den Einsatz von Scheinoperationen [10]. Etwa 20 Prozent vertreten die Meinung, dass dazu ein Eingriff am Gehirn gerechtfertigt sei. Die Befürworter halten das Verfahren zudem für relativ sicher. Die Risiken bei einer Scheinoperation entstehen insbesondere durch die damit verbundene Vollnarkose. Im Gegensatz zu den Risiken beim tatsächlichen Eingriff seien jedoch nahezu keine negativen Vorfälle bekannt. Den Teilnehmern in den Scheingruppen wird grundsätzlich die echte Behandlung zugesagt, falls diese sich am Ende als wirksam erweist. Das Therapeutikum kann in diesem Fall relativ unkompliziert durch die vorhandene Bohrung im Schädel verabreicht werden.
Placeboeffekte und Verfälschungen auszuschließen, ist gerade bei Parkinsonerkrankungen ein zentrales Problem, denn hier ist der Placeboeffekt besonders stark. Die Aussicht auf eine Besserung durch die Behandlung regt nämlich die Ausschüttung von Dopamin an – also genau jenes Neurotransmitters, an dem es den Kranken mangelt [11].
"Der Placeboeffekt ist kein Hirngespinst, sondern real, ausgeprägt und er hat eine physiologische Basis", erklärt Jon Stoessl, der als Neurologe an der kanadischen University of British Columbia in Vancouver den Placeboeffekt bei Parkinsonpatienten erforscht. Das zeige sich zum Beispiel an einer Doppelblindstudie zur Nervenzelltransplantation, bei der die Besserung der Teilnehmer vor allem mit der Überzeugung korrelierte, dass sie die echte Behandlung erhalten hatten – unabhängig davon, ob dies wirklich der Fall war [12]. Bis zu zwei Jahre könne dieser Effekt anhalten, habe eine bislang unveröffentlichte Untersuchung seiner Kollegen ergeben, berichtet Stoessl.
Viele betrachten jedoch Voreingenommenheit als maßgeblicheren Störfaktor. "Forscher haben ein starkes, begründetes Interesse daran, dass sich ihre Behandlungsmethode als erfolgreich erweist", erklärt Anthony Lang, Neurologe an der kanadischen University of Toronto, der an mehreren neurochirurgischen Studien zu experimentellen Parkinsontherapien beteiligt war. Eine solche Voreingenommenheit beeinflusse die Forscher bei der Bewertung des Gesundheitszustands ihrer Patienten, und lasse sie gleichzeitig die Erwartung der Patienten hochschrauben, wodurch der Placeboeffekt weiter verstärkt wird.
Maximum widriger Umstände
Ein zusätzliches Problem der Parkinsonforschung ergibt sich aus der Tatsache, dass keine objektiven Messgrößen für das Wohlbefinden eines Patienten verfügbar sind. "Im Endeffekt ist es ein Maximum an widrigen Umständen, das uns den Blick auf die zu Grunde liegende Erkrankung verstellt", meint Steven Piantadosi, der als Methodiker für klinische Prüfungen im kalifornischen Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles arbeitet. "Ordentlich ausgeführte Scheinoperationen können hier als Kontrolle dienen."
Die Voreingenommenheit könne man aber in offenen Studien ausschalten, hält Barker dagegen, indem man beispielsweise die Patienten durch verblindete Bewerter beurteilen lässt. Seine Haltung ist typisch für viele Mediziner in Europa, wo Scheinoperationen mit viel größeren Vorbehalten betrachtet werden als in den Vereinigten Staaten. Im Vereinigten Königreich wurden sie sogar noch nie eingesetzt. Barker ist fest davon überzeugt, dass die Transplantation fötalen Gewebes zumindest einigen Patienten hilft. "Ich brauche keine Scheinoperationen, um das zu zeigen", erklärt er und verweist stattdessen auf eine letztes Jahr veröffentlichte Arbeit, in der zwei Patienten beschrieben werden, deren Behandlung 13 und 16 Jahre zurückliegt und die noch immer positive Effekte zeigen [13]. Ihre Gehirne wiesen außerdem aktive Dopamin erzeugende Neurone am Transplantationspunkt auf.
Dass vergangene Studien gemischte Ergebnisse lieferten, führt Barker stattdessen auf Unterschiede bei der Probandenwahl sowie auf Eigenschaften des implantierten Gewebes und die Implantationsmethoden zurück. Seine kommende Studie wird, um Skeptiker überzeugen zu können, nicht nur die Wirksamkeit der Therapie demonstrieren, sondern auch die zuvor beobachteten Nebenwirkungen ausschließen müssen. Dazu bedürfe es gewiss einer Kontrollstudie, meint Barker. Diese sollte aber eher im Vergleich mit einer als wirksam anerkannten Behandlungsmethode bestehen, wie etwa der tiefen Hirnstimulation.
Kommt Zeit, kommt Rat
Der beste Beweis für die Wirksamkeit, so Barker, komme jedoch mit der Zeit. Die meisten Studien enden bereits ein Jahr nach der Behandlung. Das könnte zu kurz gefasst sein: Implantierte Zellen oder injizierte Wachstumsfaktoren benötigen vielleicht länger, um voll funktionsfähig zu werden, und der Placeboeffekt ist bis dahin möglicherweise noch nicht abgeklungen. "Lieber wäre uns ein Ende nach drei bis fünf Jahren", erklärt der Forscher.
Einige der gescheiterten Phase-II-Studien haben Hinweise auf solche Spätfolgen geliefert: Patienten, die nach Studienende weiter betreut wurden, hatten mitunter Positiveres zu berichten als zuvor&nsbp;[4]. So könnten Scheinoperationen die Nützlichkeit eines Medikaments unterbewerten. Der Neurowissenschaftler Anders Björklund von der schwedischen Lund-Universität, der mit Barker zusammenarbeitet, ist ähnlicher Meinung. Bei Scheinoperationen liefen Forscher Gefahr, viel zu früh eine Strategie aufzugeben, wenn ihre Studie an technischen oder methodischen Unzulänglichkeiten scheitert, selbst wenn die Unwirksamkeit noch gar nicht erwiesen ist.
Laut Perry Cohen, dem Leiter des Patientennetzwerks "Parkinson Pipeline Project", ist genau das der Fall. Er habe die Notwendigkeit von Scheinoperationen schon immer in Frage gestellt, erklärt er, aber seitdem sich Phase-II-Fehlschläge häufen "sagen wir: 'Das ist ein echtes Problem. Diese Studien sind gescheitert, aber wir wissen, dass die Methode bei einigen Leuten funktioniert'".
Andere Prioritäten
Für Forscher ist es einfach, solche Einwände von Betroffenen als gefühlsbetont abzutun. "Patienten wollen Heilverfahren", meint Anthony Lang, "und neigen dazu, besonders die aggressiveren, chirurgischen Eingriffen für wirkungsvoller zu halten." Doch wenn Patienten andere Prioritäten setzen, müssten Forscher das berücksichtigen, wendet Cohen ein: Placebokontrollen sollen falsch positive Ergebnisse ausfiltern. Der Alptraum der Patienten sind jedoch die falsch negativen. Sie verurteilen eine Therapie zum Scheitern, bevor sie optimiert wurde.
Das Fatale: Je besser eine Studie die Ersteren ausmerzt, desto höher ist ihr Anteil an Letzteren. Im besten Fall führt das nur zu Verzögerungen; schlimmstenfalls jedoch in eine Sackgasse. Spheramine liegt laut Cohen "immer noch irgendwo im Regal". Ein weiteres Beispiel ist Amgens Phase-II-Studie für GDNF. Der Test wurde 2004 wegen dürftiger Ergebnisse und möglicher Sicherheitsrisiken eingestellt – was von einigen eher auf Amgens Vorgehensweise und nicht auf die Therapie selbst zurückgeführt wird. Jetzt ist das Interesse der Forscher an dem Molekül neu erwacht – eine zweite Chance, über die sich Cohen zwar freut, "aber wir haben auch sechs Jahre verloren".
Patienten hätten darüber hinaus ein ganz anderes Risikoverständnis als Forscher, erklärt Cohen. Er erzählt von Tom Intili, der im Alter von 50 Jahren, als er bereits zehn Jahre an Parkinson litt, an einer doppelblinden, placebokontrollierten Prüfung von Neurturin teilnahm. Intilis Zustand verbesserte sich zunächst dramatisch. Als jedoch die Resultate veröffentlicht wurden, erfuhr er, dass er nur eine Scheinbehandlung erhalten hatte. Sein Befinden verschlechterte sich so sehr, dass er schwächer war, als vor dem Eingriff. "Wir können die psychologische Wirkung der Entblindung einfach nicht einschätzen", meint Cohen.
Erwünschter Nebeneffekt
Zudem sei der Versuch, den Placeboeffekt auszuschließen, schlicht fehlgeleitet. "Ich möchte den Placeboeffekt gar nicht ausfiltern, sondern ihn behalten. Im richtigen Leben ist er Teil der Behandlung", betont Cohen. Da psychologische Faktoren bei Parkinson eine so entscheidende Rolle spielen, könnte eine Placeboreaktion eine Therapie sogar noch wirksamer machen. "Ich lasse mich gerne überzeugen, dass Scheinoperationen erforderlich sind. Ich suche nach Argumenten, um meine Meinung zu ändern. Aber ich habe bisher noch keine gefunden", sagt Cohen.
Willocks sieht sich selbst als lebendes Beispiel dafür, dass einige in der Versenkung verschwundene Therapien noch zu retten wären. Doch ein Fall wie der ihre ist aus wissenschaftlicher Sicht bestenfalls eine Anekdote. Er liefert nicht die belastbaren Daten, die Forscher überzeugen würden. Im Mai wurde die gescheiterte Phase-II-Studie über Spheramine, also über die Behandlung, die sie vor einem Jahrzehnt erhalten hatte, endlich veröffentlicht [2]. Der Bericht schließt mit einer Warnung über die Gefahren des Placeboeffekts und stellt heraus, wie wichtig es ist, die Ergebnisse mit einer Doppelblindstudie zu überprüfen. "Dieser letzte Absatz macht mir Sorgen", erklärt Peggy Willocks. "Ich verstehe nicht, wie sie das nach zehn Jahren immer noch als Placeboeffekt bezeichnen können."
Dann entschied sich Willocks, an der Erprobung einer neuartigen Therapie teilzunehmen. Das Verfahren mit dem Namen Spheramine hatte ein kalifornisches Biotechnologieunternehmen, Titan Pharmaceuticals in San Francisco, entwickelt: Im Labor kultivierte Netzhautzellen aus dem Retinaepithel wurden an künstlich hergestellte Trägermoleküle gebunden und in das Gehirn implantiert. Dort sollen sie, so die Hoffnung der Mediziner, Levodopa erzeugen, ein Vorläufermolekül für den Neurotransmitter Dopamin. Er liegt bei Parkinsonpatienten in zu geringen Mengen vor – die implantierten Zellen sollten die Vorräte aufstocken und die Symptome der Erkrankung lindern.
Im August 2000 unterzog sich Willocks als zweite Person überhaupt der Behandlung. Die Ärzte schraubten einen so genannten stereotaktischen Rahmen an ihren Schädel und versetzten sie in Vollnarkose. Das Stahlgerüst um ihren Kopf erlaubte es den Chirurgen, den exakten Punkt für die Bohrung wiederzufinden, wie er zuvor auf der Basis von Magnetresonanztomografien bestimmt worden war. Über einen Katheter führten sie dann die Zellen in das Striatum ein.
Eine Wirkung blieb zunächst aus. Doch dann, nach sechs bis acht Monaten, habe sie sich allmählich besser gefühlt, erzählt Peggy Willocks. Es sei langsam und stetig bergauf gegangen – und einmal, etwa neun Monate nach dem Eingriff, zeigte sich eine sprunghafte, laut ihrem Arzt "radikale" Verbesserung des Gleichgewichtssinns.
Historisch gesehen sind Placebokontrollen eine verdienstvolle Praxis. Aber taugen sie deshalb auch für neurochirurgische Studien?
Ein Jahr nach der Behandlung hatten sich die motorischen Fähigkeiten von Willocks und fünf weiteren Teilnehmern dieser Phase-I-Studie um 48 Prozent verbessert. Diese Werte hatten auch vier Jahre später noch weit gehend Bestand [1]. Nach nunmehr zehn Jahren bemerkte sie laut eigener Aussage eine erneute Verschlechterung ihres Zustands, aber es gehe ihr noch immer weitaus besser als vor der OP. Zweifel, dass die Behandlung wirkt, hat sie nicht.
Fragliche Wirkung
Forscher sind jedoch ganz anderer Meinung: Spheramine wurde 2008, nach einer Phase-II-Studie, zu den Akten gelegt. Bei einer Doppelblindstudie hatte es sich als nicht wirksamer als eine Placebobehandlung erwiesen [2]. Im Rahmen dieser Studie hatten Forscher die eigentliche Behandlung mit einer Scheingehirnoperation verglichen, die nahezu alle Aspekte der Therapie, die Willocks erhielt, umfasste – bis auf das Einbringen der Zellen ins Gehirn.
Schein-OPs als Kontrolle? Vor allem Wissenschaftler, die diese Therapien entwickeln, halten die Idee für wenig überzeugend. Und das, obwohl sich das Verfahren in den nächsten Jahren noch ausweiten dürfte, da immer häufiger mit stark invasiven Therapien experimentiert werden wird.
Kleinere Verträglichkeitsstudien, wie die, an der Peggy Willocks beteiligt war, können die Wirksamkeit einer Behandlung nahelegen, sie jedoch nicht beweisen. Da sie zudem "offen" sind, weil also sowohl Arzt als auch Patient wissen, dass das Medikament verabreicht wird, unterliegen sie zahllosen neigungsbedingten Einflüssen, die die Ergebnisse verfälschen könnten. "Es ist absolut offensichtlich, dass die Daten aus offenen Studien unzuverlässig sind. Ich kann mir kaum vorstellen, dass seriöse Wissenschaftler ihre Daten oder Hypothesen nicht in Doppelblindstudien geprüft sehen möchten", meint etwa Warren Olanow, ein Neurologe am Mount Sinai Center in New York, der sich seit mehr als zwei Jahrzehnten mit zellbasierten neurochirurgischen Behandlungsmethoden für Parkinson befasst.
Für manche seiner Kollegen sind Scheinoperationen hingegen teure, potenziell gefährliche und womöglich ethisch fragwürdige Possen. Zudem könnten sie unnötig sein. Denn sowohl die Vorgehensweisen als auch die Reaktionen der Patienten variieren in den Vorabstudien erheblich, so dass eigentlich die Behandlungsvorschriften zunächst in weiteren offenen Studien verfeinert werden müssten, bevor man zur nächsten Entwicklungsstufe schreite, sagt der klinische Neurowissenschaftler Roger Barker von der University of Cambridge. Da jedoch Kosten und Komplexität sowie die geringe Anzahl in Frage kommender Probanden solche Studien von vornherein im Umfang beschränken, würden Scheinkontrollen oft nur statistisch unzureichende Ergebnisse bieten.
Kontrolle mit Komplikationen
Barker unterzieht derzeit gemeinsam mit Kollegen aus ganz Europa Patienten im Rahmen einer 12-Millionen-Euro-Studie einer Parkinsonbehandlung mit fötalen dopaminergen Nervenzellen. Für diese Behandlungsmethode wird möglicherweise niemals eine Kontrolle mit Scheinoperationen erfolgen. Historisch gesehen seien Placebokontrollen eine verdienstvolle Praxis, gibt Barker zu. Aber ob sie deshalb auch für neurochirurgische Studien taugen, zweifelt er an. Patienten wie Willocks und andere Betroffene gehen sogar noch einen Schritt weiter: In ihren Augen sind placebokontrollierte Studien nicht nur unnötig, sondern auch ein Hemmschuh für zahlreiche, womöglich wertvolle Behandlungsformen.
In den letzten 25 Jahren haben chirurgische Behandlungsmethoden für die Parkinsonkrankheit einen steinigen Weg zurückgelegt. Im Jahre 1987 beschrieben mexikanische Chirurgen einen durchschlagenden Behandlungserfolg bei zwei schwer an Morbus Parkinson erkrankten Patienten. Die Ärzte hatten ihnen Dopamin erzeugendes Nebennierengewebe transplantiert [3]. In den folgenden Jahren erhielten Hunderte von Patienten die gleiche Behandlung, von denen einige später einer Autopsie unterzogen wurden. Dabei stelte sich heraus, dass bei ihnen die Zellen überhaupt nicht überlebt hatten [4].
"Wir müssen alles so vortäuschen, dass von außen überhaupt nicht erkennbar ist, ob es sich um die echte Operation handelt."
Joao Siffert
Etwa zeitgleich begannen Forscher in klein angelegten Studien, fötale Nervenzellen zu transplantieren. Die Ergebnisse waren gemischt, aber durchaus viel versprechend – bis schließlich zwei Studien erschienen, in denen die Transplantation mit Scheinoperationen verglichen wurde. Ergebnis: Die Transplantationen seien nicht nur wirkungslos, sondern sogar schädlich, weil sie häufig Dyskinesie verursachten [5, 6]. An dieser Form der Bewegungsstörung leiden viele Parkinsonpatienten. Auf ähnliche Weise scheiterten in den letzten sieben Jahren einschließlich Spheramine drei experimentelle Behandlungsmethoden, die in kleinen, offenen Studien zunächst viel versprechend aussahen [1, 7, 8], an Phase-II-Untersuchungen beim Vergleich mit Scheinkontrollen [2, 4, 9]. Joao Siffert
Schmierentheater im OP
Scheineingriffe am Gehirn sind keine Zuckerpillen. Sobald der stereotaktische Rahmen am Kopf befestigt ist, wird der Patient normalerweise betäubt, und die Chirurgen bohren durch die Schädeldecke. In den meisten Fällen enden die Bohrlöcher an der Dura Mater, der schützenden äußersten Hirnhaut. Manchmal reichen sie jedoch tiefer: In einer Phase-II-Prüfung zur Erprobung des Nervenwachstumsfaktors GDNF legten die Forscher allen Teilnehmern Katheter, injizierten bei den Kontrollpatienten jedoch nur eine Salzlösung statt GDNF [9].
"Wir müssen alles so vortäuschen, dass von außen überhaupt nicht erkennbar ist, ob es sich um die echte Operation handelt", erklärt Joao Siffert, medizinischer Leiter bei Ceregene, einem kalifornischen Unternehmen in San Diego, das eine Behandlungsmethode entwickelt, die mit Hilfe eines viralen Vektors das Gen für einen Nervenwachstumsfaktor namens Neurturin liefert. In der Regel müssen bei Scheinoperationen alle im Operationssaal, vom Chirurgen bis zum Hilfspersonal, so tun, als seien sie voll mit der Operation beschäftigt. Teilweise werden sogar Geräte eingeschaltet, um die entsprechende Geräuschkulisse beizusteuern. Ein hochkomplizierter Ablaufplan stellt sicher, dass niemand außerhalb des Operationsteams erfährt, wer welche Behandlung erhielt. "Es ist furchtbar kompliziert", sagt Siffert, man könne kaum alles gleichzeitig im Blick behalten.
All das treibt die Kosten in die Höhe. Siffert schätzt, dass sich eine 50-Patienten-Studie inklusive der Kosten für den Operationssaal, Nachbehandlung und die aufwändige Infrastruktur für die Datenverwaltung im Bereich von 7 Millionen Euro bewegt.
Mehrheit für Scheinoperationen
Zumindest in Nordamerika befürwortet jedoch laut einer Umfrage aus dem Jahr 2004 mit 94 Prozent immer noch die überwältigende Mehrheit der Parkinsonforscher den Einsatz von Scheinoperationen [10]. Etwa 20 Prozent vertreten die Meinung, dass dazu ein Eingriff am Gehirn gerechtfertigt sei. Die Befürworter halten das Verfahren zudem für relativ sicher. Die Risiken bei einer Scheinoperation entstehen insbesondere durch die damit verbundene Vollnarkose. Im Gegensatz zu den Risiken beim tatsächlichen Eingriff seien jedoch nahezu keine negativen Vorfälle bekannt. Den Teilnehmern in den Scheingruppen wird grundsätzlich die echte Behandlung zugesagt, falls diese sich am Ende als wirksam erweist. Das Therapeutikum kann in diesem Fall relativ unkompliziert durch die vorhandene Bohrung im Schädel verabreicht werden.
Placeboeffekte und Verfälschungen auszuschließen, ist gerade bei Parkinsonerkrankungen ein zentrales Problem, denn hier ist der Placeboeffekt besonders stark. Die Aussicht auf eine Besserung durch die Behandlung regt nämlich die Ausschüttung von Dopamin an – also genau jenes Neurotransmitters, an dem es den Kranken mangelt [11].
"Der Placeboeffekt ist kein Hirngespinst, sondern real, ausgeprägt und er hat eine physiologische Basis", erklärt Jon Stoessl, der als Neurologe an der kanadischen University of British Columbia in Vancouver den Placeboeffekt bei Parkinsonpatienten erforscht. Das zeige sich zum Beispiel an einer Doppelblindstudie zur Nervenzelltransplantation, bei der die Besserung der Teilnehmer vor allem mit der Überzeugung korrelierte, dass sie die echte Behandlung erhalten hatten – unabhängig davon, ob dies wirklich der Fall war [12]. Bis zu zwei Jahre könne dieser Effekt anhalten, habe eine bislang unveröffentlichte Untersuchung seiner Kollegen ergeben, berichtet Stoessl.
Viele betrachten jedoch Voreingenommenheit als maßgeblicheren Störfaktor. "Forscher haben ein starkes, begründetes Interesse daran, dass sich ihre Behandlungsmethode als erfolgreich erweist", erklärt Anthony Lang, Neurologe an der kanadischen University of Toronto, der an mehreren neurochirurgischen Studien zu experimentellen Parkinsontherapien beteiligt war. Eine solche Voreingenommenheit beeinflusse die Forscher bei der Bewertung des Gesundheitszustands ihrer Patienten, und lasse sie gleichzeitig die Erwartung der Patienten hochschrauben, wodurch der Placeboeffekt weiter verstärkt wird.
Maximum widriger Umstände
Ein zusätzliches Problem der Parkinsonforschung ergibt sich aus der Tatsache, dass keine objektiven Messgrößen für das Wohlbefinden eines Patienten verfügbar sind. "Im Endeffekt ist es ein Maximum an widrigen Umständen, das uns den Blick auf die zu Grunde liegende Erkrankung verstellt", meint Steven Piantadosi, der als Methodiker für klinische Prüfungen im kalifornischen Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles arbeitet. "Ordentlich ausgeführte Scheinoperationen können hier als Kontrolle dienen."
Die Voreingenommenheit könne man aber in offenen Studien ausschalten, hält Barker dagegen, indem man beispielsweise die Patienten durch verblindete Bewerter beurteilen lässt. Seine Haltung ist typisch für viele Mediziner in Europa, wo Scheinoperationen mit viel größeren Vorbehalten betrachtet werden als in den Vereinigten Staaten. Im Vereinigten Königreich wurden sie sogar noch nie eingesetzt. Barker ist fest davon überzeugt, dass die Transplantation fötalen Gewebes zumindest einigen Patienten hilft. "Ich brauche keine Scheinoperationen, um das zu zeigen", erklärt er und verweist stattdessen auf eine letztes Jahr veröffentlichte Arbeit, in der zwei Patienten beschrieben werden, deren Behandlung 13 und 16 Jahre zurückliegt und die noch immer positive Effekte zeigen [13]. Ihre Gehirne wiesen außerdem aktive Dopamin erzeugende Neurone am Transplantationspunkt auf.
Dass vergangene Studien gemischte Ergebnisse lieferten, führt Barker stattdessen auf Unterschiede bei der Probandenwahl sowie auf Eigenschaften des implantierten Gewebes und die Implantationsmethoden zurück. Seine kommende Studie wird, um Skeptiker überzeugen zu können, nicht nur die Wirksamkeit der Therapie demonstrieren, sondern auch die zuvor beobachteten Nebenwirkungen ausschließen müssen. Dazu bedürfe es gewiss einer Kontrollstudie, meint Barker. Diese sollte aber eher im Vergleich mit einer als wirksam anerkannten Behandlungsmethode bestehen, wie etwa der tiefen Hirnstimulation.
Kommt Zeit, kommt Rat
Der beste Beweis für die Wirksamkeit, so Barker, komme jedoch mit der Zeit. Die meisten Studien enden bereits ein Jahr nach der Behandlung. Das könnte zu kurz gefasst sein: Implantierte Zellen oder injizierte Wachstumsfaktoren benötigen vielleicht länger, um voll funktionsfähig zu werden, und der Placeboeffekt ist bis dahin möglicherweise noch nicht abgeklungen. "Lieber wäre uns ein Ende nach drei bis fünf Jahren", erklärt der Forscher.
Einige der gescheiterten Phase-II-Studien haben Hinweise auf solche Spätfolgen geliefert: Patienten, die nach Studienende weiter betreut wurden, hatten mitunter Positiveres zu berichten als zuvor&nsbp;[4]. So könnten Scheinoperationen die Nützlichkeit eines Medikaments unterbewerten. Der Neurowissenschaftler Anders Björklund von der schwedischen Lund-Universität, der mit Barker zusammenarbeitet, ist ähnlicher Meinung. Bei Scheinoperationen liefen Forscher Gefahr, viel zu früh eine Strategie aufzugeben, wenn ihre Studie an technischen oder methodischen Unzulänglichkeiten scheitert, selbst wenn die Unwirksamkeit noch gar nicht erwiesen ist.
Laut Perry Cohen, dem Leiter des Patientennetzwerks "Parkinson Pipeline Project", ist genau das der Fall. Er habe die Notwendigkeit von Scheinoperationen schon immer in Frage gestellt, erklärt er, aber seitdem sich Phase-II-Fehlschläge häufen "sagen wir: 'Das ist ein echtes Problem. Diese Studien sind gescheitert, aber wir wissen, dass die Methode bei einigen Leuten funktioniert'".
Andere Prioritäten
Für Forscher ist es einfach, solche Einwände von Betroffenen als gefühlsbetont abzutun. "Patienten wollen Heilverfahren", meint Anthony Lang, "und neigen dazu, besonders die aggressiveren, chirurgischen Eingriffen für wirkungsvoller zu halten." Doch wenn Patienten andere Prioritäten setzen, müssten Forscher das berücksichtigen, wendet Cohen ein: Placebokontrollen sollen falsch positive Ergebnisse ausfiltern. Der Alptraum der Patienten sind jedoch die falsch negativen. Sie verurteilen eine Therapie zum Scheitern, bevor sie optimiert wurde.
Das Fatale: Je besser eine Studie die Ersteren ausmerzt, desto höher ist ihr Anteil an Letzteren. Im besten Fall führt das nur zu Verzögerungen; schlimmstenfalls jedoch in eine Sackgasse. Spheramine liegt laut Cohen "immer noch irgendwo im Regal". Ein weiteres Beispiel ist Amgens Phase-II-Studie für GDNF. Der Test wurde 2004 wegen dürftiger Ergebnisse und möglicher Sicherheitsrisiken eingestellt – was von einigen eher auf Amgens Vorgehensweise und nicht auf die Therapie selbst zurückgeführt wird. Jetzt ist das Interesse der Forscher an dem Molekül neu erwacht – eine zweite Chance, über die sich Cohen zwar freut, "aber wir haben auch sechs Jahre verloren".
Patienten hätten darüber hinaus ein ganz anderes Risikoverständnis als Forscher, erklärt Cohen. Er erzählt von Tom Intili, der im Alter von 50 Jahren, als er bereits zehn Jahre an Parkinson litt, an einer doppelblinden, placebokontrollierten Prüfung von Neurturin teilnahm. Intilis Zustand verbesserte sich zunächst dramatisch. Als jedoch die Resultate veröffentlicht wurden, erfuhr er, dass er nur eine Scheinbehandlung erhalten hatte. Sein Befinden verschlechterte sich so sehr, dass er schwächer war, als vor dem Eingriff. "Wir können die psychologische Wirkung der Entblindung einfach nicht einschätzen", meint Cohen.
Erwünschter Nebeneffekt
Zudem sei der Versuch, den Placeboeffekt auszuschließen, schlicht fehlgeleitet. "Ich möchte den Placeboeffekt gar nicht ausfiltern, sondern ihn behalten. Im richtigen Leben ist er Teil der Behandlung", betont Cohen. Da psychologische Faktoren bei Parkinson eine so entscheidende Rolle spielen, könnte eine Placeboreaktion eine Therapie sogar noch wirksamer machen. "Ich lasse mich gerne überzeugen, dass Scheinoperationen erforderlich sind. Ich suche nach Argumenten, um meine Meinung zu ändern. Aber ich habe bisher noch keine gefunden", sagt Cohen.
Willocks sieht sich selbst als lebendes Beispiel dafür, dass einige in der Versenkung verschwundene Therapien noch zu retten wären. Doch ein Fall wie der ihre ist aus wissenschaftlicher Sicht bestenfalls eine Anekdote. Er liefert nicht die belastbaren Daten, die Forscher überzeugen würden. Im Mai wurde die gescheiterte Phase-II-Studie über Spheramine, also über die Behandlung, die sie vor einem Jahrzehnt erhalten hatte, endlich veröffentlicht [2]. Der Bericht schließt mit einer Warnung über die Gefahren des Placeboeffekts und stellt heraus, wie wichtig es ist, die Ergebnisse mit einer Doppelblindstudie zu überprüfen. "Dieser letzte Absatz macht mir Sorgen", erklärt Peggy Willocks. "Ich verstehe nicht, wie sie das nach zehn Jahren immer noch als Placeboeffekt bezeichnen können."





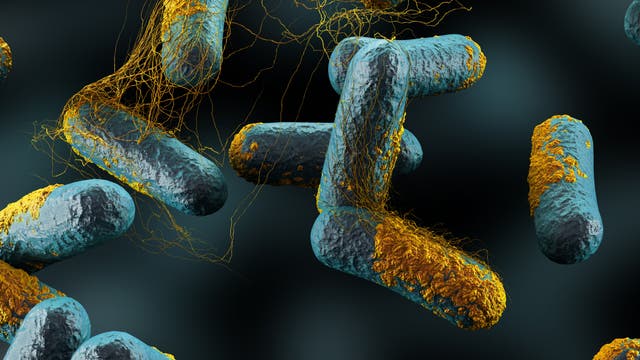
Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben