News: Elterlicher Einfluss
Ein Gen vom Papa, ein Gen von der Mama: Sprösslinge sind ein Mosaik von Erbanlagen ihrer Eltern. Je nach Herkunft kommen die Gene im neuen Individuum unterschiedlich zum Zuge. Experimente mit Mäusezellen zeigen, dass das väterliche Erbe sogar den fatalen Schritt zur Krebszelle beeinflusst.

© Bild (Ausschnitt)
Alles zusammengeworfen, kräftig gemischt und dann wieder neu verteilt: Sexuelle Fortpflanzung erinnert irgendwie an ein Kartenspiel, bei dem mit jeder Runde viele Möglichkeiten und neues Glück offenstehen. Natürlich gelten ein paar besondere Regeln, die sich bei Skat oder Rommé nicht wiederfinden. Dazu gehört beispielsweise, dass nur sich entsprechende Pärchen ausgegeben werden, von denen letztendlich immer eins zur Seite gelegt wird.
Diese Regel ist ganz besonders wichtig, wenn es um die Rolle der beiden Elternteile geht. Denn dadurch drücken sie dem genetisch bunt gemischten Nachwuchs ihren speziellen Stempel auf: Stammt ein Gen von der Mutter, gehorcht es oftmals anderen Regeln als das entsprechende Exemplar vom Vater, indem es beispielsweise still bleibt, während sein Gegenstück überaus aktiv wäre oder umgekehrt. Solche Gene mit genomischer Prägung verleihen den "nackten" genetischen Grundlagen eines Lebewesens einen eigenen zwar ererbten, aber doch individuellen Anstrich.
Doch ist diese Prägung im Laufe eines Zelllebens nicht unveränderlich und geht gerade bei der Entartung zu Krebszellen häufig verloren – während der Zellteilung normalerweise schweigende Gene werden plötzlich aktiv und andere, die solche Eskapaden sonst streng unter Kontrolle hatten, wählen plötzlich den Ruhestand, mit entsprechend schlimmen Folgen. Lidia Hernandez vom National Cancer Institute und ihren Kollegen war daher daran gelegen, den Einfluss väterlichen und mütterlichen Erbguts auf die Zellteilung und das Altern der Zellen aufzugliedern und so auch den jeweiligen Beitrag zur Krebszellentstehung abzuschätzen.
Sie untersuchten Fibroblasten-Zelllinien von Mäusen, da diese erste Differenzierungsschritte schon hinter sich gebracht haben und sich leicht kultivieren lassen. Um sicherzugehen, dass sie jeweils nur die Prägung eines Elternteils erfassten, entwickelten die Wissenschaftler parthenogenetische und androgenetische Zellen, also Zellen, deren Erbgut rein der Mutter beziehungsweise dem Vater entstammt. Deren weiteres Schicksal verglichen sie dann mit Fibroblasten, deren Genom sowohl väterliche als auch mütterliche Anteile aufwies.
Die Unterschiede waren überraschend deutlich und lassen sich kurz zusammenfassen mit: Vaterns Einfluss drängt zu Eile und Wandel, die Mutter zu Ruhe und Vergänglichkeit. Denn im Einzelnen stellten die Forscher fest, dass ein Zellteilungszyklus bei Zellen mit rein mütterlichem Erbgut genauso lange dauerte wie bei gemischtem Genom, während er bei Zellen mit väterlichem Erbgut in halber Zeit ablief.
Alle Zelltypen durchliefen außerdem zunächst eine Art "Jugendphase" mit eifriger Vermehrung, mit zunehmender Reife jedoch ließ das Teilungsgeschehen nach. Während die normalen Zellen erst nach einigen weiteren geruhsameren Zyklen begannen abzusterben, ereilte die parthenogenetischen Zellen dieses Schicksal bereits sehr viel früher. Ganz anders hingegen die androgenetischen Zellen: Als ob sie die Reifephase nur zu einem kurzem Durchatmen genutzt hatten, legten sie noch einmal richtig los und teilten sich wieder kräftig. Und hierbei geschah auch das Erschreckende: Sie begannen, sich zu verändern und riefen, eingepflanzt in junge Mäuse, Tumoren hervor.
Auf der Suche nach den verantwortlichen Genen wurden die Forscher schnell fündig. Während sie in den parthenogenetischen Zellen zwei Gene nachweisen konnten, deren Produkte als Bremsklötze bei der Zellteilung wirken, stießen sie in den androgenetischen Zellen auf den insulinähnlichen Wachstumsfaktor 2 (IGF-2) als Schuldigen für die Entartung der Zellen. Wie allerdings genau das Polypeptid jenen Wandel bewerkstelligt, bleibt noch unklar, zumal in anderen Experimente an Tieren ein erhöhtes Angebot an IGF-2 keine krebsauslösende Wirkung nachzuweisen war.
Diese Ergebnisse zeigen nicht nur, wie unterschiedlich der Einfluss der elterlichen Gene auf den sich entwickelnden Nachwuchs ist – und wie wichtig das fein austarierte und gut gemischte Zusammenspiel. Sie weisen darüber hinaus noch auf eine Schwierigkeit hin: In der Diskussion um ethische Probleme bei der Nutzung befruchteter Embryonen als "Ausgangsmaterial" für Gewebezüchtung wird häufiger vorgebracht, man könnte stattdessen unbefruchtete Eizellen verwenden. Da daraus aber rein parthenogenetische Zelllinien und somit auch Gewebe mit nur mütterlichem Erbgut entstünden, müssten Forscher dann mit den entsprechend geprägten Wachstumsschwierigkeiten zurecht kommen. Die Zukunftsaussichten für diese Alternative sind daher kaum rosig.
Diese Regel ist ganz besonders wichtig, wenn es um die Rolle der beiden Elternteile geht. Denn dadurch drücken sie dem genetisch bunt gemischten Nachwuchs ihren speziellen Stempel auf: Stammt ein Gen von der Mutter, gehorcht es oftmals anderen Regeln als das entsprechende Exemplar vom Vater, indem es beispielsweise still bleibt, während sein Gegenstück überaus aktiv wäre oder umgekehrt. Solche Gene mit genomischer Prägung verleihen den "nackten" genetischen Grundlagen eines Lebewesens einen eigenen zwar ererbten, aber doch individuellen Anstrich.
Doch ist diese Prägung im Laufe eines Zelllebens nicht unveränderlich und geht gerade bei der Entartung zu Krebszellen häufig verloren – während der Zellteilung normalerweise schweigende Gene werden plötzlich aktiv und andere, die solche Eskapaden sonst streng unter Kontrolle hatten, wählen plötzlich den Ruhestand, mit entsprechend schlimmen Folgen. Lidia Hernandez vom National Cancer Institute und ihren Kollegen war daher daran gelegen, den Einfluss väterlichen und mütterlichen Erbguts auf die Zellteilung und das Altern der Zellen aufzugliedern und so auch den jeweiligen Beitrag zur Krebszellentstehung abzuschätzen.
Sie untersuchten Fibroblasten-Zelllinien von Mäusen, da diese erste Differenzierungsschritte schon hinter sich gebracht haben und sich leicht kultivieren lassen. Um sicherzugehen, dass sie jeweils nur die Prägung eines Elternteils erfassten, entwickelten die Wissenschaftler parthenogenetische und androgenetische Zellen, also Zellen, deren Erbgut rein der Mutter beziehungsweise dem Vater entstammt. Deren weiteres Schicksal verglichen sie dann mit Fibroblasten, deren Genom sowohl väterliche als auch mütterliche Anteile aufwies.
Die Unterschiede waren überraschend deutlich und lassen sich kurz zusammenfassen mit: Vaterns Einfluss drängt zu Eile und Wandel, die Mutter zu Ruhe und Vergänglichkeit. Denn im Einzelnen stellten die Forscher fest, dass ein Zellteilungszyklus bei Zellen mit rein mütterlichem Erbgut genauso lange dauerte wie bei gemischtem Genom, während er bei Zellen mit väterlichem Erbgut in halber Zeit ablief.
Alle Zelltypen durchliefen außerdem zunächst eine Art "Jugendphase" mit eifriger Vermehrung, mit zunehmender Reife jedoch ließ das Teilungsgeschehen nach. Während die normalen Zellen erst nach einigen weiteren geruhsameren Zyklen begannen abzusterben, ereilte die parthenogenetischen Zellen dieses Schicksal bereits sehr viel früher. Ganz anders hingegen die androgenetischen Zellen: Als ob sie die Reifephase nur zu einem kurzem Durchatmen genutzt hatten, legten sie noch einmal richtig los und teilten sich wieder kräftig. Und hierbei geschah auch das Erschreckende: Sie begannen, sich zu verändern und riefen, eingepflanzt in junge Mäuse, Tumoren hervor.
Auf der Suche nach den verantwortlichen Genen wurden die Forscher schnell fündig. Während sie in den parthenogenetischen Zellen zwei Gene nachweisen konnten, deren Produkte als Bremsklötze bei der Zellteilung wirken, stießen sie in den androgenetischen Zellen auf den insulinähnlichen Wachstumsfaktor 2 (IGF-2) als Schuldigen für die Entartung der Zellen. Wie allerdings genau das Polypeptid jenen Wandel bewerkstelligt, bleibt noch unklar, zumal in anderen Experimente an Tieren ein erhöhtes Angebot an IGF-2 keine krebsauslösende Wirkung nachzuweisen war.
Diese Ergebnisse zeigen nicht nur, wie unterschiedlich der Einfluss der elterlichen Gene auf den sich entwickelnden Nachwuchs ist – und wie wichtig das fein austarierte und gut gemischte Zusammenspiel. Sie weisen darüber hinaus noch auf eine Schwierigkeit hin: In der Diskussion um ethische Probleme bei der Nutzung befruchteter Embryonen als "Ausgangsmaterial" für Gewebezüchtung wird häufiger vorgebracht, man könnte stattdessen unbefruchtete Eizellen verwenden. Da daraus aber rein parthenogenetische Zelllinien und somit auch Gewebe mit nur mütterlichem Erbgut entstünden, müssten Forscher dann mit den entsprechend geprägten Wachstumsschwierigkeiten zurecht kommen. Die Zukunftsaussichten für diese Alternative sind daher kaum rosig.

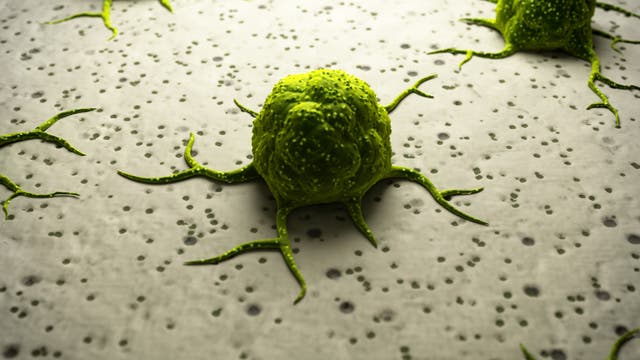


Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.