Interview: »Roboter werden sich durch den Körper bewegen«
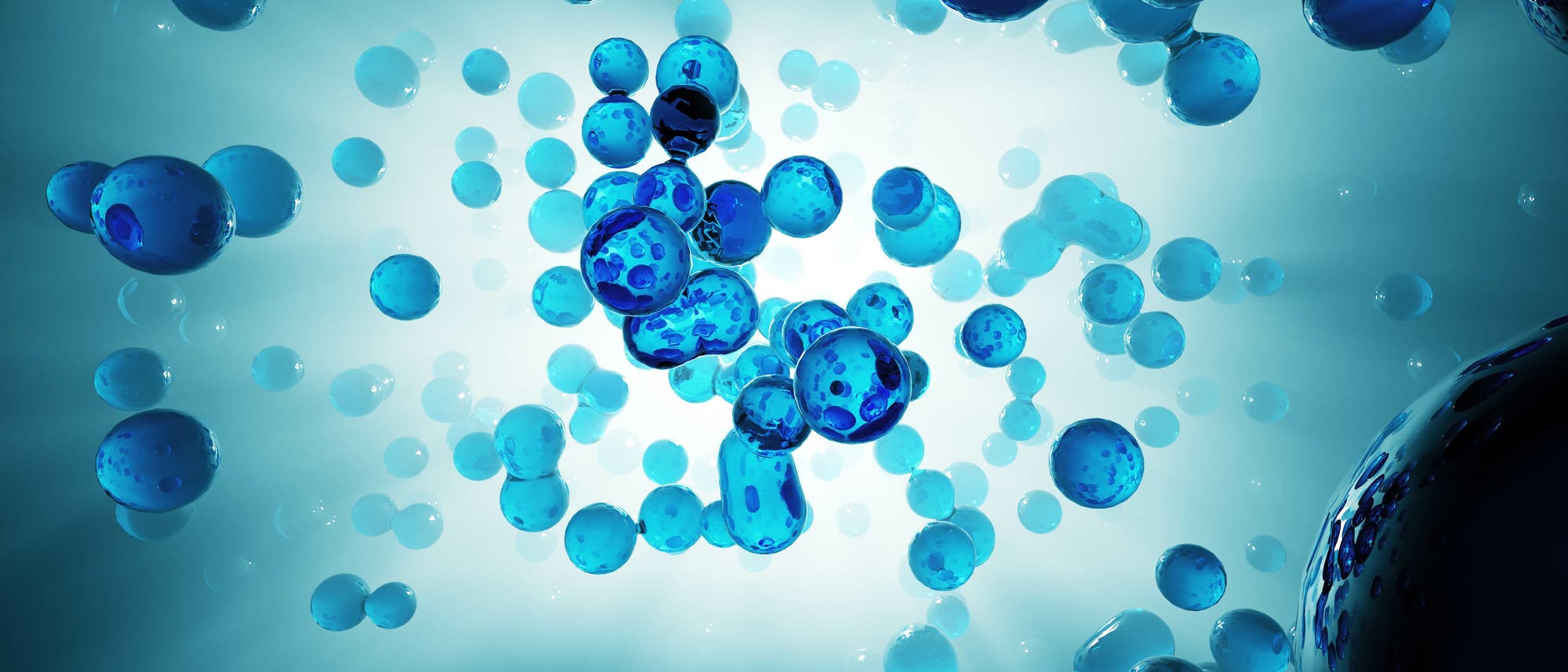
Herr Feringa, wenn Sie über Ihre Forschung sprechen, dann gelingt es Ihnen, sogar Menschen dafür zu begeistern, die keinen naturwissenschaftlichen Hintergrund haben. Was ist Ihr Geheimnis?
Meiner Meinung nach ist es wichtig, die Freude am Entdecken zu wecken. Astrophysiker sind sehr gut darin. Sie entdecken eine Supernova fernab im Weltraum und sagen: Schaut her, hier ist soeben ein Stern verglüht! Es geht immer darum, die Faszination rüberzubringen, die Lust am Unerwarteten. Und gleichzeitig sprechen viele Themen die Vorstellungskraft der Menschen an. Können Sie sich vorstellen, dass eines Tages kleine Roboter durch Ihren Körper wandern?
Außerdem versuche ich, die Perspektive der Menschen zu verändern. Die meisten wissen nicht, dass im Körper ständig winzige Maschinen am Werk sind. Ohne sie könnten wir uns nicht bewegen. Das sage ich absichtlich so deutlich, zeige Animationen dazu und frage: Ist Ihnen bewusst, wie rasch diese Vorgänge in Ihrem Körper ablaufen, dieser ständige Auf- und Abbau von Strukturen? Wie ist das möglich? Was können wir daraus lernen? Drittens muss man Beispiele finden, die die Menschen verstehen. Wir müssen besser darin werden, die Begeisterung für die Wissenschaft der Öffentlichkeit und besonders Politikern näherzubringen.
Sie arbeiten an molekularen Maschinen, die bestimmte Bewegungen ausführen. Wie entwerfen Sie ein Molekül, das eine konkrete Aufgabe erfüllen soll?
Ich diskutiere mit meinen Studierenden teils ganz klassisch an der Tafel, wo wir Molekülstrukturen zeichnen. Außerdem stellen wir Computerberechnungen an, um vorauszusagen, ob das Molekül die Eigenschaften mitbringt, die wir benötigen. Es gibt heute sehr fortgeschrittene Computermodelle, mit denen man Informationen über die Struktur des Moleküls erhalten kann. So berechnen wir zum Beispiel, ob die energetischen Barrieren zwischen zwei Molekülzuständen für unsere Zwecke geeignet sind, mit welcher Geschwindigkeit sich die eine Form in die andere umwandelt, wie rasch eine davon hervorgerufene Bewegung stattfinden wird oder welche Wellenlänge des Lichts das Molekül absorbiert. Das kann man alles ziemlich gut berechnen.
Die Moleküle setzen Sie aus chemischen Gruppen zusammen. Wie entscheiden Sie, welche dieser kleineren Bausteine für Ihr Molekül überhaupt in Frage kommen?
Wenn man ein Molekül entwirft, das eine bestimmte Aufgabe erfüllen soll, dann muss man sich gut überlegen, worauf es ankommt. Nehmen wir an, es soll über eine Oberfläche wandern. Dazu sollte es beweglich sein, beispielsweise einen Schritt machen können. Andererseits muss es auch ein Stück weit an der Oberfläche haften bleiben. Damit beschäftigen wir uns gerade: Die Moleküle dürfen nicht zu schwach an die Oberfläche binden, weil sie sonst durch die thermische Bewegung in alle Richtungen wegfliegen. Ein wichtiger Aspekt ist daher, die Balance zu wahren.
Wenn sich das Molekül bewegen soll, muss es seinen Zustand verändern – wenn man so will, seine Form. Zwischen zwei Zuständen gibt es immer eine energetische Barriere. Geht es hauptsächlich darum festzulegen, wie hoch diese Hürde ist?
Ja, man braucht eine energetische Barriere, damit sich das Molekül nicht spontan bewegt, sondern nur dann, wenn man es will. Sie müssen kontrollieren, wie hoch die Hürden sind. Bewegt sich das Molekül zu schnell oder zu langsam? Klebt es an der Oberfläche? Soll es an ein Polymer binden, an eine Zellmembran oder in einer Lösung schwimmen? All diese Aspekte sind wichtig. Wir arbeiten derzeit viel mit Molekülen in Wasser, alle müssen sich daher auch darin lösen können. Unser natürliches Vorbild dafür sind Seifen, also Detergenzien. Auf diese Weise haben wir einen künstlichen Muskel in wässriger Lösung geschaffen: Wir haben ein Motormolekül entworfen und Seitenketten daran angebracht, die Detergenzien ähneln. Solche Zusätze können aber auch die Motoreigenschaften sabotieren.
Das heißt, nachdem man einen Motor entworfen hat, muss man ihn zunächst einmal herstellen, was sehr zeitraubend sein kann. Anschließend heißt es, alle Eigenschaften zu untersuchen und sicherzustellen, dass er selbst dann noch funktioniert, wenn er im Wasser schwimmt.
Das klingt anstrengend …
Ja, in der Wissenschaft muss man auch hart arbeiten und beharrlich sein. Vieles, was man ausprobiert, funktioniert nicht. Und wenn man etwas herausgefunden hat, braucht es viele Experimente, um es tatsächlich zu belegen. Oft verbringt man zwei Jahre damit, zu beweisen, dass eine Hypothese funktioniert und dass man die Experimente reproduzieren kann. Mitunter ist die Arbeit also auch langweilig, weil man vieles etliche Male wiederholen oder auf etwas andere Art versuchen muss, bis es schließlich gelingt. Doch anschließend kommt die Freude über die Entdeckung!
Sie haben 1999 den ersten molekularen Rotor gebaut – ein schraubenförmiges Molekül, das sich um eine Kohlenstoff-Kohlenstoff-Doppelbindung dreht. Dafür haben Sie 2016 den Nobelpreis erhalten. Woher kam dieses Design?
Wir arbeiteten damals mit molekularen Schaltern. Solche Schalter ändern ihre Form, wenn man sie mit Licht einer bestimmten Wellenlänge bestrahlt. Mit der Lichtenergie bricht eine der beiden Bindungen in der Doppelbindung, so dass das Molekül sich darum drehen kann. So fingen wir an.
Unser Schalter bewegte sich zunächst vor und zurück. Rotation bedeutet aber, sich kreisförmig immer in die gleiche Richtung zu bewegen, nicht hin und her. Wir fanden dann heraus, dass eines der Moleküle bei der Bewegung einen relativ instabilen Zustand durchlief. Statt sich nach dieser instabilen Zwischenstufe zurückzudrehen, schnappte es um – und konnte nicht mehr zurück. Wir hatten Glück, dass wir das beobachtet haben. Offenbar war der Rückwärtsweg schwerer als die Vorwärtsroute. Dann sahen wir plötzlich, dass das Molekül sich um 180 Grad gedreht hatte. Zweimal durchgeführt, ergab sich eine 360-Grad-Drehung!
»In naher Zukunft werden wir viele künstliche Nanosysteme sehen, die spezifische Aufgaben erfüllen«
In unserem Körper arbeiten komplexe Motoren wie etwa die ATP-Synthase, die unseren Zellen Energieträger zur Verfügung stellt. Denken Sie, dass wir eines Tages künstliche Maschinen sehen werden, die ähnlich komplizierte Aufgaben vollbringen wie ihre biologischen Vorbilder?
Der Vergleich mit der Biologie ist immer schwierig, denn die Natur hatte immerhin mehrere Milliarden Jahre Zeit, um Maschinen wie die ATP-Synthase zu entwickeln. Aber in naher Zukunft werden wir viele künstliche Nanosysteme sehen, die spezifische Aufgaben erfüllen.
An welchem Punkt auf dem Weg dorthin sind wir gerade?
Kürzlich haben wir einen Motor in eine Zellmembran eingeschleust, so dass man etwas durch die Membran hindurchtransportieren kann. Außerdem haben wir kleine Motoren in Gelstrukturen eingebaut. Und vor Kurzem haben wir einen künstlichen Muskel hergestellt, der sich bewegen kann. Das sind bereits Funktionen! Das Hauptproblem bei dem künstlichen Muskel war, dass man nicht nur einen Motor erschaffen musste, sondern sehr viele, die gleichzeitig arbeiten und sich selbst organisieren. Dann erhält man eine Art kooperative Aktion. Mit nur einem Molekül lässt sich kein Muskel bewegen, denn die Kraft, die man damit erzeugt, ist nur einige Pikonewton groß. Aber wenn viele dieser Motoren zusammenarbeiten, dann funktioniert das.
Verraten Sie uns, wie die Moleküle zusammenarbeiten?
Zuerst haben wir die molekularen Motoren hergestellt und in Wasser gegeben. Dort lagern sie sich anschließend von selbst zusammen – wir sprechen von supramolekularer Chemie. Das Ganze funktioniert über nichtkovalente Wechselwirkungen: Die Moleküle lagern sich zusammen und bilden Fasern. Das ist noch kein Muskel, also haben wir einen Trick angewandt. In unseren Motoren waren Carboxylatgruppen, und wir haben uns eines Tricks aus der Natur bedient und Kalziumionen hinzugefügt (Ca2+). Sie binden an die Carboxylatgruppen, wodurch sich die Fasern zu Bündeln zusammenlagern. Das Ergebnis kann man direkt aus dem Wasser ziehen. So einfach!
Wenn wir diese Bündel nun mit Licht bestrahlen, werden die Motoren darin gemeinsam aktiviert. Es geht also nicht nur darum, ein Molekül zu entwerfen, sondern die ganze Organisation und Kooperation mitzudenken, damit das Ganze sowohl im Nanomaßstab als auch im großen Maßstab funktioniert. Auf diese Weise haben wir einen Muskel hergestellt, der einen Zentimeter lang ist und der ein Stück Papier aufheben kann.
Wie das?
Wir sind sogar noch weitergegangen und haben magnetische Eisen-Nanopartikel hinzugegeben – nur wenige Prozent, damit sie die Fasern nicht zu sehr stören. Dadurch entstand also ein kleiner magnetischer Muskel. Wir können ihn mit einem Magneten an eine gewünschte Stelle bewegen und dort mit Licht aktivieren, so dass er ein Stück Papier aufnimmt. Wir bewegen ihn mit dem Magneten weiter, bestrahlen ihn erneut mit Licht, und er lässt das Papier wieder los.
Also schon ein kleiner Roboter!
Na, sagen wir, ein Molekül, das eine Aufgabe erfüllen kann.
Aber ein Anfang?
In der Natur ist selbstverständlich alles ganz anders. Dort haben wir ganz andere Moleküle, andere Materialien. Denken Sie an den Unterschied zwischen einem Vogel und einem Flugzeug. Aber im Vergleich zur Natur sind wir immer noch sehr primitiv. Andererseits: Als Forscher zum ersten Mal über Displaymaterialien nachdachten, wussten sie nicht, dass sie unsere Welt damit komplett verändern würden. Grundlagenforschung kann also anfangs oft recht primitiv erscheinen, bis man merkt, dass man etwas Herausragendes damit anfangen kann.
Sollten wir mehr mit organischen Materialien arbeiten? Schließlich haben wir dank vieler neu geschaffener Stoffe auch ein großes Recyclingproblem.
Ich bin davon überzeugt, dass wir das Recycling von Materialien stark verbessern werden. In den letzten 100 Jahren haben wir Chemiker, Materialwissenschaftler und Ingenieure sehr erfolgreich gelernt, Bindungen zwischen Kohlenstoffatomen zu kontrollieren. Mit solchen Techniken stellen wir inzwischen jährlich hunderte Millionen Tonnen Kunststoffe her. Jetzt müssen wir unsere Materialien auf neue Art und Weise denken: beispielsweise, indem wir in Kunststoffen an verschiedenen Punkten Sollbruchstellen einbauen, also Bindungen, die sich leicht spalten lassen. So könnte man recycelbare Materialien herstellen, ohne dass deren Eigenschaften leiden. Denn natürlich soll nicht alles spontan auseinanderfallen.
Ich arbeite beispielsweise mit der Industrie an Beschichtungen. Beschichtungen und Farben braucht man überall, jedes Jahr werden für diesen Zweck allein rund acht Millionen Tonnen Acrylate hergestellt. Auf einem Auto ist eine dünne, aber sehr harte Lackschicht. Versuchen Sie mal, die wiederzuverwerten, zusammen mit dem ganzen Metall. Wir müssen uns also überlegen, wie wir solch eine Schicht gleichermaßen fest, aber gleichzeitig einfach recycelbar machen, ohne dass sie ihre Funktion einbüßt. Das ist eine der künftigen Herausforderungen.
Für technische Anwendungen verwenden wir fast die ganze Palette an Elementen, die es auf der Welt gibt – mit dem Ergebnis, dass sich die teils lediglich noch in Spuren vorkommenden Metalle nur sehr schwer wiedergewinnen lassen. Sollten wir diese Vielfalt reduzieren?
Wir verwenden diese vielen Stoffe, weil wir dadurch die gewünschten Materialeigenschaften erhalten. Ob wir ähnliche Eigenschaften oder Funktionen auch mit weniger Vielfalt erhalten können? Vielleicht. Nehmen wir die Katalyse, das Herz der chemischen Industrie. Man kann Kunststoffe, Treibstoffe, all die Chemikalien nicht ohne Katalysatoren herstellen. Die meisten davon enthalten Edelmetalle – Rhodium, Palladium und weitere seltene und teure Elemente. Nun schauen Sie sich im Gegensatz dazu an, was Ihr Körper benötigt: Eisen. Es gibt genügend Eisen auf der Welt, das ist völlig unproblematisch. Können wir also chemische Reaktionen mit Eisen katalysieren? Der Haber-Bosch-Prozess zur Ammoniaksynthese etwa arbeitet damit, aber sonst kein nennenswerter. Im Körper wird hingegen alles mit Eisen katalysiert – es filtert Sauerstoff aus der Luft, transportiert ihn mit Hämoglobin durch den Körper und vieles mehr. Auch die Bausteine Ihres Körpers basieren übrigens nur auf einer Hand voll Elemente, und trotzdem ist der menschliche Körper deutlich komplexer als ein Smartphone.
Könnten solche organischen Bausteine in Form von molekularen Schaltern oder Nanomaschinen also auch die Materialwissenschaft verändern?
Im Unterschied zur Chiptechnologie oder siliziumbasierten Technologien arbeite ich hauptsächlich mit weichen Materialien. Unser Ansatz ist ein anderer, denn wir wollen Bewegung erzeugen. Viele Forschungsgruppen arbeiten daran, Materialien mit dynamischen Funktionen zu versehen, so dass sie auf äußere Reize reagieren können, ähnlich wie der menschliche Körper. Es geht also darum, Materialien zu entwerfen, die auf Umweltreize wie Licht oder Hitze reagieren. Elektronikforschung funktioniert anders, hier verwendet man anorganische Stoffe für den Bau elektrischer Schaltkreise, die dann Ladung transportieren, in Computerchips etwa. Die Zielsetzung ist eine ganz andere.
Sie sagten in einem Vortrag, Sie seien überzeugt davon, dass wir eines Tages Nanobots sehen werden. In welchem Bereich wird das zuerst der Fall sein?
Um ehrlich zu sein, weiß ich es nicht. Vielleicht darf man nicht das klassische Bild von Robotern im Kopf haben. Kürzlich bin ich am Flughafen in Schanghai gelandet und sah zwei Roboter – einer putzte die Halle, ein anderer trug Gepäckstücke von Ort zu Ort. Das stellen sich die Leute vor, wenn sie »Roboter« hören.
Künftig wird es kleine Roboter geben, die sich durch den Körper bewegen. Ich habe das bei meinem Vortrag erwähnt, weil es die Vorstellungskraft der Menschen anspricht. Sie wollen dann wissen, was der kleine Roboter denn tut! Er könnte sich etwa zu einer verletzten Stelle bewegen und etwas reparieren, so dass keine Operation nötig ist. Das wird künftig auch passieren, davon bin ich überzeugt. Aber wenn ich über Nanoroboter spreche, dann denke ich an Materialien, die ihre Form ändern oder auf Reize reagieren können – adaptiv, selbstheilend, selbstreinigend.
»Die Bausteine Ihres Körpers basieren auf einer Hand voll Elemente, und trotzdem ist der menschliche Körper komplexer als ein Smartphone«
Wo könnten solche Materialien nützlich sein?
In der Welt, die wir gebaut haben, müssen wir in die Werkstatt, wenn das Auto verkratzt ist. Wenn ein Stück Plastik kaputt ist, werfen wir es weg. Ich stelle mir vor, dass uns smarte Materialien hier helfen können. Wir haben beispielsweise mit einer Forschungsgruppe aus Guangzhou in China eine neue Beschichtung für Glas entwickelt. Anfangs ist es transparent, doch wenn Sonne darauf trifft, verändert es sich und wird weniger durchlässig, so dass die Infrarotstrahlung nicht hindurchgelangt. So wird die Hitze draußen gehalten. Wird es zu kalt, verändert sich das Glas wieder und behält die Infrarotstrahlung innen. Das Material in diesen Fenstern ändert also dreimal seine Beschaffenheit. Solche intelligenten Scheiben könnten beispielsweise helfen, die Raumtemperatur zu regulieren und das Klima zu schützen.
Um noch einmal auf komplexe Funktionen zurückzukommen: Wäre denn eine Art Fließband denkbar, an dem verschiedene molekulare Maschinen arbeiten?
Dazu gibt es definitiv Möglichkeiten. Man könnte etwa Stoffe an einen Ort transportieren, an dem eine Reihe von Katalysatoren verschiedene Aufgaben erfüllt. Wir und andere Forschungsgruppen arbeiten an solchen Dingen. Ein Signal aktiviert dabei eine molekulare Maschine, die daraufhin eine Arbeit ausführt. Auf ein weiteres hin verändert sie sich und tut anschließend etwas anderes. Dazu braucht man orthogonale Signale, also verschiedene Reize, die unterschiedliche Veränderungen bewirken und sich nicht gegenseitig beeinflussen.
Wir haben beispielsweise molekulare Schalter gebaut, die auf orthogonale Lichtreize reagieren: Ein Lichtpuls mit einer Wellenlänge von etwa 800 Nanometern und ein anderer mit 400 Nanometern. Die beiden Signale rufen komplett unterschiedliche Effekte hervor. So lassen sich durch Licht verschiedene Funktionen präzise kontrollieren.
Je nach Art des Lichts entscheidet sich, welche Aufgabe die Maschine ausführt?
Genau. Wir haben einen Motor gebaut, der durch Rotation verschiedene Zustände annehmen kann. In den Motor haben wir katalytische Funktionen eingebaut: Man startet also im ersten Zustand und der Motor katalysiert eine Reaktion. Dann bestrahlt man ihn mit Licht und er führt eine andere Reaktion aus. Im dritten Schritt erwärmt man ihn leicht. Auf diese Weise kann ein einziger Katalysator drei unterschiedliche Aufgaben bewältigen.
Erklären Sie uns, welche verschiedenen Aufgaben das sind?
Die Moleküle sind helikal aufgebaut, sie sind asymmetrisch. Das Feld der asymmetrischen Synthese – bei der man Moleküle als Bild oder Spiegelbild herstellt – ist sehr anspruchsvoll und enorm wichtig, unter anderem für die Pharmaindustrie. Normalerweise braucht man einen linkshändigen Katalysator, um ein linkshändiges Molekül herzustellen. Umgekehrt braucht es einen rechtshändigen Katalysator, um das spiegelbildliche, rechtshändige Produkt zu erzeugen. Und will man zwei unterschiedliche Stoffe herstellen, benötigt man zwei völlig verschiedene Katalysatoren.
Wir haben einen Motor als Katalysator genommen. In einem Zustand stellt er das linkshändige Produkt her. Dann bestrahlen wir ihn mit Licht und er erzeugt das rechtshändige Produkt. Im nächsten Schritt erzeugt er eine 50:50-Mischung. Wir können also drei unterschiedliche Aufgaben ansteuern, je nachdem, wie wir den Katalysator bestrahlen!
Was ist mit aufeinanderfolgenden Schritten? Geht das auch?
Solche dynamischen Systeme können auf Licht, den pH-Wert oder die Temperatur reagieren. Also könnte man auch aufeinanderfolgende Operationen durchführen. Ich finde diese Fließbandidee sehr spannend: dass man entscheiden kann, welcher Schritt gemacht wird. Mit unterschiedlichen Reaktionen klappt das noch nicht. Aber ich bin überzeugt davon, dass es geht. Das wäre eine richtige Fließbandarbeit, eine echte Roboterfunktion.
Wie würde man die Katalysatoren räumlich organisieren?
Wir haben zusammen mit den Forschungsgruppen von Simon Krause und Bettina Lotsch am Max-Planck-Institut für Festkörperforschung in Stuttgart Motoren in Kristalle eingebaut. Dabei haben wir mit porösen Materialien gearbeitet – die Molekülschichten sind darin durch Säulen verbunden. In unserem Fall ist jede Säule ein Motormolekül, das sich drehen kann. Wir haben also einen stabilen, porösen Kristall, in dem sich Motoren befinden, die sich bei Bestrahlung mit Licht drehen. Das Ganze könnte als Transportmembran oder zur Gasabsorption dienen, und zwar dynamisch und kontrollierbar.
Wie funktioniert das genau?
Die rotierenden Motoren fungieren als Säulen. Alles ist also fixiert, so dass ein Gas durch die Poren strömen oder absorbiert werden kann. Und weil das System dynamisch ist, können wir kontrollieren, wann Gas absorbiert oder transportiert wird. Das eine gute Voraussetzung für eine molekulare Fabrik, denn alle Maschinen sind strikt geordnet. Verschiedene Reaktionen an unterschiedlichen Orten durchzuführen, ist zwar ein Traum für die Zukunft. Aber das Prinzip funktioniert schon. Weil Millionen von Motoren hier im Nanomaßstab genau positioniert sind, ist es viel einfacher, alles zu synchronisieren, denn sämtliche Motoren reagieren auf denselben Reiz.
Wäre denn auch ein chemisches Signal denkbar, so dass automatisch die nächste Reaktion in Gang gesetzt wird, wenn ein Stoff produziert ist?
Ja, das beschäftigt mich gerade ganz akut. Wenn man durch einen Motor eine Reaktion auslöst und einen Effekt erzielt, wie wirkt sich dieser Effekt auf einen anderen Motor aus? Lässt sich so ein zweiter Motor oder eine weitere Funktion einführen? Tatsächlich habe ich darüber neulich im Zug nachgedacht. Wir arbeiten gerade mit einem Motor, der normalerweise rotiert. Wenn aber der pH-Wert sinkt, nimmt er Protonen auf. Dann dreht er sich nicht mehr weiter, sondern zurück in die entgegengesetzte Richtung. Wir können ihn also vorwärts und rückwärts drehen, je nachdem, wie wir das System beeinflussen.
Könnte so ein selbst limitierendes System entstehen?
Ja, aber das funktioniert nur bis zu einem bestimmten Punkt. Wir haben hier viele Ideen, aber sie sind nicht so einfach umzusetzen. Die verschiedenen Funktionen muss man miteinander verknüpfen und sie müssen zeitlich extrem gut aufeinander abgestimmt sein. Das alles hängt auch von der Konzentration ab. Das wiederum ist in einer Zelle erstaunlich gut organisiert: Kaum steigt die Konzentration etwas, beginnt das nächste Enzym zu arbeiten und setzt eine weitere Funktion in Gang. Das ist verblüffend.
Aber ja, die Idee eines molekularen Fließbands und, dass sich verschiedene Funktionen gegenseitig beeinflussen, ist sehr bestechend. Sie ist aber schwierig umzusetzen, denn man muss sich dabei nicht nur um einzelne Motoren Gedanken machen, sondern sie mit weiteren Funktionen verknüpfen. Doch wir haben das ja in Ansätzen bereits in künstlichen Muskeln geschafft, außerdem auf Oberflächen und jetzt neuerdings in Kristallen. Ich bin also davon überzeugt, dass es klappen wird.
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.