Reaktorkatastrophe: Pandoras Erbe
Wenig hat den Glauben in unfehlbare Technik stärker erschüttert als der Unfall im Kernkraftwerk Tschernobyl in der heutigen Ukraine. Knapp zwanzig Jahre danach leiden immer noch viele Menschen dort unter den Folgen – nur die Natur kommt zurück.

© (Ausschnitt)
Wolf, Luchs und Bär streifen durch ausgedehnte, verwildernde Wälder; See- und Fischadler jagen die zahlreichen Karpfen, Hechte, Barsche und Rotaugen in den örtlichen Gewässern; 270 Vogelarten brüten und rasten in den ausgedehnten Marschen, Röhrichten und Hainen der Region: Über hundert bedrohte Spezies haben sich mittlerweile in dieser Wildnis angesiedelt und ausgebreitet. Die Natur – und das ist so etwas wie die positive Nachricht – wurde von der Reaktorkatastrophe des 26. Aprils 1986 im Kernkraftwerk Tschernobyl (ukrainisch: Tschornobyl) weit weniger in Mitleidenschaft gezogen als befürchtet.
Im Gegenteil: Tiere und Pflanzen profitieren von der Schaffung der knapp 4000 Quadratkilometer großen Sperrzone rund um den havarierten Block 4 des Kraftwerks, in der sich kein Mensch längere Zeit aufhalten soll, um nicht eine überhöhte Strahlendosis aufzunehmen. Selbst die damals durch Radioaktivität am schwersten geschädigten Kiefernwälder in unmittelbarer Nähe des explodierten Reaktors erholen sich – zwischen den abgestorbenen Bäumen zeigt sich frisches Grün.
Für die Menschen vor Ort jedoch sind die Folgen des GAU zumeist noch lange nicht bewältigt, geschweige denn überwunden, wie nun ein von mehr als hundert Wissenschaftlern erstellter und von der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) veröffentlichter Bericht zeigt. Die etwa am Unglückstag in unmittelbarer Nähe des brennenden Reaktorblocks eingesetzten Notfallmitarbeiter und Feuerwehrleute traf es naturgemäß am härtesten, denn sie waren extrem hohen Radioaktivitätsdosen ausgesetzt.
An den durch die Verstrahlung und die eingeatmeten radioaktiven Jod-, Cäsium- oder Strontium-Isotopen entstandenen Krankheiten und Folgeschäden leiden viele der knapp tausend Ersthelfer noch heute. Allerdings ließen sich nach Angaben der beteiligten Forscher unter diesen Mitarbeitern bislang "nur" knapp fünfzig Verstorbene direkt auf den Einsatz an der vordersten Feuerfront zurückführen. Weitere neun sicher nachgewiesene Todesfälle gab es zudem unter den 4000 an Schilddrüsenkrebs erkrankten Menschen, die zum Zeitpunkt des Unfalls im Kinder- und Jugendlichenalter waren und die deshalb damals hohe Mengen radioaktiven Jods über kontaminierte Kuhmilch aufgenommen und in ihre Schilddrüse eingelagert hatten.
Insgesamt soll die Überlebensrate dieser Krebspatienten nach Untersuchungen aus Weißrussland jedoch bei etwa 99 Prozent liegen – die meisten überwinden also zumindest diese Krankheit körperlich. Das kurzlebige Jod-131 ist zudem aus der Umwelt mittlerweile verschwunden, sodass von dieser Seite keine Gefahr mehr droht. Neben Schilddrüsenkrebs spielt bei den etwa 600 000 unter medizinischer Beobachtung stehenden Menschen vor allem noch Leukämie eine größere Rolle als zuvor. Diese Erkrankung tritt wiederum unter den Feuerwehrleute und Kraftwerksmitarbeiter, die als erste das Desaster einzugrenzen versuchten, am stärksten auf.
Andere Karzinome bleiben dagegen bis zum jetzigen Zeitpunkt im statistisch normalen Rahmen oder lassen sich in ihrer leichten Zunahme nicht zweifelsfrei auf die Strahlung zurückführen, da in den maßgeblichen Studien Faktoren wie Rauchen, Alkoholkonsum oder erhöhter Stress nicht berücksichtigt worden waren. Ungeachtet der bislang anscheinend relativ geringen Sterblichkeit durch den GAU gehen die internationalen Fachleute aber immer noch von zukünftig insgesamt bis zu 4000 zusätzlichen Toten durch die Kernschmelze aus – die Mehrheit davon unter den Ersthelfern sowie den geschätzten 200 000 Rettungsarbeitern, die 1986 und 1987 den zerstörten Reaktorblock sichern sollten. Diese Zahlen werden allerdings von verschiedener Seite – etwa den Internationalen Ärzten für die Verhütung des Atomkriegs (IPPNW) – als eindeutig zu niedrig kritisiert.
Da die sowjetischen Behörden damals relativ schnell die Evakuierung besonders gefährdeter und kontaminierter Gebiete und Städte – vor allem von Pripyat – einleiteten, blieben knapp 400 000 Bewohner im unmittelbaren Umfeld des Kernkraftwerks vor Schlimmerem zumeist bewahrt. So konnten bislang auch keine signifikanten negativen Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit von Männern und Frauen oder die Anzahl von Fehlgeburten wie Missbildungen von Säuglingen nachgewiesen werden.
Viele der betroffenen Regionen bleiben aber auf Grund radioaktiver Verseuchung des Bodens durch Cäsium-137 oder Strontium-90 (mit Halbwertszeiten von etwa dreißig Jahren) sowie durch verschiedene Plutonium-Isotope und Americium-241 auf Dauer unbewohnbar, sodass die Menschen an un- oder minder belasteten Orten neu angesiedelt werden mussten. Vielfach führte dies gerade unter älteren Bewohnern zu Traumata und Depressionen sowie zu Spannungen unter Alt- und Neusiedlern. Die Autoren der Studie bezeichnen die dadurch ausgelösten psychischen Erkrankungen sogar als größtes und bis dato am stärksten missachtetes Gesundheitsproblem als Folge des Unfalls.
Auf Grund der sehr realen, teilweise aber auch irrationalen Ängste wanderten zudem vielfach junge Familien und gut ausgebildete Fachkräfte ab und verschärften damit die sozialen und ökonomischen Probleme in diesen Teilen Russlands, Weißrusslands und der Ukraine. Insgesamt wird der Schaden für die beteiligten Volkswirtschaften mit mehrere hundert Milliarden Dollar kalkuliert, wobei Land- und Forstwirtschaft die größte Bürde zu tragen hatten: Knapp 1,5 Millionen Hektar Agrar- und Waldflächen mussten dauerhaft aus der Produktion genommen werden; viele Landarbeiter wurden dadurch arbeitslos und verarmten.
In diese Bilanz noch nicht eingerechnet ist jedoch das größte verbleibende Problem der Katastrophe: die Sanierung und vorläufige Sicherung des Beton-Sarkophags von Tschernobyl-Block 4. In der verständlichen Hektik in den Tagen nach dem großen Knall wurde nur ein Provisorium über der Brandstelle errichtet, dessen Statik nie zweifelsfrei ermittelt werden konnte. Beton und Stahl des Reaktorsargs erodierten und korrodierten rasch durch hohe Reststrahlung, große Hitze, saures Kühl- und Löschwasser sowie Wind und Wetter – die Gefahr eines nachfolgenden Kollapses und neuerlichen Aufwirbelns radioaktiven Staubs konnte erst jüngst gebannt werden. Und der Bau einer weiteren auf hundert Jahre angelegten Schutzhülle beginnt erst noch.
Ebenfalls noch ungeklärt ist die Entgiftung des hoch radioaktiven Geländes in einem Radius von etwa dreißig Kilometern um den Explosionsort. Wegen seines Wild- und Artenreichtums plädieren viele Wissenschaftler und Naturschutzverbände nun für eine dauerhafte Einrichtung eines Nationalparks – als billigste und beste Lösung.
Im Gegenteil: Tiere und Pflanzen profitieren von der Schaffung der knapp 4000 Quadratkilometer großen Sperrzone rund um den havarierten Block 4 des Kraftwerks, in der sich kein Mensch längere Zeit aufhalten soll, um nicht eine überhöhte Strahlendosis aufzunehmen. Selbst die damals durch Radioaktivität am schwersten geschädigten Kiefernwälder in unmittelbarer Nähe des explodierten Reaktors erholen sich – zwischen den abgestorbenen Bäumen zeigt sich frisches Grün.
Für die Menschen vor Ort jedoch sind die Folgen des GAU zumeist noch lange nicht bewältigt, geschweige denn überwunden, wie nun ein von mehr als hundert Wissenschaftlern erstellter und von der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) veröffentlichter Bericht zeigt. Die etwa am Unglückstag in unmittelbarer Nähe des brennenden Reaktorblocks eingesetzten Notfallmitarbeiter und Feuerwehrleute traf es naturgemäß am härtesten, denn sie waren extrem hohen Radioaktivitätsdosen ausgesetzt.
An den durch die Verstrahlung und die eingeatmeten radioaktiven Jod-, Cäsium- oder Strontium-Isotopen entstandenen Krankheiten und Folgeschäden leiden viele der knapp tausend Ersthelfer noch heute. Allerdings ließen sich nach Angaben der beteiligten Forscher unter diesen Mitarbeitern bislang "nur" knapp fünfzig Verstorbene direkt auf den Einsatz an der vordersten Feuerfront zurückführen. Weitere neun sicher nachgewiesene Todesfälle gab es zudem unter den 4000 an Schilddrüsenkrebs erkrankten Menschen, die zum Zeitpunkt des Unfalls im Kinder- und Jugendlichenalter waren und die deshalb damals hohe Mengen radioaktiven Jods über kontaminierte Kuhmilch aufgenommen und in ihre Schilddrüse eingelagert hatten.
Insgesamt soll die Überlebensrate dieser Krebspatienten nach Untersuchungen aus Weißrussland jedoch bei etwa 99 Prozent liegen – die meisten überwinden also zumindest diese Krankheit körperlich. Das kurzlebige Jod-131 ist zudem aus der Umwelt mittlerweile verschwunden, sodass von dieser Seite keine Gefahr mehr droht. Neben Schilddrüsenkrebs spielt bei den etwa 600 000 unter medizinischer Beobachtung stehenden Menschen vor allem noch Leukämie eine größere Rolle als zuvor. Diese Erkrankung tritt wiederum unter den Feuerwehrleute und Kraftwerksmitarbeiter, die als erste das Desaster einzugrenzen versuchten, am stärksten auf.
Andere Karzinome bleiben dagegen bis zum jetzigen Zeitpunkt im statistisch normalen Rahmen oder lassen sich in ihrer leichten Zunahme nicht zweifelsfrei auf die Strahlung zurückführen, da in den maßgeblichen Studien Faktoren wie Rauchen, Alkoholkonsum oder erhöhter Stress nicht berücksichtigt worden waren. Ungeachtet der bislang anscheinend relativ geringen Sterblichkeit durch den GAU gehen die internationalen Fachleute aber immer noch von zukünftig insgesamt bis zu 4000 zusätzlichen Toten durch die Kernschmelze aus – die Mehrheit davon unter den Ersthelfern sowie den geschätzten 200 000 Rettungsarbeitern, die 1986 und 1987 den zerstörten Reaktorblock sichern sollten. Diese Zahlen werden allerdings von verschiedener Seite – etwa den Internationalen Ärzten für die Verhütung des Atomkriegs (IPPNW) – als eindeutig zu niedrig kritisiert.
Da die sowjetischen Behörden damals relativ schnell die Evakuierung besonders gefährdeter und kontaminierter Gebiete und Städte – vor allem von Pripyat – einleiteten, blieben knapp 400 000 Bewohner im unmittelbaren Umfeld des Kernkraftwerks vor Schlimmerem zumeist bewahrt. So konnten bislang auch keine signifikanten negativen Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit von Männern und Frauen oder die Anzahl von Fehlgeburten wie Missbildungen von Säuglingen nachgewiesen werden.
Viele der betroffenen Regionen bleiben aber auf Grund radioaktiver Verseuchung des Bodens durch Cäsium-137 oder Strontium-90 (mit Halbwertszeiten von etwa dreißig Jahren) sowie durch verschiedene Plutonium-Isotope und Americium-241 auf Dauer unbewohnbar, sodass die Menschen an un- oder minder belasteten Orten neu angesiedelt werden mussten. Vielfach führte dies gerade unter älteren Bewohnern zu Traumata und Depressionen sowie zu Spannungen unter Alt- und Neusiedlern. Die Autoren der Studie bezeichnen die dadurch ausgelösten psychischen Erkrankungen sogar als größtes und bis dato am stärksten missachtetes Gesundheitsproblem als Folge des Unfalls.
Auf Grund der sehr realen, teilweise aber auch irrationalen Ängste wanderten zudem vielfach junge Familien und gut ausgebildete Fachkräfte ab und verschärften damit die sozialen und ökonomischen Probleme in diesen Teilen Russlands, Weißrusslands und der Ukraine. Insgesamt wird der Schaden für die beteiligten Volkswirtschaften mit mehrere hundert Milliarden Dollar kalkuliert, wobei Land- und Forstwirtschaft die größte Bürde zu tragen hatten: Knapp 1,5 Millionen Hektar Agrar- und Waldflächen mussten dauerhaft aus der Produktion genommen werden; viele Landarbeiter wurden dadurch arbeitslos und verarmten.
In diese Bilanz noch nicht eingerechnet ist jedoch das größte verbleibende Problem der Katastrophe: die Sanierung und vorläufige Sicherung des Beton-Sarkophags von Tschernobyl-Block 4. In der verständlichen Hektik in den Tagen nach dem großen Knall wurde nur ein Provisorium über der Brandstelle errichtet, dessen Statik nie zweifelsfrei ermittelt werden konnte. Beton und Stahl des Reaktorsargs erodierten und korrodierten rasch durch hohe Reststrahlung, große Hitze, saures Kühl- und Löschwasser sowie Wind und Wetter – die Gefahr eines nachfolgenden Kollapses und neuerlichen Aufwirbelns radioaktiven Staubs konnte erst jüngst gebannt werden. Und der Bau einer weiteren auf hundert Jahre angelegten Schutzhülle beginnt erst noch.
Ebenfalls noch ungeklärt ist die Entgiftung des hoch radioaktiven Geländes in einem Radius von etwa dreißig Kilometern um den Explosionsort. Wegen seines Wild- und Artenreichtums plädieren viele Wissenschaftler und Naturschutzverbände nun für eine dauerhafte Einrichtung eines Nationalparks – als billigste und beste Lösung.

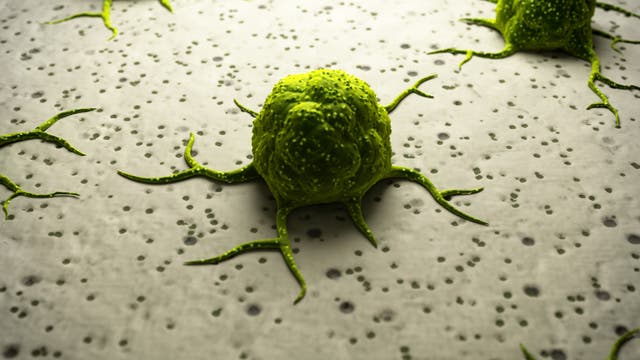


Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.