News: Schwerwiegende Kreise
Seit der Mensch Handel treibt, misst und wiegt er, um sich nicht übervorteilen zu lassen. Die gute alte Balkenwaage hat sich dabei seit Jahrtausenden bewährt. Warum also sollte sich ihr Konzept nicht auch für die moderne Physik eignen?

© (Ausschnitt)
"Wer misst, misst Mist", pflegte ein Kommilitone stets zu sagen. Anlass dazu gab in der Regel die leicht lädierte Laborwaage, die zwar im Prinzip sehr genau die Masse von geometrisch ansprechenden Versuchskörpern bestimmen konnte, bei der sich jedoch in der Realität noch nicht einmal das Rädchen für den Gewichtsbereich vernünftig drehen ließ. Generationen von Studenten im physikalischen Anfängerpraktikum hatten dem Präzisionsgerät offenbar zugesetzt. Entsprechend abwechslungsreich waren denn auch die Messwerte, was uns seinerzeit immerhin ein brauchbares Standardargument für die Fehlerdiskussion bescherte.
Nun ja, manchmal ist eine schlichte Balkenwaage mit entsprechend präzisen Wägestücken eben doch dem elektrisch-mechanischen Fortschritt gegenüber im Vorteil. Nicht allein deshalb, weil ihr vergleichsweise simpler Aufbau auch der zuweilen rohen Behandlung unzähliger Studentenhände gewachsen ist, auch lässt sie sich nicht so leicht von kleinen Unwägbarkeiten aus dem Gleichgewicht bringen. Schließlich beruht ihre Messung auf einem direkten Masse- beziehungsweise Drehmomentvergleich, und viele Störungen wirken sich auf beide Wägeschalen aus, sodass sich Fehler gegenseitig aufheben. Eine Federwaage indes funktioniert nur genau, wenn sich die Gewichtskraft nicht verändert. Ein Ortswechsel auf der Erde kann so mitunter schon für einige Promille Fehler sorgen.
Dessen ungeachtet setzen ultrapräzise Waagen bislang eher auf das Prinzip Feder als auf das des Balkens – führen also irgendeine physikalische Messgröße indirekt auf die Masse zurück, ohne den direkten Vergleich mit einer Referenzmasse. Wenngleich derartige High-Tech-Waagen für atomare Massen weniger mit dem Gravitationseinfluss zu kämpfen haben, so unterliegen sie doch auch gewissen störenden Einflüssen. Warum also nicht auch hier ein vergleichendes Messprinzip einführen? Das dachten sich offenbar auch Simon Rainville, James Thompson und David Pritchard vom Massachusetts Institute of Technology, die nun ihre "ultra-hoch-präzise Ionenwaage für atomare Massenbestimmung" vorstellen.
Freilich sitzt in diesem Gerät nicht wirklich ein Balken, womöglich noch mit Wägeschalen, in die nach Bedarf Atome zu füllen sind. Das Messgerät stellt vielmehr ein elektromagnetisches Pendant zur bewährten Mechanik dar. Herzstück der Apparatur ist eine so genannte Penningfalle, in der Ionen in einem kleinen Raumbereich – in diesem Fall nicht größer als ein Kubikmillimeter – durch magnetische und elektrische Felder einfangen werden. Solche Fallen nutzen Wissenschaftler schon seit langem, um Ionen vorübergehend zu speichern, diese zu kühlen und auch um ihre Masse zu bestimmen. Letzteres geschah jedoch immer nur in Einzelmessungen ohne direkten Vergleich.
Schon vor gut zehn Jahren hatten Forscher die Idee, einfach zwei Ionen gleichzeitig in der Falle zu wiegen – das Balkenwaagenprinzip. Denn schließlich wirken sich etwaige Störungen auf beide Teilchen aus, sodass das Massenverhältnis erhalten bleibt. Rainville und sein Team setzten die Theorie nun in die Praxis um. Aber wie funktioniert überhaupt eine Penningfalle und wie lässt sich damit wiegen?
Die ganze Konstruktion ist röhrenförmig angelegt: Eine Ringelektrode sitzt in der Mantelmitte eines Zylinders, der von je einer Deckelelektrode oben und unten abgeschlossen wird. Die Ringelektrode liegt dabei auf einem anderen Potenzial als die beiden Deckelelektroden. Je nach Ladung der Teilchen und Elektroden lässt sich so ein Feld erzeugen, dass die Ionen von den Deckeln fern hält und zu der Ringelektrode zieht, kurzum die Bewegung der Teilchen entlang der Zylinderachse ist einschränkt.
Das allein wäre allerdings noch nicht stabil, da die Ionen zur Ringelektrode hin beschleunigt würden. Um das zu verhindern und die Wolke in der Schwebe zu halten, wird entlang der Röhre – also senkrecht zu den Deckelektroden – ein homogenes Magnetfeld angelegt. Dieses Feld lässt die geladenen Teilchen nicht seitwärts entweichen, sondern zwingt sie durch die Lorentzkraft, die auf jeden bewegten, geladenen Körper im Magnetfeld wirkt, auf Kreisbahnen senkrecht zum Magnetfeld: die Zyklotronbahnen.
Nicht nur, dass die Teilchen dadurch in einem bestimmten Raumbereich gefangen sind, praktischerweise steht die Frequenz, mit der die Ionen auf ihrer Bahn kreisen, in direktem Zusammenhang mit der Stärke des Magnetfeldes, der Ladung des Teilchens und seiner Masse. Da in der Regel sowohl Magnetfeldstärke und Ladung der Ionen bekannt sind, lässt sich durch die Messung dieser Zyklotronfrequenz die Masse der Teilchen bestimmen.
Das funktioniert im Großen und Ganzen auch ganz gut, doch kleinste Fluktuationen bei der Magnetfeldstärke – hervorgerufen etwa durch die elektrisch betriebene Straßenbahn vor dem Labor oder das Handy vom Doktorand – beeinflussen die Messgenauigkeit. Was also tun?
Um das neue Messprinzip zu verstehen, müssen wir uns die Dynamik geladener Teilchen in der Penningfall noch ein wenig genauer betrachten: Denn da neben dem Magnetfeld auch noch elektrische Felder vorhanden sind, setzt sich die tatsächliche Bahn der Ionen nicht allein aus der kreisförmigen Zyklotronbewegung zusammen, zusätzlich müssen noch zwei weitere Bewegungskomponenten berücksichtigt werden: Das ist zum einen eine Schwingung in Richtung der Zylinderachse, die für ein stetes sinusförmiges Auf und Ab der Teilchen in der Falle sorgt. Zum anderen verschiebt sich der Mittelpunkt der Zyklotronbahn aufgrund des gleichzeitig anliegenden elektrischen Feldes kontinuierlich. Dieser Mittelpunkt beschreibt in der Ebene selbst eine Kreisbahn, die Magnetronbewegung.
Von dem Auf und Ab einmal abgesehen, lässt sich die Bewegung eines Ions in der Penningfalle gut mit der Bewegung des Erdmondes in unserem Sonnensystem vergleichen: So befindet sich das Erde-Mond-System auf einer annähernd kreisförmigen Bahn um unser Zentralgestirn – entsprechend der behäbigen Magnetronbewegung, der Mond indes kreist vergleichsweise schnell um die Erde – die Zyklotronbewegung.
Soweit das Prinzip der Penningfalle. Das Team um Rainville ließ nun zwei annähernd gleichschwere Ionen um gegenüberliegende Punkte des Magnetron-Orbits kreisen – so als würde ein zweiter Mond um eine zweite imaginäre Erde am gegenüberliegenden Punkt der Umlaufbahn um die Sonne rotieren. Die langsame Kreisbewegung der Magnetronbewegung sorgte im Experiment dafür, dass sich die Ionen nicht näher als ein Millimeter kamen. Das ist deshalb nötig, da sonst elektrostatische Wechselwirkungen zwischen den Ionen die Messungen stören.
So kreisten denn also ein Acetylen-Kation (13C2H2+) und ein Distickstoff-Kation (N2+) wochenlang umeinander, während die Forscher immer mal wieder die Zyklotronfrequenzen der beiden Ionen bestimmten. Daraus ließ sich schließlich das Massenverhältnis errechnen mit einer Messunsicherheit von lediglich 7·10-12. Zum Vergleich: Bislang ließ sich mit großem Aufwand maximal eine Messunsicherheit von 10-10 bei atomaren Massen erreichen. Bei der Messung am MIT störten hingegen noch nicht einmal die Magnetfeldfluktuationen durch den nahen Aufzug und die Bostoner U-Bahn.
Und wozu braucht man derart präzise Massemessungen? Rainville und Co führen gleich eine ganze Reihe von Möglichkeiten an: So ließe sich die Feinstrukturkonstante, deren langfristige Beständigkeit derzeit ohnehin angezweifelt wird, genauer bestimmen. Auf astrophysikalische Erkenntnisse könnte sich die atomare Massenbestimmung auswirken, wenn sie denn ein besseres Verständnis zur Entstehung schwerer Elemente liefert. Schließlich könnte die Messung zu einer besseren, weil genaueren Definition des Kilogramms führen. Immerhin handelt es sich dabei um die einzige physikalische Grundeinheit, die sich noch an einem Maßstab dem Ur-Kilogramm in Paris orientiert und nicht auf eine ortsunabhängige Messvorschrift zurückzuführen ist. Selbst das Gewicht einer chemischen Bindung respektive den Massenverlust durch die selbige könnte die Waage aufdecken, prognostizieren die Wissenschaftler. Dazu müsse das Verfahren jedoch soweit verbessert werden, dass noch einmal eine Größenordnung in der Messgenauigkeit gut gemacht wird – kein Ding der Unmöglichkeit, meinen die Forscher.
Nun ja, manchmal ist eine schlichte Balkenwaage mit entsprechend präzisen Wägestücken eben doch dem elektrisch-mechanischen Fortschritt gegenüber im Vorteil. Nicht allein deshalb, weil ihr vergleichsweise simpler Aufbau auch der zuweilen rohen Behandlung unzähliger Studentenhände gewachsen ist, auch lässt sie sich nicht so leicht von kleinen Unwägbarkeiten aus dem Gleichgewicht bringen. Schließlich beruht ihre Messung auf einem direkten Masse- beziehungsweise Drehmomentvergleich, und viele Störungen wirken sich auf beide Wägeschalen aus, sodass sich Fehler gegenseitig aufheben. Eine Federwaage indes funktioniert nur genau, wenn sich die Gewichtskraft nicht verändert. Ein Ortswechsel auf der Erde kann so mitunter schon für einige Promille Fehler sorgen.
Dessen ungeachtet setzen ultrapräzise Waagen bislang eher auf das Prinzip Feder als auf das des Balkens – führen also irgendeine physikalische Messgröße indirekt auf die Masse zurück, ohne den direkten Vergleich mit einer Referenzmasse. Wenngleich derartige High-Tech-Waagen für atomare Massen weniger mit dem Gravitationseinfluss zu kämpfen haben, so unterliegen sie doch auch gewissen störenden Einflüssen. Warum also nicht auch hier ein vergleichendes Messprinzip einführen? Das dachten sich offenbar auch Simon Rainville, James Thompson und David Pritchard vom Massachusetts Institute of Technology, die nun ihre "ultra-hoch-präzise Ionenwaage für atomare Massenbestimmung" vorstellen.
Freilich sitzt in diesem Gerät nicht wirklich ein Balken, womöglich noch mit Wägeschalen, in die nach Bedarf Atome zu füllen sind. Das Messgerät stellt vielmehr ein elektromagnetisches Pendant zur bewährten Mechanik dar. Herzstück der Apparatur ist eine so genannte Penningfalle, in der Ionen in einem kleinen Raumbereich – in diesem Fall nicht größer als ein Kubikmillimeter – durch magnetische und elektrische Felder einfangen werden. Solche Fallen nutzen Wissenschaftler schon seit langem, um Ionen vorübergehend zu speichern, diese zu kühlen und auch um ihre Masse zu bestimmen. Letzteres geschah jedoch immer nur in Einzelmessungen ohne direkten Vergleich.
Schon vor gut zehn Jahren hatten Forscher die Idee, einfach zwei Ionen gleichzeitig in der Falle zu wiegen – das Balkenwaagenprinzip. Denn schließlich wirken sich etwaige Störungen auf beide Teilchen aus, sodass das Massenverhältnis erhalten bleibt. Rainville und sein Team setzten die Theorie nun in die Praxis um. Aber wie funktioniert überhaupt eine Penningfalle und wie lässt sich damit wiegen?
Die ganze Konstruktion ist röhrenförmig angelegt: Eine Ringelektrode sitzt in der Mantelmitte eines Zylinders, der von je einer Deckelelektrode oben und unten abgeschlossen wird. Die Ringelektrode liegt dabei auf einem anderen Potenzial als die beiden Deckelelektroden. Je nach Ladung der Teilchen und Elektroden lässt sich so ein Feld erzeugen, dass die Ionen von den Deckeln fern hält und zu der Ringelektrode zieht, kurzum die Bewegung der Teilchen entlang der Zylinderachse ist einschränkt.
Das allein wäre allerdings noch nicht stabil, da die Ionen zur Ringelektrode hin beschleunigt würden. Um das zu verhindern und die Wolke in der Schwebe zu halten, wird entlang der Röhre – also senkrecht zu den Deckelektroden – ein homogenes Magnetfeld angelegt. Dieses Feld lässt die geladenen Teilchen nicht seitwärts entweichen, sondern zwingt sie durch die Lorentzkraft, die auf jeden bewegten, geladenen Körper im Magnetfeld wirkt, auf Kreisbahnen senkrecht zum Magnetfeld: die Zyklotronbahnen.
Nicht nur, dass die Teilchen dadurch in einem bestimmten Raumbereich gefangen sind, praktischerweise steht die Frequenz, mit der die Ionen auf ihrer Bahn kreisen, in direktem Zusammenhang mit der Stärke des Magnetfeldes, der Ladung des Teilchens und seiner Masse. Da in der Regel sowohl Magnetfeldstärke und Ladung der Ionen bekannt sind, lässt sich durch die Messung dieser Zyklotronfrequenz die Masse der Teilchen bestimmen.
Das funktioniert im Großen und Ganzen auch ganz gut, doch kleinste Fluktuationen bei der Magnetfeldstärke – hervorgerufen etwa durch die elektrisch betriebene Straßenbahn vor dem Labor oder das Handy vom Doktorand – beeinflussen die Messgenauigkeit. Was also tun?
Um das neue Messprinzip zu verstehen, müssen wir uns die Dynamik geladener Teilchen in der Penningfall noch ein wenig genauer betrachten: Denn da neben dem Magnetfeld auch noch elektrische Felder vorhanden sind, setzt sich die tatsächliche Bahn der Ionen nicht allein aus der kreisförmigen Zyklotronbewegung zusammen, zusätzlich müssen noch zwei weitere Bewegungskomponenten berücksichtigt werden: Das ist zum einen eine Schwingung in Richtung der Zylinderachse, die für ein stetes sinusförmiges Auf und Ab der Teilchen in der Falle sorgt. Zum anderen verschiebt sich der Mittelpunkt der Zyklotronbahn aufgrund des gleichzeitig anliegenden elektrischen Feldes kontinuierlich. Dieser Mittelpunkt beschreibt in der Ebene selbst eine Kreisbahn, die Magnetronbewegung.
Von dem Auf und Ab einmal abgesehen, lässt sich die Bewegung eines Ions in der Penningfalle gut mit der Bewegung des Erdmondes in unserem Sonnensystem vergleichen: So befindet sich das Erde-Mond-System auf einer annähernd kreisförmigen Bahn um unser Zentralgestirn – entsprechend der behäbigen Magnetronbewegung, der Mond indes kreist vergleichsweise schnell um die Erde – die Zyklotronbewegung.
Soweit das Prinzip der Penningfalle. Das Team um Rainville ließ nun zwei annähernd gleichschwere Ionen um gegenüberliegende Punkte des Magnetron-Orbits kreisen – so als würde ein zweiter Mond um eine zweite imaginäre Erde am gegenüberliegenden Punkt der Umlaufbahn um die Sonne rotieren. Die langsame Kreisbewegung der Magnetronbewegung sorgte im Experiment dafür, dass sich die Ionen nicht näher als ein Millimeter kamen. Das ist deshalb nötig, da sonst elektrostatische Wechselwirkungen zwischen den Ionen die Messungen stören.
So kreisten denn also ein Acetylen-Kation (13C2H2+) und ein Distickstoff-Kation (N2+) wochenlang umeinander, während die Forscher immer mal wieder die Zyklotronfrequenzen der beiden Ionen bestimmten. Daraus ließ sich schließlich das Massenverhältnis errechnen mit einer Messunsicherheit von lediglich 7·10-12. Zum Vergleich: Bislang ließ sich mit großem Aufwand maximal eine Messunsicherheit von 10-10 bei atomaren Massen erreichen. Bei der Messung am MIT störten hingegen noch nicht einmal die Magnetfeldfluktuationen durch den nahen Aufzug und die Bostoner U-Bahn.
Und wozu braucht man derart präzise Massemessungen? Rainville und Co führen gleich eine ganze Reihe von Möglichkeiten an: So ließe sich die Feinstrukturkonstante, deren langfristige Beständigkeit derzeit ohnehin angezweifelt wird, genauer bestimmen. Auf astrophysikalische Erkenntnisse könnte sich die atomare Massenbestimmung auswirken, wenn sie denn ein besseres Verständnis zur Entstehung schwerer Elemente liefert. Schließlich könnte die Messung zu einer besseren, weil genaueren Definition des Kilogramms führen. Immerhin handelt es sich dabei um die einzige physikalische Grundeinheit, die sich noch an einem Maßstab dem Ur-Kilogramm in Paris orientiert und nicht auf eine ortsunabhängige Messvorschrift zurückzuführen ist. Selbst das Gewicht einer chemischen Bindung respektive den Massenverlust durch die selbige könnte die Waage aufdecken, prognostizieren die Wissenschaftler. Dazu müsse das Verfahren jedoch soweit verbessert werden, dass noch einmal eine Größenordnung in der Messgenauigkeit gut gemacht wird – kein Ding der Unmöglichkeit, meinen die Forscher.

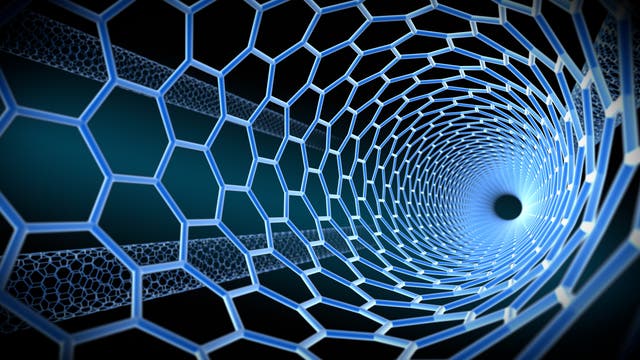


Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.