Stammzellen: »Herzpflaster« gegen Herzschwäche erfolgreich getestet
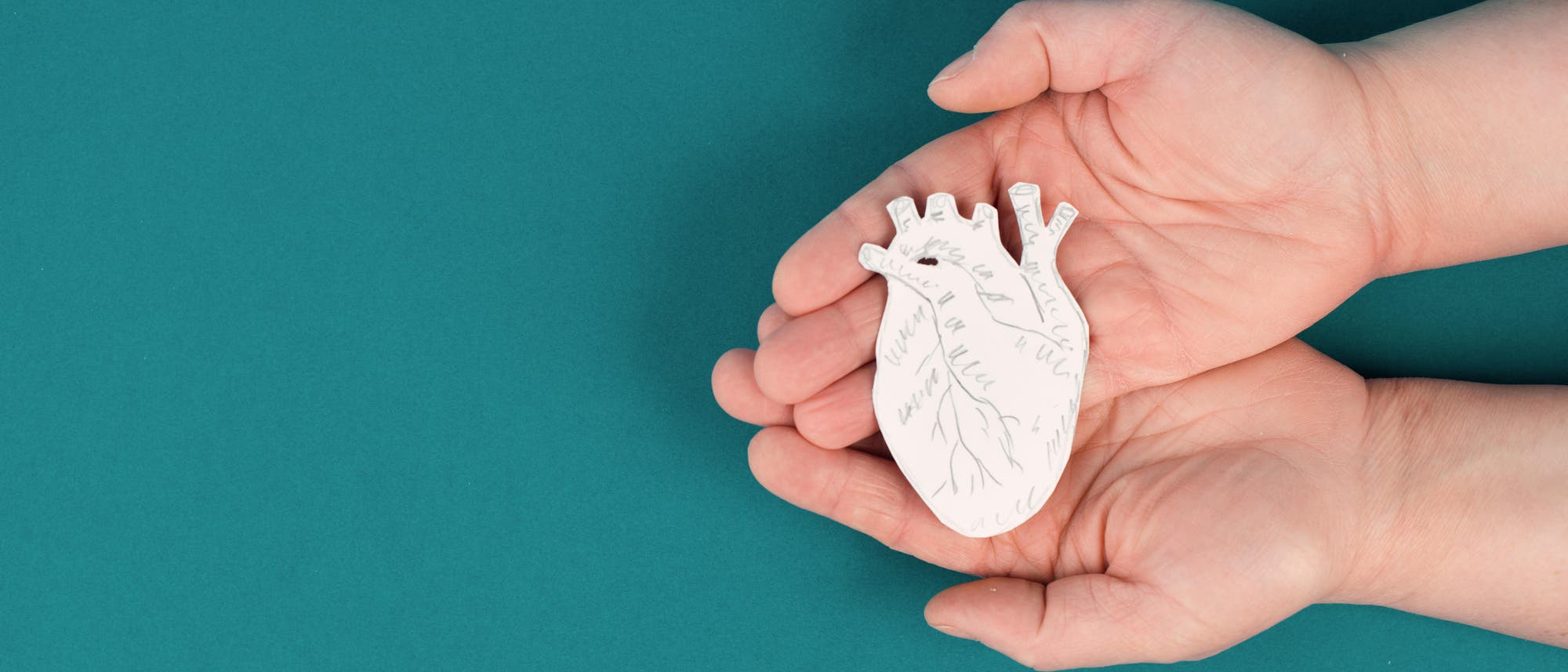
Ein aus Stammzellen gezüchtetes »Herzpflaster« könnte Menschen mit einer schweren Herzschwäche helfen. Das zeigt eine im Fachmagazin »Nature« veröffentlichte Machbarkeitsstudie. Das Team um Wolfram-Hubertus Zimmermann von der Universität Göttingen testete das Pflaster zunächst im Tiermodell und dann an einer menschlichen Patientin. Nach viel versprechenden Ergebnissen wurde die Erprobung nun auf weitere Versuchsteilnehmer ausgedehnt.
Mit Hilfe des »Pflasters« soll der Herzmuskel gestärkt und die Pumpleistung verbessert werden. Dazu verwandeln die Fachleute menschliche Körperzellen in so genannte induzierte pluripotente Stammzellen (iPS-Zellen), die sich anschließend zu verschiedenen Körperzellen ausdifferenzieren können – im Fall des »Herzpflasters« waren dies Herzmuskelzellen und Bindegewebszellen. Das so gezüchtete Gewebe wird durch eine OP auf den geschädigten Muskel aufgebracht, wo es sich mit dem bestehenden Organ verbinden und dieses stärken soll.
Nach erfolgreichen Tests an Ratten und Rhesusaffen studierten die Forschenden die Wirksamkeit ihres Ansatzes an einer Frau mit fortgeschrittener Herzschwäche. Zimmermann und Kollegen implantierten ihr ein Pflaster mit 400 Millionen Zellen. Drei Monate später erhielt die Patientin dann wie geplant ein Spenderorgan. Innerhalb dieser drei Monate habe sich die Pumpleistung bereits von 35 auf 39 Prozent erhöht, erklärte Zimmermann gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Bei gesunden Menschen liegt sie dem Mediziner zufolge bei etwa 60 Prozent.
Inzwischen sei die klinische Studie ausgeweitet worden: 15 Personen hätten bereits ein Implantat erhalten, 53 sollen es insgesamt werden. Über erste Ergebnisse will die Gruppe Ende 2025 informieren.
Die Zielgruppe für die Behandlung sind vor allem Patienten mit schwerer Herzschwäche, die etwa auf ein Spenderorgan warten. Rund 200 000 Menschen kämen dafür deutschlandweit in Frage. Sollte sich das Implantat bewähren, könnte es auch als Dauerlösung eingesetzt werden, überlegen nun die Forscher. Da die Stammzellen nicht aus körpereigenem Gewebe stammen, müssen allerdings nach der Implantation dauerhaft Immunsuppressiva eingenommen werden. Hinweise auf Nebenwirkungen oder ein erhöhtes Tumorrisiko habe man bislang nicht beobachtet.
Experimente mit Stammzellen zur Herzmuskelreparatur gibt es bereits seit Längerem. Eine besondere Schwierigkeit besteht darin, dafür zu sorgen, dass sich die neu gebildeten Herzmuskelzellen in das geschädigte Herz integrieren. Der Einsatz von »Pflastern« könnte sich als Erfolg versprechende Lösung erweisen.
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.