Fazit der Kepler-Mission: 1000 neue Welten, aber keine zweite Erde
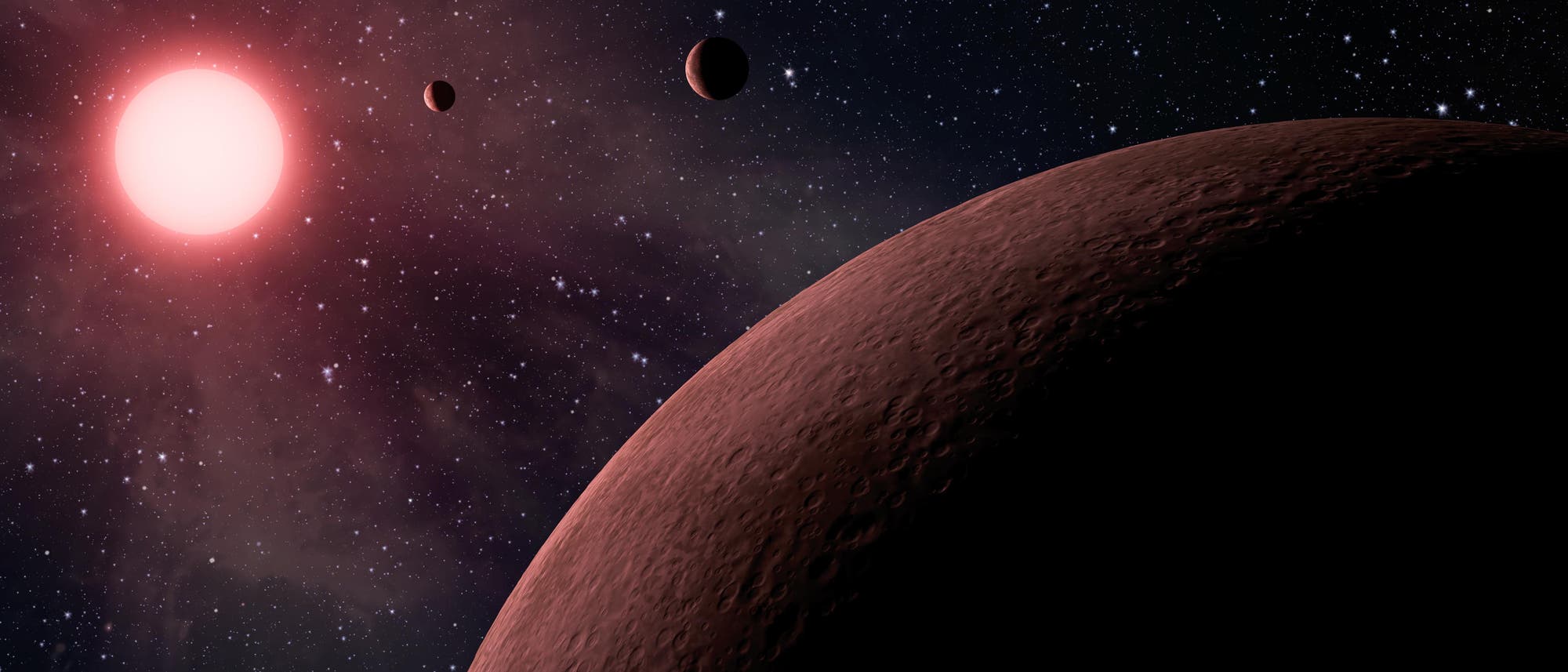
Es wäre albern, von dieser Mission enttäuscht zu sein. Schließlich hat das Weltraumteleskop Kepler 2335 Exoplaneten entdeckt, außerdem 1799 Signale, hinter denen sich ebenfalls Planeten außerhalb des Sonnensystems verbergen könnten. So steht es im nun vollständigen Beobachtungskatalog der Mission, den die NASA veröffentlicht hat. Die Exoplaneten-Datenbank ruft in Erinnerung, wie erfolgreich der Forschungssatellit war: Vor seinem Start waren gerade mal einige hundert ferne Welten bekannt.
Die nun vollständigen Daten der Hauptmission von Kepler, die von 2009 bis 2013 lief, halten aber auch eine Enttäuschung bereit: Das Teleskop hat kein echtes Abbild der Erde gefunden, auch wenn man in Medienberichten in vergangenen Jahren immer wieder diesen Eindruck gewinnen konnte. Kepler hat dutzende Planeten entdeckt, die unserer Heimat ähneln. Aber sie alle unterscheiden sich von der Erde in wesentlichen Punkten, sei es durch ihre Größe, ihre Umlaufbahn, oder die Eigenschaften ihrer Sonne.
Damit rückt ein Hauptziel der Exoplaneten-Forschung in weite Ferne: einen Planeten aufzuspüren, der unserem zum Verwechseln ähnlich ist; eine erdgroße Felskugel, die einen Stern wie die Sonne binnen 365 Tagen genau einmal umrundet. Eine Welt also, über die selbst Skeptiker sagen müssten: Hier bestünde eine ernst zu nehmende Chance auf extraterrestrisches Leben und vielleicht sogar Intelligenz.
Kepler ist ein Satellit für Statistiker
Damit kein Missverständnis entsteht: Das Aufspüren einer zweiten Erde war nie das zentrale Motiv von Kepler. Das 95-Zentimeter-Teleskop war nie als Paparazzo gedacht, der die spektakulärsten Sternsysteme im All ablichten sollte. Astronomen sahen in dem Satelliten vom Format eines Kleinwagens vielmehr einen Demoskopen, der den ersten aussagekräftigen Planetenzensus der Milchstraße durchführen sollte. Deshalb blickt der Späher in eine weit entfernte Region unserer Galaxie und studiert nicht etwa unsere unmittelbare kosmische Nachbarschaft.
Allen voran interessierte die Astronomen, wie häufig potenziell bewohnbare Felsplaneten im Orbit sonnenähnlicher Sterne sind. Dazu blickte Kepler von Mai 2009 bis 2013 auf einen kleinen Himmelsausschnitt im Sternbild Schwan. Dort beobachtete der Satellit etwa 170 000 Sterne und hielt nach winzigen Helligkeitsschwankungen Ausschau. Registrierte die Elektronik bei einem Stern periodisch wiederkehrende Verdunklungen, schlossen die Wissenschaftler auf die Existenz eines Planeten im Orbit. Die Häufigkeit der so entdeckten Welten wollte das Kepler-Team dann auf die ganze Milchstraße hochrechnen, was bei vielen Planetentypen auch gelungen ist.
Kepler offenbarte dabei eine planetare Vielfalt, die nur wenige Forscher erwartet hatten. Das Weltall ist voller exotischer Welten, die in allerlei Größen und Temperaturen daherkommen: heiße Gasriesen, brodelnde Lavahöllen, felsige Super-Erden und Minineptune. Sie alle sind den Kepler-Daten zufolge extrem häufig in der Milchstraße.
Auf knapp 50 Planeten könnte Wasser fließen
Die größte Aufmerksamkeit wurde indes jenen erdähnlichen Felsplaneten zuteil, die Kepler aufspürte. Im Katalog der Mission finden sich knapp 50 Welten, auf denen Wasser fließen könnte. Fast ausnahmslos sind sie ein gutes Stück größer als die Erde oder befinden sich dichter an ihrem Stern. Die größte Ähnlichkeit weist ein Planetenkandidat namens KOI 7711.01 auf, dessen Existenz den Forschern zufolge allerdings erst zu 90 Prozent gesichert ist.
KOI 7711.01 hätte einen um 30 Prozent größeren Durchmesser als unsere Heimat und würde seinen Stern alle 305 Tage einmal umrunden. Eine echte "Zwillingserde" ist der mutmaßliche Planet damit nicht. Wieso aber sind nicht mehr vergleichbare Welten aufgetaucht? Das kann bedeuten, dass es sie einfach nur selten auf erdähnlichen Umlaufbahnen gibt. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass Kepler einfach nicht genügend Daten hat sammeln können, um seinen Zensus auch auf die äußeren Regionen der Planetensysteme ausdehnen zu können.
Dazu dürften im Wesentlichen zwei Dinge beigetragen haben: Einerseits hatten die Forscher anfangs unterschätzt, wie stark Sterne flackern, was die Identifizierung von Erd-Analogons erschwerte. Als Ausgleich verlängerte die NASA die Mission, wodurch Kepler mehr als vier Jahre lang Daten hätte nehmen können. Dazu kam es allerdings nicht. Im Mai 2013, zwei Tage nach Keplers viertem Geburtstag, gab das zweite von vier Drallrädern den Geist auf. Das Teleskop verlor deshalb das Sternbild Schwan aus dem Blick – und beobachtet seitdem unter der Missionsbezeichnung "K2" für jeweils 80 Tage andere Himmelsregionen.
Während seiner bis 2013 währenden Hauptmission konnte Kepler daher fast nur Welten aufspüren, die ihrem Stern näher sind als die Erde der Sonne. Exoplaneten mit engen Umlaufbahnen sind viel einfacher nachzuweisen als weiter außen kreisende Welten. Denn Erstere ziehen häufiger zwischen Keplers Teleskopöffnung und ihrem Stern vorüber. Den Wissenschaftlern fällt es daher leichter, das periodische Planetensignal von natürlichen Helligkeitsschwankungen eines Sterns zu unterscheiden. Eine Zwillingserde würde hingegen nur einmal im Jahr zwischen ihrem Stern und der Optik von Kepler vorüberziehen.
Wie häufig sind Planeten wie die Erde?
Es ist offen, ob Astrophysiker mit dem nun vorliegenden Datensatz das eigentliche Missionsziel von Kepler erreichen können: eine Abschätzung, wie häufig Felsplaneten in lebensverträglichem Abstand um sonnenähnliche Sterne kreisen. Sind die Erde und KOI 7711.01 vergleichsweise selten? Oder am Ende fast genauso häufig wie Minineptune, von denen es zig Milliarden in der Milchstraß0e zu geben scheint?
Auf der Pressekonferenz im Juni hieß es, dass diese sehr schwierige Hochrechnung auf Basis des nun vollständigen Kepler-Katalogs noch folgen soll – und in einigen Jahren vorliegen könnte. Ein Blick auf die verfügbaren Daten zeigt allerdings, dass die Basis für Hochrechnungen in diesem Bereich des Katalogs sehr spärlich ist. Die meisten erdähnlichen Planeten benötigen weniger als 300 Tage für einen Umlauf, jenseits dieser Umlaufdauer hat Kepler nur ein paar einzelne Ausreißer nachgewiesen.
So bleiben die spannendsten bisher entdeckten Exoplaneten solche, die ihre Bahnen um kühlere Sterne ziehen. Bei derartigen Feuerbällen liegt der ringförmige Bereich, in dem Planeten auf lebenskompatible Temperaturen aufgeheizt werden (die "habitable Zone"), deutlich näher am Stern als in unserem Sonnensystem. Das macht allerdings die Diskussion über außerirdisches Leben komplizierter. Denn die Nähe zu einem Stern bringt aus exobiologischer Sicht handfeste Nachteile mit sich. So werden Planeten auf engen Umlaufbahnen häufiger von starken Sonneneruptionen getroffen. Und mitunter zerrt die Schwerkraft so stark an ihnen, dass sie ihrem Stern stets die gleiche Seite zuwenden.
Dem begegnen Astrophysiker in der Regel mit Optimismus: Leben könnte auch unter solch widrigen Bedingungen eine Nische finden, argumentieren sie. Starke Magnetfelder und dichte Atmosphären könnten das Leben auf der Oberfläche schützen. Völlig von der Hand zu weisen ist das nicht, schließlich weiß man praktisch nichts darüber, wie Felsplaneten in der Nähe eines Roten Zwergsterns aussehen. Spektralanalysen der Atmosphäre solcher Welten könnten in den nächsten Jahren erste Hinweise liefern. Sie werden aber vermutlich nicht abschließend klären können, was auf der Oberfläche solcher Exoplaneten wirklich vorgeht.
Rote Zwergsterne im Visier
Die Existenz eines erdgleichen Planeten, der einen Stern wie die Sonne in dem uns vertrauten Abstand umkreist, wäre zwar auch noch kein Beweis für außerirdisches Leben. Aber solch eine Zwillingserde würde aus Sicht von Astrobiologen dennoch in einer anderen Liga spielen als alle bisher bekannten Exoplaneten. Hier entfielen viele der Widrigkeiten, die enge Planetenorbits um kühle Sterne mit sich bringen.
Leider sind große Fortschritte bei der Suche nach einer Zwillingserde in Zukunft nicht zu erwarten. Vor Kurzem hat die ESA zwar das Exoplaneten-Weltraumteleskop PLATO genehmigt, das 2026 starten soll und sich die Suche nach einer Zwillingserde auf die Fahnen geschrieben hat. Die Teleskope an Bord der Raumsonde sollen allerdings nur zwei bis drei Jahre lang bestimmte Himmelsregionen mustern. Wenn es bei diesem Plan bleibt, könnte PLATO wohl nur Planeten nachweisen, die weniger als ein Jahr für ihren Umlauf benötigen.
Alle anderen geplanten Teleskope werden derweil vor allem Rote Zwerge ins Visier nehmen – kleine, besonders kühle Sterne, bei denen Exoplaneten sehr leicht nachweisbar sind. TESS, der nächste Exoplaneten-Satellit der NASA, soll 2018 starten und unsere kosmische Nachbarschaft nach erdähnlichen Planeten im Orbit dieser stellaren Leichtgewichte durchforsten. Vermutlich wird die Mission mehrere nah gelegene Planetensysteme aufspüren, die ähnlich spektakulär wie TRAPPIST-1 sind, jenem mittlerweile berühmten Sternsystem, in dem gleich sieben erdgroße Kugeln dicht um einen kalten Zwergstern kreisen.
TESS ist aber gewissermaßen nur ein Trostpflaster. Die Exoplaneten-Community ist vor Jahren mit einem weit ambitionierteren Plan gescheitert: Die Astronomen wollten mehrere Satelliten-Teleskope ins All schießen, die dort zusammengeschaltet werden sollten und so Fotos von Planeten auf erdähnlichen Orbits ermöglicht hätten. Aber die Arbeit an diesem Terrestrial Planet Finder wurde 2011 auf Eis gelegt. Potenzielle Alternativen, die einen riesigen Fächer zur Ausblendung störenden Sternenlichts vor der Teleskopöffnung parken wollen, sind bisher nicht über die Konzeptphase hinausgekommen.
Sauerstoff, Methan und andere Spuren des Lebens
Stattdessen ruhen die Hoffnungen nun auf dem James Webb Space Telescope (JWST), dem für 2018 geplanten Hubble-Nachfolger. Das Infrarot-Teleskop wurde eigentlich für die Beobachtung des frühen Universums konzipiert, kann jedoch auch einen Blick auf die Atmosphären von Exoplaneten werfen, sofern diese vor ihrem Stern vorüberziehen. Experten schätzen, dass die zur Verfügung stehende Beobachtungszeit für das Studium einer Hand voll erdgroßer Exoplaneten in unserer kosmischen Nachbarschaft reichen wird.
Diese werden auch die bodengebundene Großteleskope der nächsten Generation in den Fokus nehmen, die Mitte der 2020er Jahre den Betrieb aufnehmen sollen. Wenn alles nach Plan läuft, werden sie und das JWST die Frage beantworten, was für Gase in den Atmosphären erdähnlicher Planeten im Orbit Roter Zwerge schweben. Nicht auszuschließen, dass sie dabei auf Sauerstoff, Methan und andere Stoffe stoßen, die auf der Erde mit biologischer Aktivität in Verbindung stehen.
Viele dieser Gase können aber auch einen geologischen Ursprung haben. Dass man allein mit ihnen den eindeutigen Nachweis für außerirdisches Leben erbringen kann, ist fraglich. Aber vielleicht werden die resultierenden Debatten die Steuerzahler so sehr begeistern, dass sie bereit sind, die Suche nach einer echten Zwillingserde zu finanzieren: nach einer Welt, die unserer bis ins Detail gleicht, und die es irgendwo da draußen eigentlich geben müsste – vielleicht sogar mehr als einmal.
Schreiben Sie uns!
2 Beiträge anzeigen