Lobes Digitalfabrik: Mit Daten Geld verdienen?

Das Dilemma des digitalen Kapitalismus ist, dass die Konsumenten den Unternehmen zwar massiv Daten generieren, aber oft keinen Cent dafür sehen. Facebook macht mit der Auswertung von Nutzerdaten Milliardengewinne. Der Nutzer selbst wird daran nicht beteiligt. Auch wer Google-Dienste verwendet, erhält kein Geld dafür, dass er dem Internetkonzern Such- und Positionsdaten liefert, die dieser dann monetarisiert. Daten gegen kostenlose Dienste, so lautet stattdessen der Deal im Datenkapitalismus. Dass man diese Dienste mit seinen personenbezogenen Daten beziehungsweise mit seiner Privatsphäre (teuer) bezahlt, ist allgemein bekannt, wird aber von den meisten stillschweigend akzeptiert.
Mittlerweile gibt es jedoch einige Plattformen, die dieses Geschäftsmodell umkehren. So vergütet beispielsweise das Unternehmen Wibson Daten mit Treuepunkten (Wibson Points), die gegen Spotify-Premium-Accounts, Visa-Geschenkkarten oder Uber-Gutscheine eingetauscht werden können. Der Datenverkäufer, also der Nutzer, kann beispielsweise sein Facebook-Profil, seine Jogging-Route auf der Fitness-App Strava oder die Geräteinformationen seines Smartphones mit der App verknüpfen. Die Datenpakete werden dann auf einer Art Online-Marktplatz gehandelt. Hier können Interessenten darauf bieten. Nimmt der Verkäufer das Angebot an, wird über die Blockchain ein Vertrag geschlossen (genauer gesagt ein Smart Contract, der automatisch Rechtsfolgen auslösen kann). Auch die Transaktion erfolgt über das Protokoll. Wer seine Standortdaten verkauft, erhält 15 Punkte, für das LinkedIn-Profil gibt es noch mal 20 Punkte. »Schenken Sie Ihre Daten nicht her. Machen Sie Profit«, wirbt das Unternehmen auf seiner Website.
Für eine Gutschrift von umgerechnet knapp neun Euro bei Visa oder einen Monat Spotify benötigt man rund 400 Punkte. Reichtümer lassen sich dadurch nicht erwerben, aber zumindest ein nettes Zubrot, zumal sich Daten mehrmals verkaufen lassen. Mit Datum.org gibt es eine weitere blockchainbasierte Plattform, die Datenverkäufer und Käufer zusammenbringt. In der Schweiz hat das Start-up Bitsabout.me einen Online-Marktplatz eröffnet, auf dem Privatnutzer ihre Daten zum Verkauf anbieten können. Das Prinzip funktioniert ähnlich wie bei Wibson: Der Nutzer importiert Daten, zum Beispiel von seinem Facebook- oder Twitter-Profil, die dann auf dem Datenmarktplatz gehandelt werden. In der App erhält er dann Angebote. Die Besonderheit liegt darin, dass nur einige lizenzierte Marktteilnehmer, etwa die ETH Zürich, der Einzelhändler Loeb sowie einige Onlinehändler auf die Daten bieten können. So wird sichergestellt, dass die Daten nur in der Schweiz gehandelt werden.
Muss man sich Privatsphäre künftig leisten können?
Das Start-up betont auf seiner Website, dass der Handel datenschutzkonform erfolgt und die Daten sicher sind. Das erklärte Ziel ist es, den Nutzern die Kontrolle über ihre Daten zurückzugeben und einen fairen Datenhandel zu etablieren. »Wir haben das Marktplatzmodell gewählt, um langfristig eine individuelle Preisfindung zu unterstützen«, sagt Christian Kunz, der Gründer der Plattform. »Bei uns werden die Preise immer durch den Datenanfrager festgelegt.« Die Preisspanne für die gleiche Art von Daten variiere je nach Nutzer. Für einfache Newsletter-Kampagnen ließen sich zwischen einem und zwei Franken erzielen, umfangreiche Geo-Datensätze für ein Forschungsprojekt seien für zehn Franken verkauft worden. Die Preise für detaillierte Einkaufsdaten (Warenkörbe) von Migros/Coop liegen aktuell bei fünf Franken, so Kunz. In der Summe konnte ein Nutzer seit Dezember einen Gesamtwert (Bargeld und Sachwerte) von rund 100 Franken erwirtschaften. Das Start-up will auch in Deutschland an den Start gehen.
Die Idee, Nutzer für ihre Daten zu entlohnen, hat gewiss Charme, stößt aber in der Praxis auf Schwierigkeiten. Die Beträge, die sich mit dem Verkauf von Datenpaketen erzielen lassen, stehen in keinem Verhältnis zu den Milliardengewinnen der Internetkonzerne. Vor allem indiziert der geringe materielle Wert von Daten, dass Online-Identitäten und damit Menschen kaum etwas wert sind. Wer wie der VR-Pionier Jaron Lanier einen Datenarbeitsmarkt schaffen will, riskiert, dass die digitale Kluft größer wird. Die Reichen könnten ihre Daten für sich behalten. Die Armen müssten sich mit ihren Daten prostituieren.
Schon heute ist zu beobachten, dass Privatsphäre zunehmend zu einer Frage der Klasse wird. Im New Yorker Stadtteil Brooklyn protestierten Bewohner eines Wohnblocks gegen die Pläne der Vermieter, Gesichtserkennungssysteme am Eingang zu installieren. »Wir wollen nicht wie Tiere getaggt werden«, zitierte der »Guardian« eine Anwohnerin. Das Start-up Roomrs vermietet günstige möblierte Zimmer in New York, die mit smarten Matratzen und Amazon Echo ausgestattet sind. Der Mieter zahlt die günstige Miete mit seinen personenbezogenen Daten. Was die Frage aufwirft: Muss man sich Privatsphäre künftig leisten können?
Um die Entstehung einer informationellen Zweiklassengesellschaft zu verhindern, wäre es sinnvoll, sich über fairere Marktbedingungen im Datenkapitalismus Gedanken zu machen. Wie frei ist der Nutzer in der Überlassung seiner Daten? Wer hat Zugang zu Daten? Wie erlangt man die Kontrolle über seine Daten? Wie wird Transparenz hergestellt?
Als Blaupause eignet sich ein Modell, welches das Start-up Streamr entwickelt hat. Auf einer Open-Source-Plattform würden in Echtzeit Verkehrsdaten gehandelt. Die Idee: Der Fahrer eines Autos, das Daten über Stau und Straßenqualität erhebt, könnte diese an Autobahnen, Teilehersteller oder Smart-City-Betreiber verkaufen. Im Gegenzug würde der Fahrzeughalter Daten über die besten Strompreise, Schlaglöcher oder das Wetter erhalten, die in der Smart-City-Infrastruktur gesammelt und beim Vorbeifahren an Sensoren in das Auto eingespeist werden. Durch das Tauschgeschäft ließe sich das »Fahrerlebnis« optimieren, ohne dass der Fahrer seine Daten für ein paar Cent veräußern muss. Eine Win-win-Situation.
Autos sammeln jede Menge Daten über das Fahrverhalten, etwa Brems- oder Beschleunigungsvorgänge. Auf die einzelnen Steuergeräte haben aber meist nur Werkstätten oder die Hersteller Zugriff. Durch eine Open-Source-Plattform wäre der gleichberechtigte Zugang zu Daten, die ja nicht bloß Rohstoff, sondern auch Information sind, gesichert.
Eine marktwirtschaftliche Alternative wäre eine Art Emissionsrechtehandel mit Daten. Große Datenverwerter wie Facebook müssten für die Daten, die sie raffinieren und in die Umwelt emittieren, Zertifikate erwerben. Irgendwann würden diese Zertifikate weniger, und die Datenverwerter müssten so etwas wie digitale Schürfrechte erwerben. Das wäre einerseits ein Anreiz zur Datensparsamkeit, andererseits ein regulatorischer Weg, schonend mit personenbezogenen Daten umzugehen. Ob sich Big Tech auf eine solche Verknappung seines Rohstoffs einlässt, ist fraglich. Doch die Debatte über faire Marktbedingungen und neue Wege der Datenmonetarisierung ist notwendig.



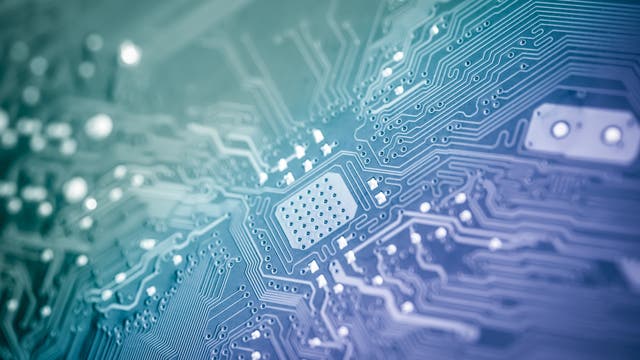

Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben