Perkolationstheorie: Mathematik verbindet
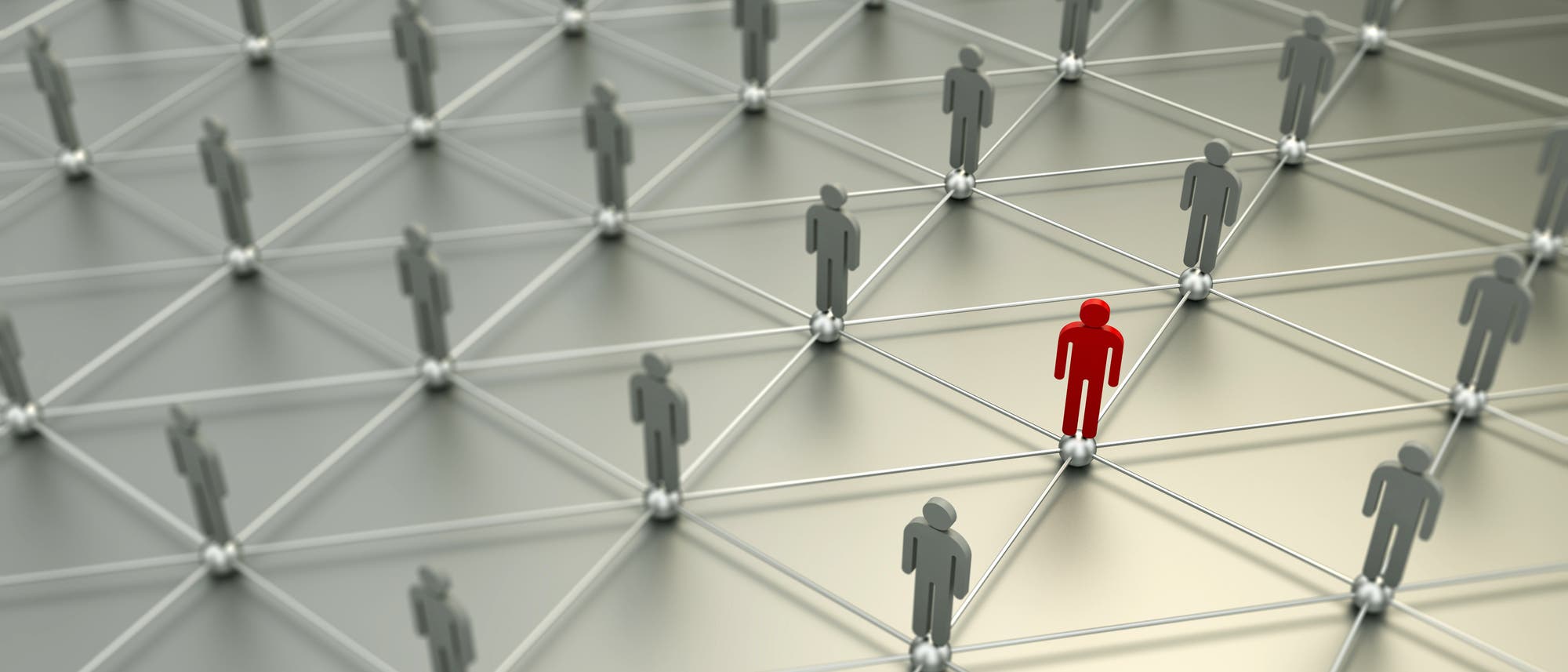
Viele Menschen gehen wahrscheinlich davon aus, das Klicken auf »Senden« befördere eine Textnachricht direkt an das Telefon des Empfängers. In Wirklichkeit begibt sie sich aber auf eine lange Reise durch ein Mobilfunknetz oder das Internet, bis sie bei ihrem Ziel ankommt. Das funktioniert zwar recht zuverlässig, doch die Übertragung benötigt eine zentrale Infrastruktur, die Naturkatastrophen beschädigen oder repressive Regierungen abschalten beziehungsweise überwachen können. Weil Demonstranten in Hongkong Letzteres fürchteten, verzichteten sie darauf, über das Internet zu kommunizieren. Stattdessen nutzten sie Software wie FireChat und Bridgefy, die Nachrichten direkt zwischen nahegelegenen Geräten übertragen.
Die Apps lassen Daten unbemerkt von einem Nutzer zum nächsten hüpfen, wobei nur der Absender und der Empfänger den Text lesen können. Die verbundenen Handys bilden ein so genanntes vermaschtes Netzwerk, das eine flexible und dezentrale Art des Kontakts ermöglicht. Doch damit sich zwei Personen austauschen können, müssen sie über eine Kette anderer, benachbarter Geräte zusammenhängen.
Wie viele Nutzer braucht ein vermaschtes Netz, um quer durch Hongkong kommunizieren zu können? Die Perkolationstheorie, ein Teilgebiet der Mathematik, liefert eine überraschende Antwort: Schon wenige Menschen machen den Unterschied aus. Während Personen einem Netz beitreten, bilden sich langsam isolierte Bereiche verbundener Geräte aus. Eine vollständige Kommunikation von Ost nach West oder Nord nach Süd entsteht jedoch ganz plötzlich, sobald die Nutzerdichte eine kritische Schwelle überschreitet. Fachleute bezeichnen ein solches Phänomen als Phasenübergang – dasselbe Konzept, mit dem sich abrupte Änderungen im Zustand eines Materials wie das Schmelzen von Eis oder das Sieden von Wasser erklären lassen.
Die Perkolationstheorie untersucht das Verhalten von Netzwerken, denen man zufällig Punkte hinzufügt oder entfernt …

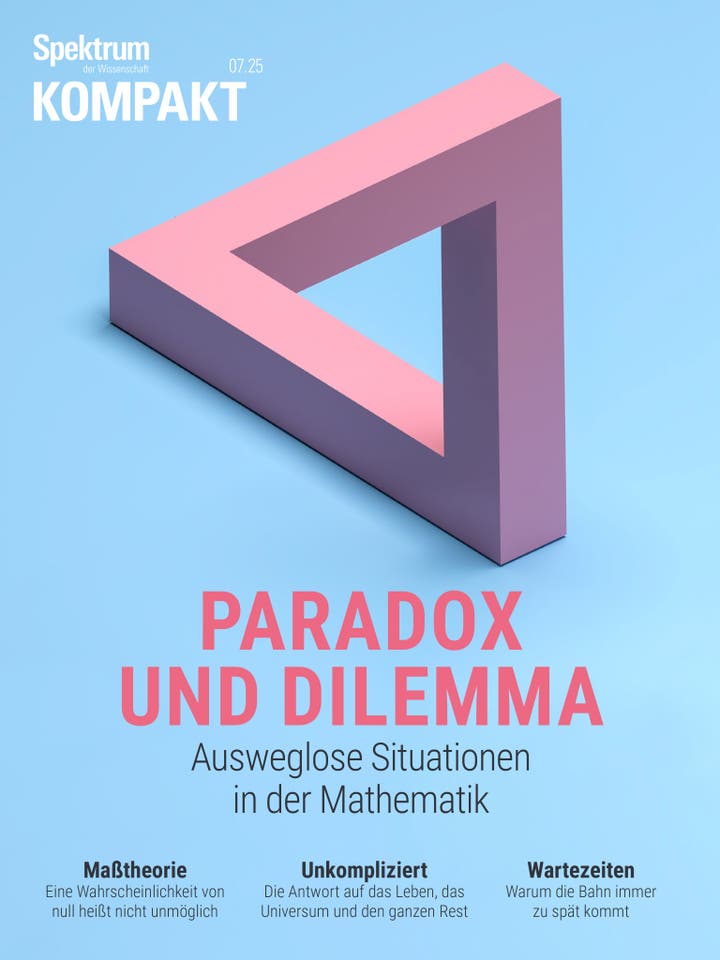






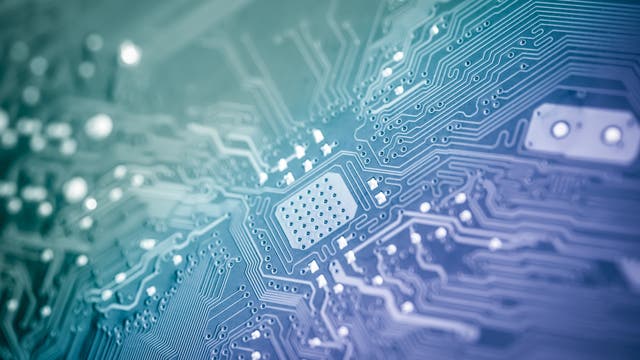
Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben