Quantengravitation: Nachweis von Gravitonen scheint möglich
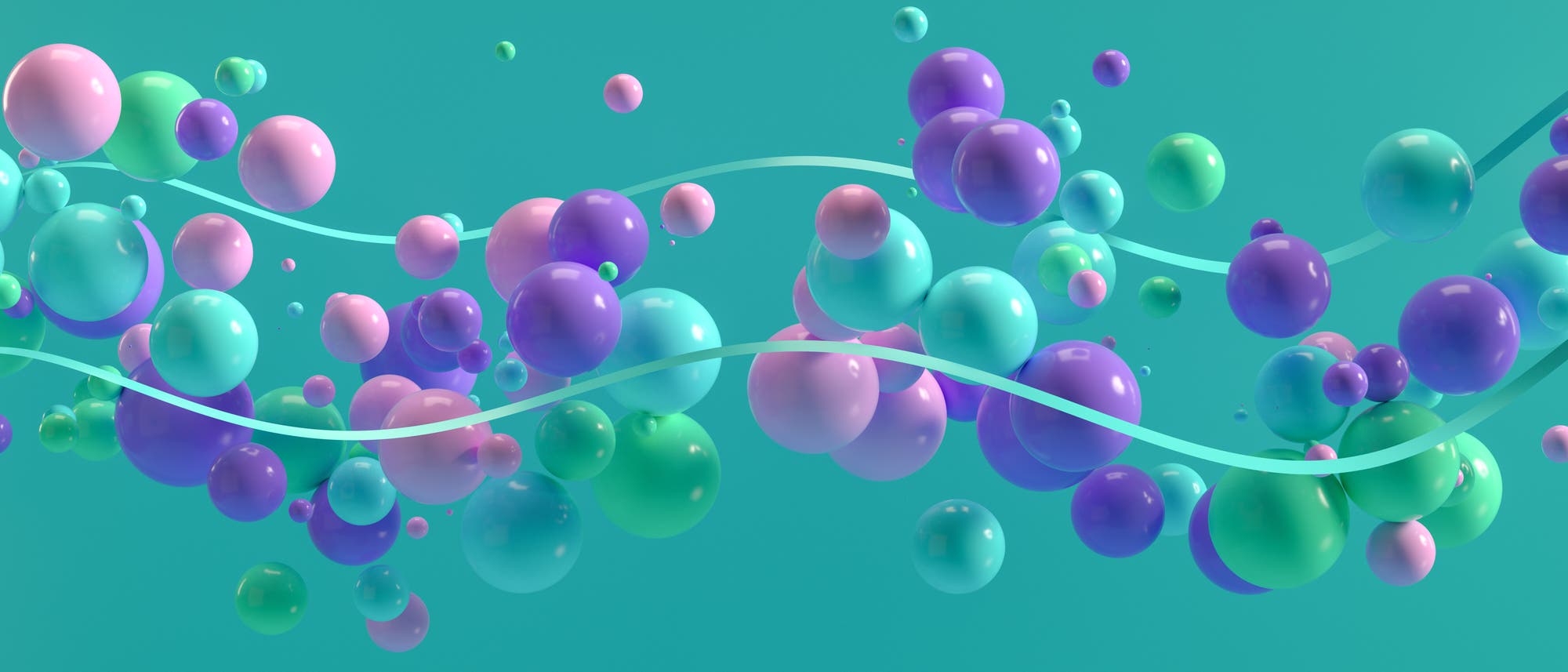
Es gilt als das ultimative physikalische Experiment. Seit mehr als 100 Jahren wird die Existenz so genannter Gravitonen vermutet, der Teilchen, welche die Schwerkraft vermitteln sollen. Bisher hieß es jedoch immer, ein Nachweis sei nicht realisierbar: Man bräuchte einen erdgroßen Detektor, der die Sonne umkreist, um alle Milliarden Jahre mal ein Graviton einzufangen. Wollte man ein solches Teilchen pro Jahrzehnt detektieren, so eine andere Berechnung, müsste man ein Gerät von der Größe Jupiters neben einem Neutronenstern platzieren. Kurz gesagt: völlig unmöglich.
Doch eine neue Versuchsidee widerspricht solchen Schätzungen. Eine Forschungsgruppe hat einen Weg vorgestellt, um mit Hilfe von Quantentechnologien ein Graviton nachzuweisen - oder zumindest ein Quantenereignis, das eng mit einem Graviton verbunden ist. Das Experiment wäre immer noch eine Mammutaufgabe, aber es könnte mit der verfügbaren Technik in den nächsten Jahren umgesetzt werden.
»Das könnte mit ein paar Jahren Forschung erreicht werden«, bekräftigt der Experimentalphysiker Matteo Fadel von der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich, der nicht an der Arbeit beteiligt war. »Es ist ein sehr origineller und gut durchdachter Vorschlag«, stimmt der Physik-Nobelpreisträger Frank Wilczek vom Massachusetts Institute of Technology zu. »Das wäre ein echter Fortschritt auf diesem Gebiet.«
Die allgemeine Relativitätstheorie von Albert Einstein führt die Schwerkraft auf die Krümmung des Raum-Zeit-Gefüges zurück. Ein Nachweis von Gravitonen würde jedoch beweisen, dass die Gravitation in Form von Quantenteilchen auftritt - so wie der Elektromagnetismus und die übrigen zwei Grundkräfte, die starke und die schwache Kernkraft. Die meisten Fachleute gehen davon aus, dass die Schwerkraft ebenfalls Quanteneigenschaften besitzt. Doch bisher war die Suche nach einer Theorie, die eine solche Form der Quantengravitation beschreibt, erfolglos. Die Entdeckung des Gravitons würde zwar keine Theorie liefern – sie würde aber immerhin bestätigen, dass die Forschenden auf dem richtigen Weg sind.
Die Idee hinter dem vorgeschlagenen Experiment ist zwar recht simpel, aber ein positiver Ausgang ließe sich unterschiedlich deuten. Die einfachste Erklärung wäre die Existenz von Gravitonen. Allerdings haben Fachleute bereits alternative Interpretationen gefunden, die ohne diese Teilchen auskommen.
Die Diskussion erinnert an eine weitgehend vergessene Episode, die sich am Anfang des Quantenzeitalters zutrug. Im Jahr 1905 folgerte Albert Einstein aus experimentellen Daten, dass Licht aus Teilchen besteht, die heute Photonen genannt werden. Andere, darunter seine Kollegen Niels Bohr und Max Planck, glaubten zunächst weiterhin an die klassische Wellennatur des Lichts. Es dauerte noch 70 Jahre bis zum unbestreitbaren Nachweis, dass Licht quantisiert ist.
Die meisten Fachleute gehen davon aus, dass alles in der Welt den Regeln der Quantenphysik folgt, auch die Schwerkraft. Der Versuch, diese Annahme zu belegen, wird von neuen Debatten begleitet, ganz ähnlich wie bei der Entdeckung des Photons. Die ersten Skeptiker haben sich schon zu Wort gemeldet.
Eine sprunghafte Schwerkraft
Es ist schwierig, die Gravitation experimentell zu erforschen, weil sie im Vergleich zu den anderen Grundkräften sehr schwach ist. Es braucht riesige Massen wie Planeten, um die Raumzeit merklich zu verzerren und eine spürbare Anziehungskraft zu erzeugen. Das ist bei der elektromagnetischen Kraft ganz anders. Bereits ein daumennagelgroßer Magnet haftet an einem Kühlschrank.
Eine Möglichkeit, die fundamentalen Kräfte zu untersuchen, besteht darin, ein Objekt anzustupsen und dann die Wellen zu beobachten, die sich infolgedessen ausbreiten. Wackelt man an einem elektrisch geladenen Teilchen, sendet es Licht aus; bei massereichen Objekten entstehen Gravitationswellen. Diese lassen sich im Gegensatz zu Licht allerdings nicht mit dem bloßen Auge wahrnehmen. Erst nach jahrzehntelangen Bemühungen und dem Bau von kilometerlangen Detektoren wie LIGO, dem Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory, wurde 2015 erstmals ein Rumpeln in der Raumzeit gemessen - eine Erschütterung von der Kollision zweier Schwarzer Löcher.
Ein einzelnes Graviton nachzuweisen, wäre noch komplizierter. Es ist, als würde man ein Wassermolekül in einer Meereswelle wahrnehmen wollen. 2012 hielt der Physiker Freeman Dyson einen Vortrag über die Gravitationswellen der Sonne. Die heftigen Materieumwälzungen im Inneren des Sterns erschüttern ständig die Raumzeit. Falls Gravitonen existieren, würde in diesen Wellen gelegentlich eines auf ein Atom in einem hypothetischen Detektor treffen und ein Elektron auf ein höheres Energieniveau befördern. Allerdings rechnete Dyson aus, dass so etwas in einem Detektor von der Größe der Erde während der Lebensdauer der Sonne nur viermal passieren würde.
In dem Jahrzehnt, das seit Dysons Ausführungen vergangen ist, gab es jedoch zwei maßgebliche experimentelle Fortschritte. Erstens zeichnet LIGO regelmäßig Gravitationswellen von kollidierenden Schwarzen Löchern und Neutronensternen auf. Diese Ereignisse erschüttern die Raumzeit viel stärker als die Umwälzungen innerhalb der Sonne. Sie sorgen für eine regelrechte Flut an Gravitonen, im Gegensatz zum von Dyson berechneten Rinnsal. Und zweitens können Experimentalphysiker inzwischen immer subtilere Quantenphänomene hervorrufen und messen.
2016 stellte der theoretische Physiker Igor Pikovski, der inzwischen am Stevens Institute of Technology in New Jersey arbeitet, zusammen mit drei Kollegen Berechnungen zu supraflüssigem Helium an. Ein Behälter mit diesem Material, das trotz seiner großen Masse Quanteneigenschaften besitzt, ließe sich demnach so präparieren, dass er als Reaktion auf Gravitationswellen nachhallt. So hatten die Forscher eine alternative Messvorrichtung für Gravitationswellen beschrieben, die auf einem Quanteneffekt basiert.
Allerdings ist ein weiterer konzeptioneller Sprung nötig, um von einem Gravitationswellendetektor zu einem Detektor für einzelne Gravitonen zu kommen. In einer neueren Veröffentlichung, die im August 2024 in der Fachzeitschrift »Nature Communications« erschienen ist, skizzieren Pikovski und seine Koautoren, wie ein entsprechendes Gerät funktionieren könnte.
Ein umsetzbarer Graviton-Detektor
Zunächst wird ein 15 Kilogramm schwerer Stab aus Beryllium (oder einem ähnlichen Material) fast vollständig auf den absoluten Temperaturnullpunkt gekühlt. Da dem Stab jegliche Wärme entzogen wurde, befindet er sich im niedrigsten Energiezustand, dem Grundzustand. Alle Teilchen verhalten sich dann wie ein einzelnes Quantensystem, so als wären sie ein einziges, riesiges Atom.
Dann wartet man, bis eine Gravitationswelle aus den Tiefen des Weltraums vorbeizieht. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Graviton mit dem Berylliumstab wechselwirkt, ist gering. Aber manche Wellen müssten so viele dieser Teilchen enthalten, dass die Chance für eine Anregung insgesamt steigt. Die Gruppe berechnete, dass etwa eine von drei Gravitationswellen, wie sie typischerweise von kollidierenden Neutronensternen ausgehen, den Stab anregen würde. Damit wäre man Zeuge eines durch die Schwerkraft verursachten Quantenereignisses.
Von den vielen technischen Hürden, die es dafür zu überwinden gilt, besteht die größte darin, ein schweres Objekt in den Grundzustand zu versetzen und seine Anregung zu beobachten. Federführend in diesem Bereich ist Matteo Fadels Forschungsteam an der ETH Zürich, das winzige Saphirkristalle kühlt, bis sie ihre Quanteneigenschaften offenbaren. 2023 gelang es ihm, einen Kristall gleichzeitig in zwei Zustände zu versetzen - eine solche Überlagerung ist ein Kennzeichen für ein Quantensystem. Die Masse des Kristalls betrug 16 millionstel Gramm. Das ist für ein Quantenobjekt sehr schwer, aber immer noch eine halbe Milliarde Mal leichter als der von Pikovski und seinem Team beschriebene Berylliumstab. Dennoch hält Fadel den Vorschlag für realisierbar: »Es wäre nicht allzu verrückt.«
Pikovskis Versuchsidee - wie auch die von Dyson - ist an das Experiment angelehnt, das Einstein 1905 dazu veranlasste, die Existenz von Lichtquanten vorzuschlagen. »Wenn es durchgeführt wird, würde es den Forschungsstand in Bezug auf Gravitonen auf das gleiche Niveau bringen, den es 1905 für Photonen gab«, sagt Frank Wilczek.
In Lehrbüchern wird Einsteins Arbeit häufig als Nachweis für Photonen angeführt. Doch die wahre Geschichte ist viel interessanter. Denn anfangs lehnten viele Physiker Einsteins Theorie ab. Teils kam ihre Einsicht erst zwei Jahrzehnte später – und die allerletzten Zweifel wurden erst in den 1970er Jahren ausgeräumt.
Die wahre Geschichte des Photons
In den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts zeigten sich erste Risse im klassischen Fundament der Physik. Joseph John Thomson entdeckte, dass elektrische Ströme aus einzelnen Ladungseinheiten bestehen, den Elektronen. In der Zwischenzeit zerbrachen sich Fachleute den Kopf über eine Reihe von Experimenten, bei denen Licht einen Stromfluss erzeugte - ein Phänomen, das später als photoelektrischer Effekt bezeichnet wurde.
Das Rätsel bestand darin, dass der elektrische Strom mal floss und mal nicht. In der Prä-Quanten-Ära war das schwer zu erklären. Man ging davon aus, dass jede Welle zumindest einen kleinen Stromfluss erzeugen müsste; je heller der Lichtstrahl, desto stärker. Stattdessen schien es eine bestimmte Farbe zu geben - eine Frequenz -, die einen Strom hervorruft. Nur Wellen mit dieser oder höherer Frequenz konnten die Elektronen bewegen. Die Helligkeit des Lichts hatte damit wenig zu tun.
Einstein schlug 1905 eine Erklärung vor: Eine Lichtwelle besteht aus vielen diskreten Einheiten, so genannten Quanten, deren Energie proportional zu der Frequenz der Welle zunimmt. Je höher die Frequenz der Welle, desto energiereicher ihre Quanten. Und je heller die Welle, desto mehr Quanten gibt es. Wenn man versucht, mit niederfrequentem rotem Licht einen elektrischen Strom in einer Metallplatte zu erzeugen, wird man ebenso scheitern, wie wenn man versuchen würde, einen Kühlschrank mit Tischtennisbällen umzustoßen. Mit höherfrequentem blauem Licht hingegen ist es, als würde man Felsbrocken werfen. Jede dieser Einheiten hat genug Energie, um ein Elektron anzuregen – selbst bei schwachem Licht.
Einsteins Theorie wurde mit Skepsis aufgenommen. Anfangs hielten Physiker eisern an James Clerk Maxwells Theorie des Lichts als elektromagnetische Welle fest. Die Fachleute hatten gesehen, wie Licht gebrochen und gebeugt wird – und alles Übrige tut, was Wellen tun. Wie konnte es da aus Teilchen bestehen?
Selbst nachdem Einstein im Jahr 1921 den Nobelpreis für Physik für seine Erklärung des photoelektrischen Effekts erhalten hatte, gingen die Diskussionen weiter. Der Effekt deutete darauf hin, dass etwas gequantelt ist, denn sonst gäbe es keine Schwelle, um Elektronen in Bewegung zu setzen. Einige Fachleute, darunter Niels Bohr (einer der Begründer der Quantentheorie), erforschten jedoch weiterhin die Möglichkeit, dass nur die Materie gequantelt ist, nicht aber Licht. Heute nennt man diese Art von Theorie »semiklassisch«, weil sie ein klassisches Feld beschreibt, das mit quantisierter Materie wechselwirkt.
Um eine solche semiklassische Theorie zu verstehen, kann man sich ein Kind auf einer Schaukel vorstellen. Das übernimmt die Rolle eines Elektrons in einem Metall. Im Grundzustand ist es in Ruhe, im angeregten schwingt es. Eine klassische Welle stößt das Kind immer wieder an. Wenn das mit einer zufälligen Frequenz passiert, wackelt die Schaukel vielleicht ein wenig hin und her, das System bleibt im Prinzip aber im Grundzustand. Erst wenn man die richtige Frequenz trifft - die Resonanzfrequenz -, nimmt das Kind die Energie auf und beginnt zu schwingen. Elektronen in einem Metall sind ein wenig anders; sie schwingen mit einem ganzen Band von Frequenzen und nicht nur mit einer einzigen. Doch das Ergebnis ist dasselbe: Jede Welle unterhalb dieses Frequenzbands bewirkt nichts, während jede Welle innerhalb Elektronen anregt und einen Stromfluss auslöst.
»Wir sollten den revolutionären Bemühungen ein möglichst ehrenvolles Begräbnis geben«Niels Bohr, Quanten-Pionier
Einstein wurde schließlich bestätigt, aber nicht allein durch den photoelektrischen Effekt. Spätere Experimente, bei denen Elektronen und Photonen aufeinanderprallten, ergaben, dass auch der Impuls bloß häppchenweise auftritt. Das schloss die semiklassische Theorie von Licht und Materie aus. Als Bohr 1925 die Daten sah, stimmte er zu, »den revolutionären Bemühungen ein möglichst ehrenvolles Begräbnis zu geben«, und hieß das Licht in der Quantenwelt willkommen. Daraufhin wurden Lichtquanten als Photonen bekannt.
Nur wenige zweifelten nach 1925 noch die Existenz dieser Teilchen an, aber Physiker sind nun einmal gründlich. Bloß weil sich niemand eine brauchbare semiklassische Theorie vorstellen konnte, hieß das nicht, dass es sie nicht gab. Der endgültige Nachweis von Photonen erfolgte in den späten 1970er Jahren, als Quantenoptiker sekündlich einzelne Photonen auf einen Detektor feuerten und bestätigten, dass dieser daraufhin einmal pro Sekunde klickte. Das konnte keine klassische Theorie erklären. »Es türmten sich einfach die Beweise dafür, dass dieses Photonenkonzept nützlich und wichtig war«, sagt Wilczek.
Der Streit um Gravitonen
Im August 2023 lieferten die Physiker um Daniel Carney vom kalifornischen Lawrence Berkeley National Laboratory die ersten Argumente für eine erneute Diskussion um die Existenz von Quantenteilchen. Es begann damit, dass Carneys Kollege Nicholas Rodd eine ähnliche Idee wie Pikovski hatte, um Gravitonen nachzuweisen. »Wir waren sofort Feuer und Flamme«, erzählt Carney.
Doch als er und seine Kollegen sich in das Thema vertieften, stießen sie auf die Geschichte des Photons und auf die Anstrengungen, die Forschende in den 1970er Jahren unternommen hatten, um die letzten Zweifel zu beseitigen. Sie übertrugen diese Tests auf Gravitonen und stellten fest, dass Dyson Recht hatte. Für einen unumstößlichen Nachweis der Quanteneigenschaften der Schwerkraft müsste man einzelne Gravitonen nacheinander detektieren und bräuchte dafür eine Maschinerie von planetarischem Ausmaß. Pikovski schlug dagegen vor, ein einzelnes Graviton aus einem Tsunami herauszupicken. »Es ist verrückt, dass wir unsere Hypothese so schnell um 100 Prozent revidieren mussten«, so Carney.
Jetzt befinden sich die Gravitonenjäger in einer merkwürdigen Lage. In Bezug auf die Fakten sind sich alle einig. Der Nachweis eines Quantenereignisses, das durch eine Gravitationswelle ausgelöst wird, ist tatsächlich möglich. Aber ein solcher Nachweis würde nicht unumstößlich belegen, dass Gravitationswellen aus einzelnen Teilchen bestehen. »Könnte eine klassische Gravitationswelle das gleiche Signal erzeugen? Die Antwort ist Ja«, sagt Carney, der zusammen mit einer Theoretikerin und einem Theoretiker vom CERN in der Schweiz diese Art von Experiment im Februar 2024 in der Fachzeitschrift »Physical Review D« untersuchte.
»Das zeigt, dass man die Quantenmechanik auch auf Gravitationswellen anwenden sollte«Frank Wilczek, Nobelpreisträger
Für einige Fachleute würde ein geglücktes Experiment einen starken Hinweis darauf liefern, dass die Schwerkraft tatsächlich Quanteneigenschaften hat. Denn die Alternative - eine semiklassische Theorie der Schwerkraft und der Materie - birgt Probleme. Zum Beispiel verstößt sie gegen die Energieerhaltung: Wenn der Berylliumstab ein Quant an Energie gewinnt, muss die Gravitationswelle entsprechend die gleiche Energiemenge verloren haben; deshalb müsste sie auch quantisiert sein. Einstein führte dieses Argument 1911 für das Photon an. Semiklassische Theorien retten die klassische Schwerkraft, indem sie dieses Prinzip opfern. »Wenn man nicht sehr gekünstelte Interpretationen verwendet«, erklärt Wilczek, »zeigt das, dass man die Quantenmechanik auch auf Gravitationswellen anwenden sollte.«
Für Physiker wie Carney reicht ein starker Hinweis jedoch nicht aus. Ihm zufolge gibt es bereits eine Fülle von Indizien, dass die gesamte Realität quantisiert ist. Was wir brauchen, sind handfeste Beweise - Experimente, welche die verbleibenden Schlupflöcher schließen, egal wie bizarr sie erscheinen mögen.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.