Game of Thrones: Eine Saga für Realisten

Ein Team von Physikern, Mathematikern und Psychologen hat sich die Mühe gemacht, im Mammutwerk von George R. R. Martin sämtliche Interaktionen aller benannten Charaktere zu analysieren. Laut ihrer Statistik interagieren die 2000 Figuren rund 41 000-mal miteinander. Dabei schälte sich nach Meinung des Teams ein klarer Trend heraus: Gesamt betrachtet hat das Beziehungsgeflecht der Figuren typisch menschliche Eigenschaften.
Was sie sich darunter vorstellen, führen die Forscher um Thomas Gessey-Jones von der Unversity of Cambridge in der Fachzeitschrift »Proceedings of the National Academy of Sciences« aus. Beispielsweise übersteigt das persönliche Netzwerk einer Figur nicht das vor Jahren vom Evolutionspsychologen Robin Dunbar ermittelte Limit von rund 150 Personen. Mehr als 150 »Menschen, die man um einen Gefallen bitten würde«, so die informelle Definition des Oxforder Forschers, der ebenfalls an der Publikation mitwirkte, könne ein Mensch kognitiv nicht bewältigen.
Auch das Netz, das sich aus den Beziehungen der handelnden Personen untereinander ergibt, entspricht in seinen mathematischen Merkmalen einem typisch menschlichen – etwa was die Anzahl von Figuren mit herausgehobener Stellung und ihre Position im Netzwerk anbelangt.
Gleichzeitig entwickelt sich die Geschichte selbst in realistischer Manier, ergab die Analyse. Dabei blickten Gessey-Jones und sein Team vor allem auf die berüchtigten Todesfälle. Autor Martin ist bekannt dafür, dass er selbst zentrale Figuren für den Leser oder Zuschauer völlig unvorhersehbar sterben lässt – scheinbar nach dem Zufallsprinzip. Doch das wäre im Grunde unrealistisch und ist gar nicht der Fall, beobachteten die Forscher: Würde der reine Zufall walten, wäre die Zahl der Todesfälle über die Zeit gleich verteilt. Tatsächlich folgt der zeitliche Abstand der Todesfälle einem so genannten Potenzgesetz – ganz so, wie es auch in der echten Welt üblich ist.
Allerdings mit einer Einschränkung: Das gelte nur für die Abstände in der geschichtsinternen Chronologie, schreiben die Wissenschaftler. Misst man dagegen die Abstände der Todesfälle mit Blick auf einzelne Kapitel, zeigt sich ihren Rechnungen zufolge eine andere, viel gleichmäßigere Verteilung. Und diese wiederum wirke eben völlig unvorhersehbar.
Im Realismus der Figurenkonstellation und des Handlungsaufbaus sehen die Wissenschaftler eine große Stärke des Werks. Der »Trick« von Game of Thrones beziehungsweise der zu Grunde liegenden Bücherreihe »Das Lied von Eis und Feuer« sei es, Realismus und Unvorhersehbarkeit auf geistig anregende Weise zu mischen. Trotz der gigantischen Ausmaße der Welt von Game of Thrones bleibe die Geschichte innerhalb gewisser Grenzen, die sie für den Leser kognitiv beherrschbar machen – einfach weil sie denselben Mustern folge, die man aus dem Alltag gewohnt sei.

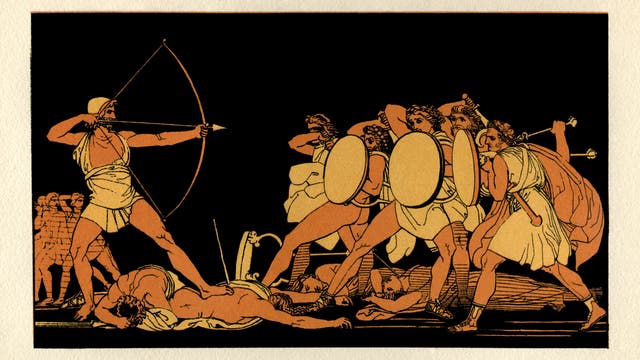




Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.