Gravitationswellen: Das andere kosmische Hintergrundrauschen
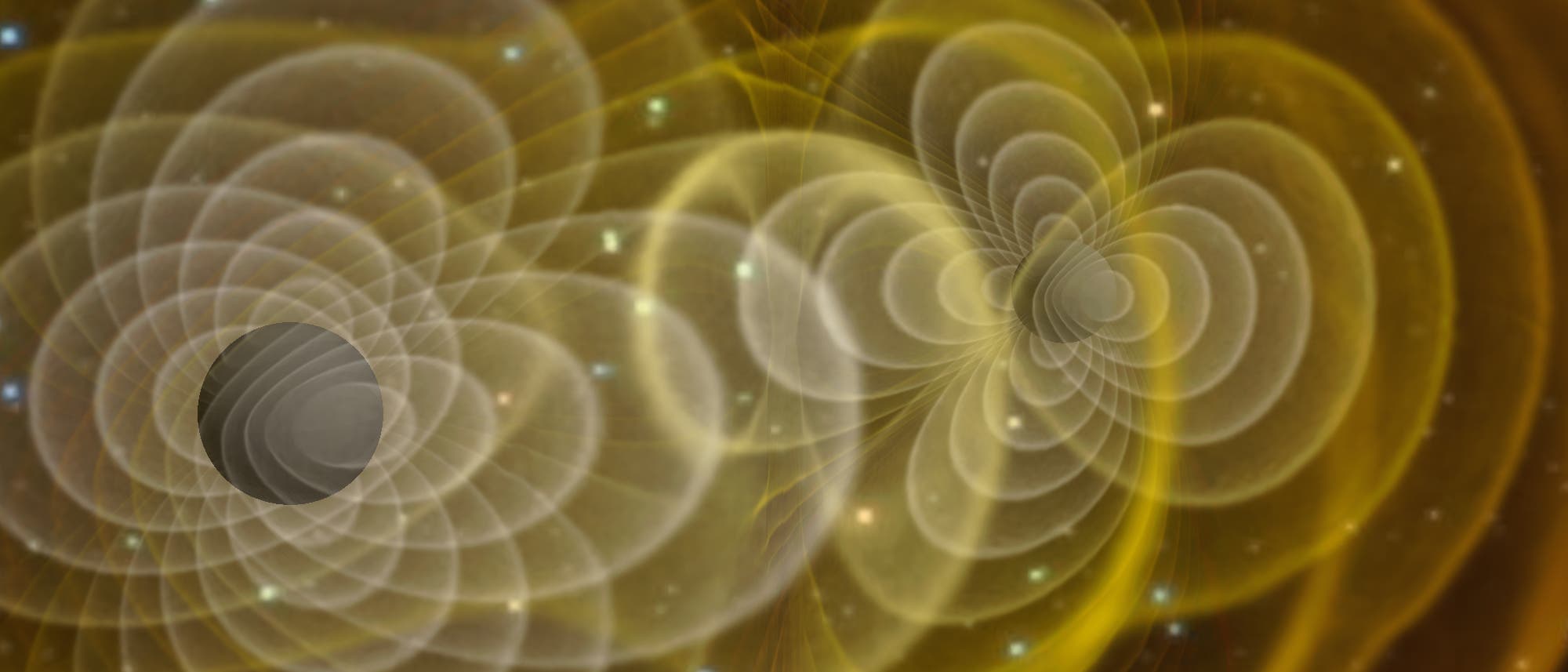
Wenn Schwarze Löcher verschmelzen, lässt ihre gewaltige Energie die Raumzeit selbst schwingen. Detektoren wie LIGO messen diese Gravitationswellen und haben so ein neues Beobachtungsfenster in den Kosmos geöffnet. Doch die meiste Zeit nämlich kollidieren Schwarze Löcher nicht, sondern umkreisen sich nur gegenseitig. Die dabei erzeugten Gravitationswellen erfüllen den Kosmos mit einem extrem tiefen Brummen: dem Gravitationswellenhintergrund.
Fachleute sind sich sicher, dass es dieses Hintergrundsignal niederfrequenter Gravitationswellen im Kosmos gibt. Doch die Jagd danach ist eine Art Geduldsspiel. Man weiß, dass es diese Gravitationswellen höchstwahrscheinlich gibt. Man weiß, wie man sie nachweisen kann. Und dann fängt man mit den Beobachtungen an und weiß, dass man Jahre und Jahrzehnte warten muss, bis man die Daten zusammen hat, mit denen man sie nachweisen kann.
Geduldsspiel mit Pulsaren
Als LIGO 2016 nachwies, dass es Gravitationswellen wirklich gibt, lief das Geduldsspiel von Michael Kramer vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn schon eine ganze Weile. »Unsere Datensätze fangen Mitte der 1990er Jahre an«, sagt er. So lange hält er selbst schon nach niederfrequenten Gravitationswellen Ausschau - allerdings nicht mit einem hochpräzisen Lineal wie dem des LIGO-Observatoriums auf der Erde, sondern mit Hilfe der extrem regelmäßigen Strahlungspulse weit entfernter Pulsare.
Gravitationswellen ploppten quasi als unerwarteter Nebeneffekt aus Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie heraus. Beschleunigte Massen erzeugen Wellen in der Raumzeit. Einstein selbst glaubte nicht daran, dass es jemals gelingen würde, den kuriosen Effekt nachzuweisen. Es sollte rund ein Jahrhundert dauern, bis die Menschheit ein Experiment erschaffen hatte, das genau dazu in der Lage ist: Das LIGO-Observatorium registriert, wenn eine Gravitationswelle die vier Kilometer langen Tunnel seiner beiden Anlagen kurzzeitig um einen knappen Atomkerndurchmesser staucht oder dehnt.
Doch so eindrucksvoll das ist - das damit geöffnete Beobachtungsfenster ist winzig. Der größte Teil der Gravitationswellen ist für LIGO nicht sichtbar. Genau wie bei elektromagnetischer Strahlung gibt es auch bei Gravitationswellen ein Spektrum verschiedener Wellenlängen und Frequenzen. Eine Gravitationswelle ist um so niederfrequenter und langwelliger, je größer die Massen sind, die sie erzeugen.
Das LIGO-Observatorium und andere Gravitationswellendetektoren können Gravitationswellen messen, deren Frequenz in Schallwellen umgerechnet im hörbaren Bereich liegen würden. Solche Wellen entstehen in engen Doppelsystemen aus Schwarzen Löchern und Neutronensternen, die einander umkreisen und schließlich miteinander verschmelzen.
Im Universum gibt es aber noch viel massereichere Objekte als derartige Stern-Überreste. Damit ist im Gravitationswellenspektrum bei den Frequenzen noch viel Platz nach unten. Zum Beispiel kollidieren nicht nur normale Schwarze Löcher, sondern auch die extrem massereichen Schwarze Löcher im Zentrum von Galaxien, die Millionen oder Milliarden Sonnenmassen in sich vereinen.
Um deren galaktische Zusammenstöße zu messen, würde die europäische Weltraumagentur ESA gerne einen mehrere Millionen Kilometer langen Gravitationswellendetektor im All platzieren: Das Laser Interferometer Space Antenna (LISA) könnte dort Gravitationswellen nachweisen, die entstehen, wenn diese kosmischen Giganten miteinander verschmelzen.
Wellen, die Lichtjahre lang sind
Aber auch das deckt nur einen Bruchteil des Gravitationswellenspektrums ab. Denn solche Kollisionen sind extrem rar - die meisten Gravitationswellen des Hintergrundrauschens entstehen in den Millionen und Milliarden Jahren vor dem Zusammenstoß, wenn die extrem massereichen Schwarzen Löcher einander umkreisen. Der Frequenzbereich ihrer abgestrahlten Gravitationswellen liegt bei einigen Nanohertz. »Diese Schwarzen Löcher brauchen für einen Umlauf umeinander mehrere Jahre», sagt Michael Kramer.
Zwischen zwei Wellenkämmen einer solchen Gravitationswelle können so schon einmal ein paar Jahre vergehen. Der Gravitationswellenhintergrund besteht nach Ansicht von Fachleuten aus solchen Quellen – man kann ihn sich als tiefes Brummen vorstellen - während die von LIGO gemessenen Gravitationswellen gelegentlich als kosmisches Tschirpen bezeichnet werden. Dieses Brummen erfordert Detektoren, die mehrere Lichtjahre lang sind. Sie selbst zu bauen, kann man somit schlichtweg vergessen.
»Gravitationswellendetektoren für langwellige Gravitationswellen zu bauen, ist natürlich nicht wirklich realistisch«, sagt Michael Kramer. Immerhin lieferte das Universum eine Lösung für das von ihm gestellte Problem, sozusagen die Hauptzutat des Geduldsspiels: Pulsare. Millisekunden-Pulsare, um genau zu sein.
Pulsar-Timing-Arrays: Millisekunden-Pulsare als Gravitationswellendetektoren
Millisekunden-Pulsare sind ehemalige massereiche Sterne, die ihr Dasein nach den spannenden Zeiten der Kernfusion und des Scheinens nun damit verbringen, sich als Neutronensterne um ihre eigene Achse zu drehen - und zwar mehrere hundertmal pro Sekunde. Derartige Neutronensterne sind oft mit einem sehr starken Magnetfeld ausgestattet, mit dem sie Teilchen auf extreme Energien beschleunigen, so dass sie elektromagnetische Strahlung aussenden, Radiowellen zum Beispiel. Stimmen der magnetische Pol und die Rotationsachse nicht perfekt miteinander überein - so wie es auch bei der Erde der Fall ist - überstreicht diese Strahlung die Erde in regelmäßigen Abständen. Aus unserer irdischen Perspektive blitzt der Pulsar im Takt seiner extrem schnellen Rotation.
Tatsächlich funktioniert das so regelmäßig, dass Astronominnen und Astronomen die Ankunftszeit des nächsten Pulses eines Pulsars auf eine milliardstel Sekunde vorhersagen können. Pulsare können manchen Atomuhren auf der Erde Konkurrenz machen. Und deshalb brauchen Gravitationswellenjäger wie Michael Kramer für ihr Geduldsspiel kein lichtjahrelanges Lineal, sondern Millisekunden-Pulsare und ein Radioteleskop.
Er nutzt eine Versuchsanordnung, die man »Pulsar-Timing-Arrays« (PTAs) nennt. Sie basieren auf dem Gedanken, dass ein Pulsar sich von nichts aus der Ruhe bringen lässt – außer von einer zufällig vorbeikommenden Gravitationswelle. Sie staucht und dehnt die Raumzeit selbst. Wir auf der Erde merken das, weil sich die Ankunftszeiten der Pulsar-Signale verräterisch verschieben.
Das ist keineswegs so simpel, wie es erst klingen mag. Zuerst einmal reicht ein einzelner Pulsar dafür nicht aus. Deswegen braucht man das PTA aus vielen solcher Quellen. In diesem wollen die Forscher Muster finden, wie die Veränderungen unterschiedlicher Pulsare am Himmel miteinander zusammenhängen.
»Man schaut sich nicht nur einen Pulsar in einer Richtung am Himmel und einen Pulsar in einer anderen Richtung am Himmel an, sondern man muss sie miteinander vergleichen«, sagt Kai Schmitz, theoretischer Physiker am CERN. »Das tut man für möglichst viele Paare von Pulsaren. Und wenn dann die Daten all dieser Paare in einem bestimmten Muster zueinanderstehen, das über den ganzen Himmel hinweg verteilt ist, kann man sagen, ob es Gravitationswellen sind oder nicht.«
Auf der Suche nach der Hellings-Downs-Kurve
Forschende nennen dieses Muster die Hellings-Downs-Kurve. Sie beschreibt, vereinfacht gesagt, dass die Signale von Pulsaren, die nahe beieinander oder genau gegenüber am Himmel stehen, von Gravitationswellen auf ähnliche Art und Weise beeinflusst werden sollten. Die minimalen Veränderungen in den Ankunftszeiten ihrer Signale sollten deshalb miteinander korreliert sein. Pulsare, die eher im rechten Winkel zueinander stehen, sollten hingegen eine negative Korrelation aufweisen.
Angesichts der Tatsache, dass sich die gesuchten Gravitationswellen nur alle paar Jahre zum Schwingen bequemen, war schon zu Beginn der Suche klar, dass sie Jahre dauern würde. Auf der Erde gibt es derzeit mehrere Pulsar-Timing-Arrays, die nach den Korrelationen suchen. Michael Kramer ist am European-Pulsar-Timing-Array EPTA beteiligt, einem Zusammenschluss aus inzwischen fünf Teleskopen, zu denen auch das 100-Meter-Radioteleskop in Effelsberg gehört. Daneben gibt es in den USA noch NANOGrav, ein im Jahr 2007 gegründetes Konsortium, sowie das Parkes Pulsar-Timing-Array in Australien.
Die beteiligten Forscherinnen und Forscher warten darauf, dass ihre Zeitreihen endlich lang genug sein mögen, dass sich das Signal herauskristallisiert. Dabei reicht es nicht nur, geduldig abzuwarten.
Während der Messkampagne reduzieren sie jegliche Unsicherheit bei den hochpräzisen Messungen so weit wie möglich. So zum Beispiel die, die entsteht, weil man den Massenschwerpunkt des Sonnensystems nicht ganz genau kennt. Da etwa die Position von Jupiter im Sonnensystem nicht hinreichend präzise bestimmt ist, entsteht dadurch eine verbleibende Unsicherheit bei den Pulsar-Messungen.
Außerdem beeinflusst das interstellare Medium die Radiowellen. Interstellare Wolken aus ionisiertem Gas streuen die von den Pulsaren kommenden Signale. In all diesem allgemeinen Rauschen suchen Forscherinnen und Forscher nach einem ganz bestimmten Rauschen. Keinem weißen Rauschen, bei dem alle Frequenzen gleich verteilt sind, sondern einem »roten Rauschen« mit etwas mehr tiefen Frequenzen, das darauf hindeuten würde, dass Gravitationswellen die Ankunftszeiten von Pulsaren verändert haben.
Verstecken sich Gravitationswellen im roten Rauschen?
2021 gab das nordamerikanische NANOGrav-Konsortium bekannt, dass man aus den Daten von 12,5 Jahren erste Hinweise auf genau jene niederfrequenten Gravitationswellen aufgespürt habe. Wohlgemerkt: Von einer Entdeckung sprach niemand – denn noch sind die Fehlerbalken viel zu groß. Eine Hellings-Downs-Kurve erkennt man in den Daten nur mit viel gutem Willen. Andere Forschungsgruppen sind deswegen vorsichtiger. »Wir sehen diese Hinweise seit 2015«, sagt Michael Kramer. Aber veröffentlicht, wie das NANOGrav-Konsortium, hatte die Gruppe diese Ergebnisse vorerst nicht, obwohl sie das inzwischen nachgeholt hat. Schließlich besteht immer noch die Gefahr, dass sich das Signal mit noch mehr Daten von einem roten Rauschen zu einem weißen Rauschen wandelt.
Bislang scheint es zumindest nicht so, als ob das Signal verschwinden würde. Im Januar 2022 veröffentlichte ein Zusammenschluss aller PTAs, das International Pulsar Timing Array IPTA, einen Fachartikel, in dem es zwar immer noch keine Entdeckung verkünden konnte - aber noch mehr Hinweise auf das erhoffte rote Rauschen. »Es spricht nichts dagegen, dass das tatsächlich Gravitationswellen sind«, sagt Kai Schmitz. »Aber wir können es noch nicht dingfest machen, weil die Fehlerbalken und die Unsicherheiten noch so groß sind.«
Und manchmal gibt es auch bei diesem jahrzehntelangen Geduldsspiel noch unerwartete Entwicklungen. Zum Beispiel jene gute Idee, die Aditya Parthasarathy vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn und sein Kollege Matthew Kerr vom U.S. Naval Research Laboratory hatten: »Wir haben uns gefragt, ob man die Pulse der Millisekunden-Pulsare auch im Gammastrahlenbereich nachweisen könnte«, sagt er.
Prinzipiell senden derartige Pulsare nicht nur Radiostrahlung ins All, sondern sie decken das ganze elektromagnetische Spektrum ab.
Gravitationswellen-Jagd nun auch mit Gammastrahlen
Hochenergetische Gammastrahlung hat gegenüber den Radiowellen einen unschlagbaren Vorteil: Sie lässt sich nicht vom interstellaren Medium beeindrucken. In dieser Hinsicht bietet Gammastrahlung sogar einen Vorteil gegenüber den hochpräzisen Messungen im Radiobereich, da es diese Fehlerquelle dort nicht gibt. Andererseits lassen sich Gammastrahlen auf der Erde nicht direkt beobachten, da sie von der Erdatmosphäre - man muss sagen: zum Glück für uns - absorbiert werden.
In der Erdumlaufbahn, wo diese Strahlung problemlos empfangen werden kann, gibt es glücklicherweise ein Gammastrahlenteleskop: Das Weltraumteleskop Fermi beobachtet seit 2008 den hochenergetischen Himmel. Aditya Parthasarathy und Matthew Kerr fragten sich, ob man das Gravitationswellensignal der Millisekunden-Pulsare prinzipiell auch im Gammastrahlenbereich nachweisen könnte. Die Antwort: Ja, man kann. Dadurch standen den Fachleuten mit einem Schlag Daten aus zwölf Jahren zur Verfügung. Die Ergebnisse veröffentlichte die Fermi-LAT-Kollaboration vor Kurzem im Fachmagazin »Science«.
»Und das Gute daran ist, dass wir noch nicht einmal so viel machen müssen, weil Fermi in der Erdumlaufbahn ist und von dort den ganzen Himmel durchmustert«, sagt Aditya Parthasarathy. »Das funktioniert so gut, dass wir die niederfrequenten Gravitationswellen sogar ganz allein entdecken könnten, ohne die PTAs im Radiowellenbereich. Es ist eine völlig unabhängige Methode.«
Allerdings muss sich Aditya Parthasarathy noch gedulden. Denn sein Team und er konnten zwar zeigen, dass die Methode prinzipiell funktioniert, aber hier hat man einfach noch nicht genug Daten gesammelt. Und so heißt es auch für die Gravitationswellenjäger im Gammastrahlenbereich: Willkommen beim Warten.
Während Forscherinnen und Forscher auf die ersten Daten des Gravitationswellenhintergrunds warten, stellen sie sich die Frage, was sie da überhaupt beobachten könnten. Was erzeugt das Gravitationswellensignal? Denn es ist nicht das Brummen eines einzelnen Paares verschmelzender Schwarzer Löcher, das die Hellings-Downs-Kurve beschreibt. Stattdessen ist es ein sich überlagerndes Signal aus vielen extrem massereichen Schwarzen Löchern, die bei einer Kollision zweier Galaxien ins neue gemeinsame Zentrum wandern und dort einander umkreisen. Deshalb sprechen Forschende auch vom stochastischen Gravitationswellenhintergrund.
Wem Schwarze Löcher zu langweilig sind: Wie wäre es mit kosmischen Strings?
Allerdings könnten auch andere Prozesse im All derartige niederfrequente Gravitationswellen erzeugen. Mit ihnen beschäftigt sich der theoretische Physiker Kai Schmitz. Er würde gern nach Anzeichen von kosmischen Strings Ausschau halten, nach Überbleibseln aus der Zeit des Universums von kurz nach dem Urknall. Derartige kosmische Strings könnten Anzeichen für Phasenübergänge sein, die unser Kosmos zu jener Zeit durchlaufen hat - und sie wären ein direkter Hinweis auf Physik jenseits des Standardmodells. Oder vielleicht versteckt sich in der Hellings-Downs-Kurve gar ein Hinweis auf die kosmische Inflation kurz nach dem Urknall, die die Raumzeit selbst zum Schwingen gebracht hat?
Das alles klingt komplizierter, als es ist. Letztendlich geht bei den Pulsar-Timing-Arrays darum, überhaupt Gravitationswellen nachweisen zu können. Was man dann da genau nachgewiesen hat, darüber kann man sich später unterhalten. »Erst mal muss man einen Haken hinter die Hellings-Downs-Kurve setzen«, sagt Kai Schmitz.
Denn erst wenn sich in den Daten der kommenden Jahre die Kurve abzeichnet, eröffnen sich weitere Fragestellungen. Man könnte dann zum Beispiel die Spektralverteilung analysieren, also welche Frequenzen wie stark beteiligt sind. Diese könnte verraten, ob die Gravitationswellen ein kosmologisches Geheimnis vom Anfang des Universums bergen - oder ob sie astrophysikalischen Ursprungs sind. In letzterem Fall würde das Hintergrundrauschen auf einen Prozess hindeuten, von dem Forscherinnen und Forscher sich fast sicher sind, dass es ihn gibt: die Verschmelzung supermassereicher Schwarzer Löcher beim Verschmelzen von Galaxien.
»In den nächsten Jahren werden mit mehr Daten die Fehlerbalken schrumpfen. Und wenn sich die Fehlerbalken dann in die Richtung verkleinern, wo man sie gerne haben möchte, ist die Hoffnung groß, dass sich das Signal für die Gravitationswellen abzeichnen wird«, sagt Kai Schmitz. Er hofft sogar, dass sich das Signal sogar jetzt schon in den paar Jahren an Daten versteckt, die bereits gesammelt, aber noch nicht ausgewertet wurden. Dann würde es nicht mehr lange dauern, bis die Gravitationswellenjägerinnen und -jäger eine Entdeckung verkünden könnten.
Andere Forscher wie Aditya Parthasarathy sind nicht so optimistisch: »Ich denke, zum jetzigen Zeitpunkt sollten wir noch vorsichtig sein«, sagt er. »Das sind extrem schwache Signale. Ich glaube, es wird noch ein paar Jahre dauern, bis wir tatsächlich ein Ergebnis haben werden.« Immerhin, auch Parthasarathy spricht von Jahren, nicht von Jahrzehnten. Somit geht das Geduldspiel bei der Jagd nach den Gravitationswellen vorerst weiter - aber vielleicht nicht mehr lange.
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.