Krebsmedizin: Selbsthilfe aus dem Schädelknochen
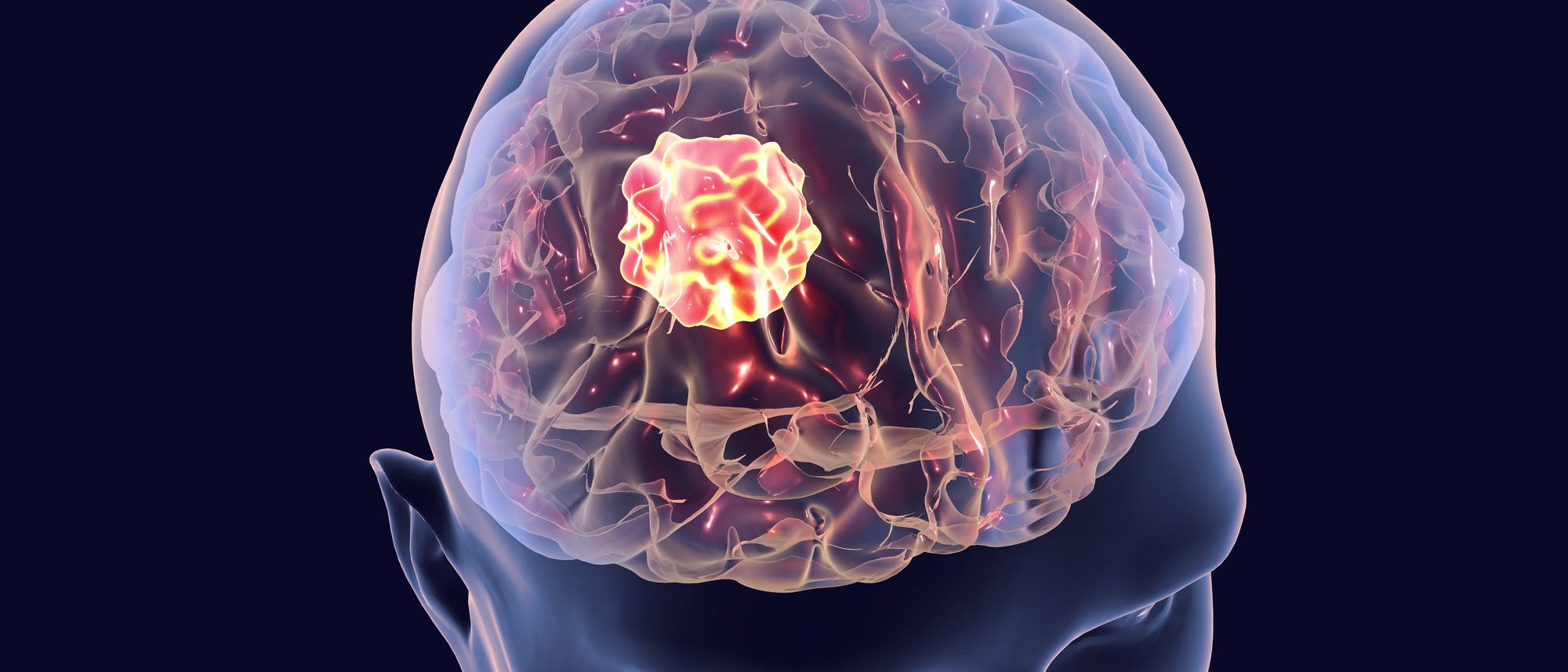
Immuntherapien haben die Behandlung einiger Tumorarten in den zurückliegenden Jahren deutlich verbessert. Hirntumoren allerdings erweisen sich bisher als weitgehend therapieresistent. Die Gründe dafür sind noch nicht klar. Man vermutet, dass sie zu wenig Tumorantigene besitzen: jene molekularen Strukturen, die das Immunsystem als körperfremd erkennen und attackieren kann. Darüber hinaus schaffen Hirntumoren eine Umgebung um sich herum, die Immunreaktionen unterdrückt, indem sie beispielsweise immundämpfende Moleküle freisetzen. Hinzu kommt: Die Blut-Hirn-Schranke, die unser Denkorgan einkapselt, erschwert es unseren Abwehrzellen, ins Hirngewebe einzuwandern. Neue Studien zeigen allerdings, dass Hirntumoren keineswegs »immunkalt« sind, wie Fachleute lange angenommen haben – das heißt, sie sind nicht komplett frei von Immunaktivität. Die Körperabwehr ist in ihnen durchaus aktiv, und wie die Daten zeigen, scheint unser Gehirn über spezielle Immunzellpopulationen zu verfügen, die wuchernde Tumoren erkennen und sich für den Kampf gegen den Krebs gezielt mobilisieren lassen.
Immunaktivitäten in Hirntumoren zu analysieren, stellt Fachleute vor große Herausforderungen. Erstens sitzen die Wucherungen nicht immer an operativ zugänglichen Stellen, zweitens enthalten sie oft nur sehr wenige Immunzellen. Somit galt ihre detaillierte Untersuchung bis vor Kurzem als schwer durchführbar. Die RNA-Sequenzierung einzelner Zellen, die so genannte scRNA-Seq (von englisch: single cell RNA sequencing), erlaubt es inzwischen aber, das genaue Profil der Genaktivität für eine beliebige Zelle zu ermitteln. Damit lassen sich wertvolle Informationen über individuelle Immunzellen gewinnen, was ganz neue methodische Möglichkeiten eröffnet.
Eine Forschungsgruppe um Aditi Upadhye vom kalifornischen La Jolla Institute for Immunology hat mit Hilfe von scRNA-Seq-Verfahren etwa 40 000 T-Lymphozyten (eine wichtige Untergruppe der Immunzellen) untersucht, die aus den Hirntumoren von 38 Kindern stammten. Die Fachleute verfolgten anhand der Zellrezeptoren zurück, welche Lymphozyten sich in dem Tumor vermehrt hatten. Es stellte sich heraus, dass in den meisten Krebsherden – sogar in denen, die am aggressivsten wucherten – große Mengen von Immunzellen vorhanden waren. Dabei handelte es sich vor allem um Helfer-CD4- sowie zytotoxische CD8-T-Zellen, die beide zu den T-Lymphozyten zählen. Anscheinend hatten diese Immunzellen sich nicht nur im Tumorgewebe stark vermehrt, sondern zudem Gene hochreguliert, die bekanntermaßen in ausgesprochen angriffslustigen Lymphozyten aktiv sind. Außerdem hatten sich einige von ihnen in »tissue-resident memory T cells« genannte Gedächtniszellen umgewandelt, die an Orten besonders aktiver Immunreaktionen entstehen und dort für längere Zeit Krankheitserreger aufspüren und attackieren können.
Abwehrbereite Immunzellen
Wie Einzelzellanalysen dieser Immunzellen zeigten, waren deren Genaktivitäten typisch für T-Lymphozyten, die Tumorantigene erkennen und attackieren. Die Zellen ähneln darin T-Lymphozyten, die Lungentumoren bekämpfen. Wucherungen in der Lunge sprechen manchmal ausgesprochen gut auf Immuncheckpoint-Inhibitoren an – das sind Substanzen, die verhindern, dass der Tumor die Immunreaktion lokal unterdrückt. Die Untersuchungen der kindlichen Hirntumoren deuten also auf eine dort sehr aktive Untergruppe von Abwehrzellen hin, die zudem in ihrer Wirkung von Immuntherapien (wie der Gabe von Checkpoint-Inhibitoren) unterstützt werden könnte.
Die Daten von Upadhye und seinem Team belegen aber auch, dass nicht alle Krebspatienten solche potenten Immunzellen besitzen. Bei ungefähr jedem dritten erkrankten Kind war keine nennenswerte Vermehrung der Abwehrtruppen und somit keine Aktivierung von T-Lymphozyten im Tumorgewebe zu erkennen – warum, ist nicht klar.
Gegen Hirntumoren setzen Ärzte oft die Antikörper Nivolumab oder Pembrolizumab ein, die an einen Immuncheckpoint namens PD-1 koppeln und so verhindern sollen, dass der Tumor die Körperabwehr darüber ausbremst. Allerdings ließ sich eine Immununterdrückung mittels PD-1 bei vielen Patienten nicht nachweisen. Stattdessen war bei ihnen oft ein anderer Mechanismus der Immunbremse aktiv, der über den Immuncheckpoint LAG3 läuft. Ist die PD-1-Bremse nicht beteiligt, erscheint eine gezielte Therapie dagegen natürlich wenig sinnvoll.
Nützliche Voruntersuchungen
Es lohne sich demnach, schreiben die Fachleute, in jedem Fall die Vermehrung der T-Lymphozyten im Tumorgewebe als auch die relevanten Immuncheckpoints zu prüfen, bevor man eine Entscheidung über die richtige Therapie treffe. Die spezifischen T-Lymphozyten müssen ins Tumorgewebe eindringen, damit Immuntherapien überhaupt wirken können – und über welchen Immuncheckpoint die Krebszellen das Immunsystem lahmlegen, bestimmt darüber, welcher Checkpoint-Inhibitor gegen sie funktionieren kann. Bei vielen früheren klinischen Studien sind diese Punkte nicht geprüft worden, weshalb in ihnen wahrscheinlich nicht richtig zu erkennen war, welche klinische Wirkung mit entsprechenden Therapien möglich ist.
Während zahlreiche Wucherungen von erkrankten Kindern offenbar aktive Immunzellen enthalten, scheint das bei Tumoren von Erwachsenen anders zu sein. Eine Arbeitsgruppe um den Onkologen Björn Scheffler vom Deutschen Konsortium für Translationale Krebsforschung (DKTK) hat bei erwachsenen Hirntumorpatienten zwar ebenfalls viele aktive Immunzellen gefunden, jedoch nicht im Tumor selbst, sondern im Knochenmark der benachbarten Schädeldecke. Die untersuchten Personen waren am hochaggressiven Glioblastom erkrankt, einer bis heute ausnahmslos tödlich verlaufenden Krebserkrankung.
Scheffler und sein Team hatten zunächst entdeckt: Bei manchen Patienten, die ihren Tumor mit einem bildgebenden Verfahren namens PET-Scan-Analyse untersuchen ließen (siehe Glossar), leuchtete auf den Scan-Bildern nicht nur der Krebsherd selbst auf, sondern in geringerem Ausmaß auch jene Bereiche des Schädelknochens, die der Wucherung am nächsten lagen. Der Grund dafür lautet, dass das Markierungsmittel, das für das Leuchten sorgt, etwas weniger stark ebenso an Immunzellen koppelt. Auf den Schnittbildern erschienen kleine Strukturen im Knochengewebe, die mit dem Tumorherd häufig wie durch einen dünnen Faden verbunden schienen. Das war ein sehr ungewöhnlicher Befund, den die Diagnostiker zunächst für einen methodisch bedingten Fehler hielten.
Chirurgische OP liefert Gewebeproben
Die Fachleute um Scheffler untersuchten Stücke von Schädelknochen, die auf den Scan-Bildern durch entsprechendes Leuchten aufgefallen waren. Diese Stücke waren zwecks chirurgischer Entfernung der Hirntumoren ohnehin aus dem Schädel der Patienten herausgesägt worden und standen somit für Analysen zur Verfügung. Beim Untersuchen der Knochenstruktur und der darin befindlichen Zellen per scRNA-Seq kam heraus: Vor allem T-Lymphozyten hatten sich im Knochenmark der Schädeldecke nahe dem Tumor angesammelt und waren dort von dem Markierungsmittel gekennzeichnet worden, und sie schienen – wie in der Studie von Upadhye und seinem Team – besonders aktiv zu sein.
Genexpressionsanalysen verrieten, dass die T-Zellen dieser Population viele verschiedene Reifungsstadien repräsentierten, von neu gebildet und naiv (also immunologisch unerfahren) bis hin zu hoch spezialisierten T-Killer-Lymphozyten sowie unterschiedlichen Arten von Gedächtniszellen. Eine solch diverse und gegen den Krebsherd gerichtete Zellpopulation war weder an anderen Körperstellen des Knochenmarks noch im Tumor selbst zu finden. »Es sieht so aus«, sagt Scheffler, »als würden dort T-Lymphozyten mit Antitumorwirkung den ersten Kontakt mit ihrem Zielantigen erfahren.«
Ein Vergleich der Rezeptoren der verschiedenen T-Lymphozyten brachte weiterhin ans Licht, dass viele dieser Rezeptoren ebenso im Tumor zu finden waren – vermutlich deshalb, weil T-Zellen aus dem Knochenmark in den Tumorherd gewandert waren. Dort angekommen, zeigten die meisten von ihnen jedoch Merkmale einer zellulären Erschöpfung, eines »exhausted phenotype«, und waren dann nicht mehr in der Lage, die Tumorzellen effektiv anzugreifen. Tatsächlich können T-Lymphozyten nach wiederholtem Antigenkontakt in einen solchen Erschöpfungszustand geraten. In immunologischen Tests zeigten T-Zellen aus dem Tumorherd eine deutlich reduzierte Aktivität, wohingegen jene, die direkt aus dem Schädelknochen gewonnen worden waren, die Tumorzellen noch immer effizient angriffen.
Bessere Prognose dank Immunzellen in der Schädeldecke?
Schon 2021 wurde bei Mäusen die Schädeldecke als Quelle aktiver Immunzellen identifiziert. Dass sich dort auch beim Menschen tumorspezifische T-Zellen ansammeln und gegen einen Hirntumor aktivieren lassen, ist allerdings neu. »Es scheint in der frühen Phase eines Glioblastoms eine spontane Immunantwort in der Schädeldecke zu geben, die gegen den Tumor angeht und sein Wachstum bremst«, erläutert Scheffler. Dies könnte die Beobachtung erklären, dass sich bei manchen Patienten die Hirngewebswucherung zwischen der ersten radiologischen Bilddiagnostik und der nachfolgenden chirurgischen Operation teilweise zurückbildet. In der Tat ließ sich ein Zusammenhang mit dem Fortschreiten der Krebserkrankung nachweisen: War bei diagnostischen PET-Scan-Untersuchungen eine Anhäufung von Immunzellen in der Schädeldecke erkennbar, blieben die Patienten nach der Operation länger tumorfrei. Ob sie dadurch insgesamt länger überleben, lässt sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand aber nicht beantworten.
Diese Erkenntnisse könnten Auswirkungen auf die Therapiepraxis haben. Lässt sich ein Gehirntumor operativ entfernen, öffnen die behandelnden Mediziner die Schädeldecke und nehmen ein Knochenstück heraus, um sich Zugang zur Wucherung zu verschaffen. Um die Wege kurz zu halten, tun sie das möglichst nah am Tumor – und erwischen dadurch genau jenes Knochenstück, in dem sich möglicherweise T-Lymphozyten mit Antitumorwirkung angesiedelt haben. Das Fragment wird zwar steril aufbewahrt, damit die Mediziner es nach der OP wieder einsetzen können, allerdings drohen während dieser Zeit die meisten darin befindlichen Immunzellen zu Grunde zu gehen. Manchmal kann das Stück auch nicht sofort wieder eingepflanzt werden, weil das Gehirn infolge des Eingriffs anschwillt und ein Verschluss der Schädeldecke nicht sinnvoll ist. In solchen Fällen wird das Fragment eingefroren, bis sich die Kalotte wieder verschließen lässt, was viele potenziell nützliche Immunzellen ebenfalls nicht überleben. Der operative Eingriff, so wie er bisher erfolgt, beeinträchtigt deshalb mit hoher Wahrscheinlichkeit eine eventuell bestehende Immunreaktion gegen den Tumor.
»Bis jetzt hat so gut wie niemand daran gedacht, dass es in der Schädelkalotte eine Immunantwort gegen den Tumor geben könne«, sagt Karsten Geletneky, Neurochirurg am Klinikum Darmstadt. Das ist doppelt fatal, denn die herkömmliche chirurgische Entnahme eines Hirntumors beschädigt nicht nur das nahe gelegene Knochenmark, sondern auch die darunter liegenden Hirnhäute, über die die Immunzellen zum Tumor hinwandern. Strahlen- und Chemotherapie, die üblicherweise auf den chirurgischen Eingriff folgen, ziehen das lokale Immunsystem ebenfalls in Mitleidenschaft. Wolle man das ganze Potenzial einer lokalen Immunreaktion gegen Hirntumoren ausschöpfen, betont Geletneky, dann müsse man wahrscheinlich schon vor all den anderen Behandlungen darauf hinwirken, diese Reaktion zu verstärken. Frühere Studien haben wirklich Belege dafür geliefert, dass Patientinnen und Patienten, die bereits vor einem operativen Eingriff mit Immuncheckpoint-Inhibitoren behandelt wurden, besser darauf ansprachen als Menschen, die eine solche Therapie erst nach der OP erhielten.
Glossar
Helfer-CD4-T-Zellen: T-Lymphozyten, die dabei helfen, eine Immunreaktion anzukurbeln oder aufrechtzuerhalten, indem sie beispielsweise Botenstoffe ausschütten und damit die Funktion von CD8-T-Zellen fördern.
PET-Scan-Analyse: Bildgebungsverfahren, bei dem man radioaktive Substanzen verabreicht, die an Tumorzellen koppeln und es so ermöglichen, Krebsherde im Körper mit Hilfe von tomografischen Aufnahmen abzubilden.
T-Zell-Rezeptoren: Jede T-Zelle besitzt einen einzigartigen Rezeptor, der jeweils eine bestimmte Antigenstruktur erkennt. Sein Bauplan ist in der DNA-Sequenz der Zelle abgelegt, was sich nutzen lässt, um die T-Zelle eindeutig zu identifizieren.
Zytotoxische CD8-T-Zellen: T-Lymphozyten, die infizierte oder entartete Zellen töten.
Andererseits geht aus den Studien hervor, dass Immuntherapien gegen Hirntumoren wohl besser lokal angewendet werden sollten. Derzeit injiziert man Immuncheckpoint-Inhibitoren und Krebsimpfstoffe über die Venen in den Arm oder auch in die Haut beziehungsweise Muskeln. Welcher Anteil des Arzneistoffs ins Gehirn gelangt, ist nicht bekannt. »Bis jetzt gibt es kein medizinisches Gerät, das es routinemäßig ermöglicht, Medikamente in die Schädeldecke zu injizieren«, betont Scheffler. Seine Arbeitsgruppe bekommt jetzt gemeinsam mit anderen Teams Fördermittel vom Bundesforschungsministerium, um Methoden zu entwickeln, die ein Applizieren von Arzneistoffen in die Schädeldecke ermöglichen sollen. Das könnte helfen, die Therapie von Hirntumoren zu verbessern, was angesichts der meist schlechten Prognose solcher Erkrankungen hochwillkommen wäre.
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.