Mikroplastik: Gefahr durch Infusionsbeutel?

Zahllose winzige Kunststoffteilchen überziehen unseren Planeten: Sie finden sich überall, wo auch immer man danach sucht. Seit einigen Jahren ist zudem bekannt, dass Mikroplastik in unseren Körper eindringen kann und sich vermutlich dort anreichert. Über die gesundheitlichen Folgen herrscht allerdings noch weitgehend Unklarheit. Fachleute gehen davon aus, dass dadurch Entzündungsprozesse entstehen können.
Wir nehmen die kleinen Plastikpartikel mit der Atemluft oder über die Nahrung auf. Aber nicht nur das: Laut einer Studie aus Schanghai könnten sie möglicherweise auch direkt in unsere Blutbahn gelangen – über Infusionslösungen. Diese werden in Plastikbeuteln, die meist aus Polypropylen (PP) bestehen, verpackt und gelagert, bis sie Patientinnen und Patienten verabreicht werden.
Zwar filtriert man die Lösungen üblicherweise am Herstellungsort, doch könnte der Kunststoffbeutel nach und nach kleine Plastikteilchen in die Lösung abgeben, so die Annahme des chinesischen Teams. Die Vermutung ist nicht unbegründet, denn von Wasserflaschen aus Plastik weiß man, dass sie winzige Fragmente freisetzen. Fachleute bezeichnen das als sekundäres Mikro- und Nanoplastik. Es entsteht durch Abrieb, wenn Plastik altert oder mechanisch beschädigt wird. Insbesondere Temperatureinflüsse und UV-Licht beschleunigen den Prozess. »Dass auch Infusionsbeutel Mikroplastik enthalten können, ist durchaus schlüssig«, sagt Anja Ramsperger. Sie untersucht im Sonderforschungsbereich Mikroplastik an der Universität Bayreuth die Eigenschaften und Auswirkungen von kleinen Kunststoffpartikeln.
Um ihren Verdacht zu überprüfen, untersuchte die Gruppe um Tingting Huang vom Shanghai Key Laboratory of Atmospheric Particle Pollution and Prevention jeweils zwei Proben von Kochsalzlösungen von zwei verschiedenen Herstellern. Dazu überführten die Fachleute die Infusionsflüssigkeiten in Glasbehälter und filtrierten sie mit einem speziellen Filter für sehr kleine Partikel. Anschließend trockneten sie den Rückstand, nahmen diesen wieder in wenig Wasser auf und analysierten ihn mit Hilfe moderner spektroskopischer Methoden. Zum einen maßen sie, wie viele Partikel aus einer Probe abfiltriert wurden, und berechneten daraus die gesamte Anzahl in einem Liter Infusionslösung. Zum anderen bestimmten sie die Größe der Teilchen und deren Zusammensetzung.
Erste Hinweise in den 1970er Jahren
Bereits in den 1970er Jahren hatte ein amerikanisches Forschungsteam publiziert, kleine Partikel in Infusionslösungen gefunden zu haben. Schon damals wiesen die Forscher darauf hin, dass es sich unter anderem um Plastikteilchen handeln könnte. Die Wissenschaftler hatten zu der Zeit allerdings noch nicht die technischen Möglichkeiten, die winzigen Rückstände so zu untersuchen, wie das chinesische Team es nun tat.
Huang und ihre Gruppe konnten nachweisen, dass es sich bei den Partikeln um kleinste Polypropylenteilchen handelte – dasselbe Material, aus dem auch die Infusionsbeutel bestanden. Nach ihrer Berechnung sollte ein Liter Infusions-Kochsalzlösung 7500 solcher Fragmente enthalten. Diese würden dann direkt ins Blut von Patienten abgegeben werden.
Dass menschliches Blut kleinste Plastikteilchen enthält, zeigte ein niederländisches Team bereits 2022. Es fand darin eine ganze Reihe unterschiedlicher Kunststoffe, die normalerweise nicht in Infusionsbeuteln enthalten sind. Polypropylen war nicht dabei. In der Studie wurde allerdings nicht erwähnt, ob die Probanden jemals Infusionen erhalten hatten. Die Niederländer wiesen darauf hin, dass die Größe der Partikel für die Verbreitung im Körper entscheidend sei. Und diese war in beiden Studien ähnlich.
»Dass auch Infusionsbeutel Mikroplastik enthalten können, ist durchaus schlüssig«Anja Ramsperger, Biologin
Mehr als die Hälfte des von Huang und ihren Kollegen gefundenen Mikroplastiks in den Infusionsbeuteln war kleiner als zehn Mikrometer, und 90 Prozent lagen unter 20 Mikrometern. »Die kleinsten Gefäße im menschlichen Körper, die Kapillaren, haben in der Regel einen Durchmesser von etwa fünf bis zehn Mikrometern. Aus rein theoretischer Sicht wäre eine Verstopfung dieser Gefäße daher nur durch größere Partikel möglich«, sagt Nikolaos Tsilimparis, Leiter der Abteilung Gefäßchirurgie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Es gäbe jedoch keine belastbaren klinischen Daten, wonach Patienten, die häufiger Infusionen erhalten, vermehrt an Gefäßverschlüssen leiden würden.
Laut dem Mediziner gelangen nämlich die meisten Infusionen in das venöse Gefäßsystem – und die Mikropartikel darüber in die Lunge. »Das menschliche respiratorische System verfügt erfreulicherweise über Mechanismen, die in der Lage sind, diese Partikel teilweise aus dem Körper zu entfernen. Ich halte das Risiko deshalb für sehr theoretisch und gering«, erklärt er. Dennoch sei weiterführende Forschung in dem Bereich wichtig.
Zweifel an der Methodik
Ob sogar noch kleineres Nanoplastik enthalten war, lässt sich nicht sagen, denn dieses wäre durch den verwendeten Filter nicht zurückgehalten worden. Auf Grund der geringen Größe könnte es leichter biologische Barrieren überwinden als Mikroplastik. Hier könnte die Studie einen blinden Fleck aufweisen. Zudem fehlt der Beweis, dass die Plastikteilchen wirklich aus den Beuteln stammen. Zwar liegt der Verdacht nahe, da es sich in beiden Fällen um den gleichen Kunststoff handelt, aber andere Studien zeigten, dass auch in Laborchemikalien und Lösungsmitteln Mikroplastik vorkommt. Insbesondere in Natriumchloridlösungen für Infusionen fand man Plastikteilchen im Größenbereich zwischen ein und fünf Mikrometern.
Für Anja Ramsperger besteht zudem Zweifel an der Anzahl der Partikel. »Zum einen geht aus der Studie nicht eindeutig hervor, ob das Wasser, in dem der Filterrückstand aufgenommen wurde, wirklich frei von Mikroplastik war.« Zum anderen sei der Rückstand mit Ultraschall behandelt worden, was die Teilchen weiter zerkleinert und ihre Anzahl somit vermehrt haben könnte. Ob Infusionsbeutel also tatsächlich tausende Mikroplastikpartikel enthalten und ob diese wirklich alle vom Beutel selbst stammen, müssen andere Studien erst bestätigen.
»Ich halte das Risiko für sehr theoretisch und gering«Nikolaos Tsilimparis, Gefäßchirurg
Nichtsdestotrotz gibt es keinen Grund, daran zu zweifeln, dass auch über Infusionen Kunststoffteilchen in den Körper gelangen können. Das Autorenteam der Studie mahnt deshalb, Plastikbeutel und -flaschen nicht unnötig Stressoren wie UV-Licht oder großen Temperaturschwankungen auszusetzen. Dies kann zu vorzeitiger Alterung des Kunststoffs führen und Mikroplastik an die Lösung abgeben. Auf Nachfrage bestätigten mehrere Hersteller von Infusionsbeuteln, dass ihnen die Problematik mit Mikro- und Nanoplastik bekannt sei und sie selbst auch Untersuchungen an ihren eigenen Produkten anstellen würden. Ob sie dabei ähnliche Ergebnisse erhalten wie die chinesische Forschungsgruppe, wollten sie allerdings nicht verraten. Zu den Lagerbedingungen gaben sie jedoch an, dass sie selbst darauf achten würden, die Plastikbeutel unterhalb von 25 Grad Celsius und fern von Sonnenlicht zu lagern.




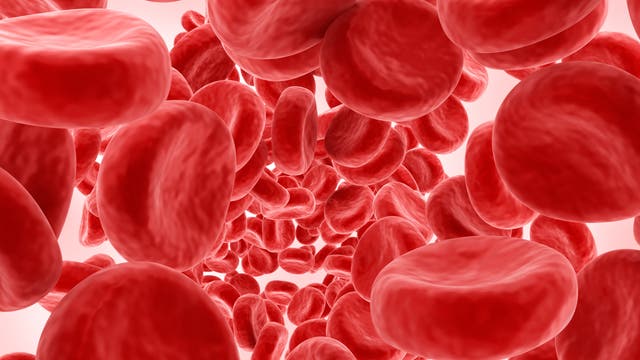

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.