Plazenta: Das unterschätzte Organ
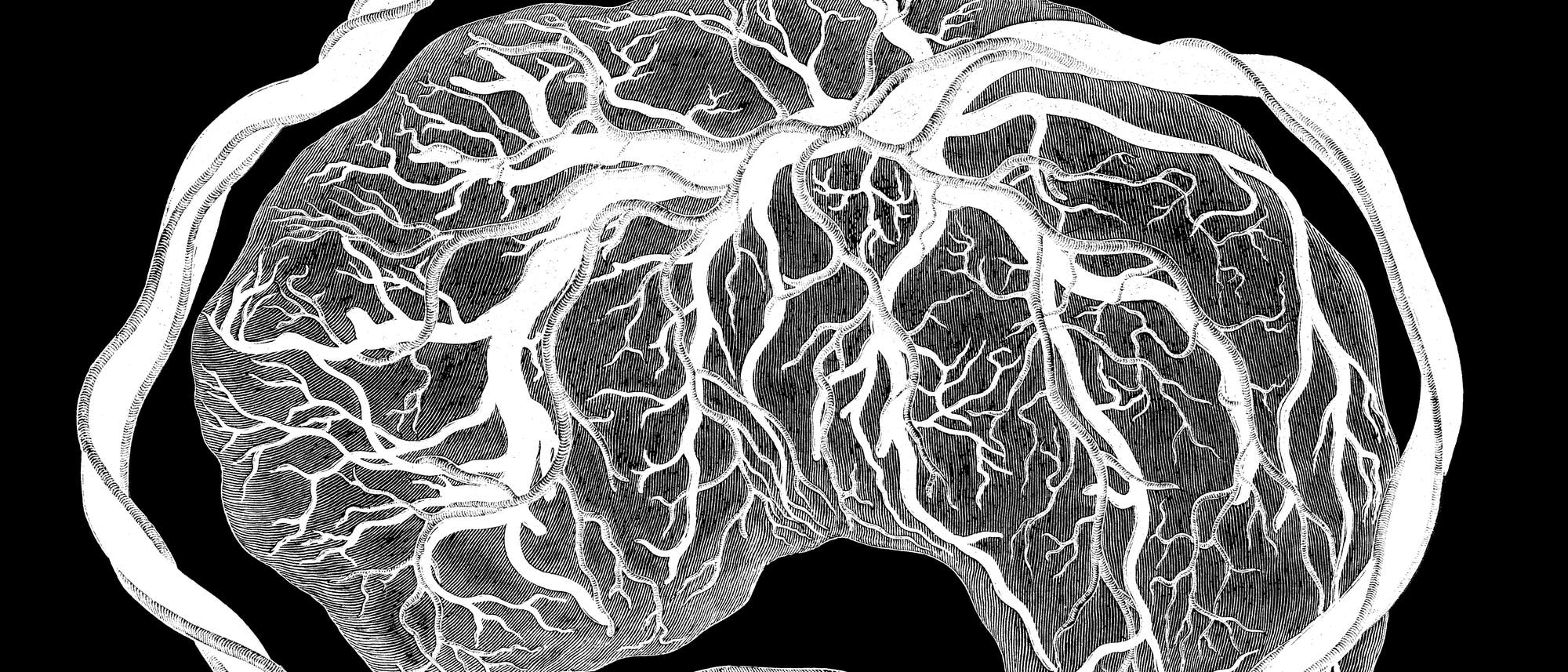
Anders als sein Name vermuten lassen würde, finden wahrscheinlich nur wenige Menschen den Mutterkuchen wirklich schön. Nach der Geburt ist er etwa so schwer wie ein Paket Hackfleisch, ästhetisch ähnlich ansprechend, in der Konsistenz vergleichbar mit einer Leber. Sogar die Neurowissenschaftlerin Anna Penn von der New Yorker Columbia University verzieht beim Gedanken an die Plazenta ihr Gesicht. Dabei hat sie dem Organ ihre Karriere gewidmet. Vor rund zehn Jahren prägte sie den Begriff Neuroplazentologie – das Forschungsfeld war zuvor so unbekannt, dass es keinen Namen hatte. Seitdem findet es immer mehr Zulauf von Hirnforschern.
Warum aber sind Neurowissenschaftler auf einmal so scharf darauf, Plazentapröbchen zu sammeln? Dass das Organ eine Art Schweizer Taschenmesser ist, ist schon lange klar: Eingegraben in die Gebärmutterwand bildet es eine Übergangszone zwischen mütterlichem und kindlichem Gewebe, transportiert Sauerstoff und Nährstoffe von der Mutter zum Fötus, filtert Gifte, reguliert den Austausch von Stresshormonen und Immunbotenstoffen. Dabei arbeitet es im Dienst einer höheren Sache und stirbt bei der Geburt.
Die Plazenta-Hirn-Achse
Inzwischen wird immer klarer, dass die Plazenta auch einen enormen Einfluss auf die Entwicklung des kindlichen Gehirns hat. Das liegt unter anderem an ihrer Schlüsselposition im Körper: Was beim Kind ankommen soll, muss in der Regel diesen Pförtner passieren. Wenn er nicht gut in der Gebärmutter eingenistet ist oder nicht richtig funktioniert, wird das Kind nicht ausreichend mit Sauerstoff oder Nährstoffen versorgt. Darunter leidet dessen Entwicklung, was sich oft schon vor der Geburt erkennen lässt.
Die Plazenta spielt zudem eine Rolle bei Erkrankungen, die sich erst später im Leben manifestieren, etwa bei psychischen Störungen wie Autismus, ADHS, Schizophrenie oder Depression. Zwar weiß man schon länger, dass das Organ an ihrer Entstehung beteiligt sein kann, doch man nahm an, das passiere lediglich, wenn es seiner Aufgabe als Pförtner nicht gerecht wird, es beispielsweise zu wenig Sauerstoff oder Nährstoffe zum Kind durchlässt. Inzwischen mehren sich aber die Hinweise darauf, dass der Mutterkuchen aktiv an der Entwicklung des kindlichen Nervensystems mitwirkt. Wie er das genau tut, wollen Anna Penn und ihr Team herausfinden.
Frühgeburt erhöht Risiko für Autismus
Anna Penn ist nicht nur Neurowissenschaftlerin, sondern auch Neonatologin. Sie kümmert sich unter anderem um Kinder, die das Licht der Welt zu früh erblicken. Häufig haben solche Säuglinge motorische oder kognitive Defizite und benötigen schon kurz nach der Geburt besondere Unterstützung. Frühgeborene Kinder entwickeln im späteren Leben häufiger Autismus-Spektrum-Störungen. Diesen Zusammenhang untermauern viele Untersuchungen, darunter eine Kohortenstudie von 2021, in die Daten von vier Millionen schwedischen Kindern eingeflossen sind. »Was geht Frühgeborenen verloren, das so wichtig für ihre Entwicklung ist?«, fragte sich Penn.
Schnell geriet das Hormon Allopregnanolon, kurz ALLO, in Penns Visier. Es entsteht in der Plazenta, ist ein Zwischenprodukt bei der Bildung von Progesteron und beeinflusst bestimmte Kanäle in der Membran von Nervenzellen. Der Grund, warum gerade Allopregnanolon spannend ist: Seine Konzentration im mütterlichen und kindlichen Blut nimmt im Verlauf einer Schwangerschaft immer weiter zu – zu früh geborene Kinder verpassen also die höchste Dosis am Ende. Dass sein Spiegel nach der Geburt schnell stark abfällt, könnte auch ein Grund für die Wochenbettdepression sein, die rund jede achte Mutter betrifft. Möglicherweise liegt das daran, dass ALLO normalerweise Rezeptoren für den Neurotransmitter GABA reguliert. Fällt diese Steuerung weg, kann das die Stimmung drücken und innerlich unruhig machen. In den USA wurde 2019 ein Medikament für die Behandlung von Wochenbettdepressionen zugelassen, das die Wirkung des Hormons nachahmt.
Die Hormonfabrik ist fehleranfällig
Allopregnanolon ist aber auch an der Entwicklung des kindlichen Gehirns maßgeblich beteiligt – zumindest bei Mäusen, wie Anna Penn 2021 in einer Studie demonstrierte. Dafür modifizierten sie und ihre Kollegen die Tiere derart, dass sie bei ihnen die Produktion von ALLO in der Plazenta selektiv ausschalten konnten. Entsprechend erhielten einige Föten im Mutterleib ausreichende Mengen des Hormons, während andere nur sehr wenig davon bekamen. Nach der Geburt zeigten jene Mäuse, denen weniger ALLO zur Verfügung stand, Verhaltensweisen, die typisch für das Pendant von Autismus-Spektrum-Störungen bei Mäusen sind: reduzierte Ultraschall-Vokalisationen und ein geringeres Interesse an unbekannten Artgenossen. Interessanterweise war das nur bei männlichen Mäusen zu beobachten. Das passt zu der Tatsache, dass Autismus-Störungen häufiger bei Jungen vorkommen.
Die betroffenen männlichen Tiere wiesen außerdem strukturelle Veränderungen im Kleinhirn auf. Diese Hirnregion ist dafür zuständig, Bewegungen zu koordinieren. Bestimmte anatomische Abweichungen dort und eine geringere Zahl der typischen Kleinhirnzellen werden ebenfalls mit Autismus in Verbindung gebracht. Penns Experimente deuten darauf hin, dass sich der plazentare ALLO-Mangel bei männlichen Tieren am stärksten auf die Kleinhirnregion auswirkt. Bei weiblichen Tieren könnten andere Hirnregionen ausschlaggebend für die Ausbildung von Autismus sein. Anna Penn und ihre Kollegen sind derzeit noch damit beschäftigt, die Daten von Kortex und Hippocampus auszuwerten. Sie versuchen außerdem, ihre Untersuchungen auf den Menschen zu übertragen. Dafür schauen sie sich zweijährige Kinder mit autistischen Verhaltensmustern an und untersuchen deren Plazenta, die nach der Geburt zu Forschungszwecken aufgehoben wurde. Insbesondere analysieren sie die Genexpression von Enzymen, die die Produktion von ALLO steuern. Die Ergebnisse sind noch nicht veröffentlicht.
Plazenta-Gene und Schizophrenie
Gene stehen auch im Zentrum von Daniel Weinbergers Forschung. Weinberger ist Professor für Psychiatrie, Neurologie, Neurowissenschaften und genetische Medizin an der Johns Hopkins University und Direktor des Lieber Institute for Brain Development in Baltimore. Sein Steckenpferd: die genetischen Wurzeln von Schizophrenie. Der Schwenk zur Plazenta kam für Weinberger selbst ein bisschen überraschend. Bis vor wenigen Jahren habe er kaum etwas über das Organ gewusst. Nun untersucht er, wie es die Entwicklung von Schizophrenie beeinflussen könnte.
Dafür konzentriert er sich auf das genetische Risikoprofil der Erkrankung. Ein solches, erklärt Weinberger, führe nicht zwangsläufig zu Schizophrenie, so wie erhöhte Cholesterinwerte nicht unweigerlich einen Herzinfarkt auslösen. Es sei vielmehr als Richtungsweiser zu verstehen und zeige an, dass es damit wahrscheinlicher ist, später einmal zu erkranken.
Gemeinsam mit Forscherteams aus Deutschland, Italien und Japan fand Weinberger heraus, dass die Wahrscheinlichkeit, eine Schizophrenie zu entwickeln, stark erhöht ist, wenn das genetische Risikoprofil für die Erkrankung vorliegt und zusätzlich bei der Mutter Schwangerschaftskomplikationen auftraten, zum Beispiel Präeklampsie, Schwangerschaftsdiabetes oder ein verlängerter Geburtsvorgang. »Personen mit einer genetischen Veranlagung für Schizophrenie und Komplikationen während der Zeit im Mutterleib und bei der Geburt hatten ein mehr als fünfmal höheres Risiko, im Lauf ihres Lebens an Schizophrenie zu erkranken, als Personen, bei denen nur eins von beidem zutraf«, erklärt Weinberger.
Daraufhin knöpften die Fachleute sich menschliches Plazentagewebe vor und untersuchten, ob darin die Risikogene für Schizophrenie aktiviert waren. Tatsächlich war das vermehrt in der Plazenta jener Kinder der Fall, bei denen es im Mutterleib oder bei der Geburt zu Komplikationen gekommen war.
Schizophrenie-Gene wirken nicht nur im Gehirn
Drei Jahre später zeigte Weinberger mit seinen Forscherkollegen, dass Kinder, bei denen die Risikogene in der Plazenta angeschaltet waren, schon unmittelbar nach der Geburt tendenziell ein geringeres Hirnvolumen haben und nach einem Jahr kognitiv etwas weniger leistungsfähig sind. »Die genetische Aktivität in der Plazenta kann den Fötus also bereits bei der Geburt beeinträchtigen«, sagt Weinberger. »Wir glauben, dass in den Folgejahren viele andere Faktoren ins Spiel kommen, die das abpuffern. Denn die meisten Kinder mit den Risikofaktoren entwickeln keine Schizophrenie.«
Unklar war jedoch weiterhin, wie die Gene eigentlich genau dazu beitragen, dass ein Kind 20 oder 30 Jahre später Wahnvorstellungen entwickelt. In einer weiteren Studie, die Weinberger und seine Kollegen im Jahr 2023 durchführten, fanden sie heraus: Je öfter die mit Schizophrenie assoziierten Gene in der Plazenta angeschaltet waren, desto schlechter war die Plazenta darin, sich im mütterlichen Uterus zu verankern. Und nicht nur das: Die Zellen, die sich an vorderster Front in den Uterus eingraben, die so genannten Trophoblasten, waren weniger erfolgreich, Sauerstoff und somit mütterliche Blutgefäße aufzuspüren – also die Lebensader des Kindes. An der Ausbildung von Schizophrenie beteiligte Gene wirken demnach nicht nur im Gehirn, wie man bislang angenommen hat.
Auch das Immunsystem spielt eine Rolle
Die Plazenta hat aber nicht nur die Aufgabe, das ungeborene Kind zu versorgen. Sie schirmt es auch vor schädlichen Umwelteinflüssen ab. Das gilt einerseits für Schadstoffe, andererseits für Krankheitserreger. Nur wenige Keime können die Plazenta passieren, darunter das Zika- und das Zytomegalievirus, die schwere neurologische Störungen verursachen können.
Manchmal muss eine Infektion aber gar nicht durch die Plazenta hindurch, um dem kindlichen Nervensystem zu schaden. »Wir wissen, dass Infektionen der Mutter ein Risikofaktor für Erkrankungen wie Schizophrenie, Autismus oder ADHS beim Kind sind«, sagt die Psychologin Claudia Buß von der Berliner Charité. Bei Mäusen wurde gezeigt: Schon eine leichte Aktivierung des mütterlichen Immunsystems in der Mitte der Schwangerschaft kann die Plazenta verändern und das Wachstum neuronaler Vorläuferzellen im fötalen Gehirn hemmen.
Serotonin aus der Plazenta
Möglicherweise wird die Aktivierung des mütterlichen Immunsystems über Entzündungsbotenstoffe wie Zytokine auf das Ungeborene übertragen. So konnte man im Tierexperiment nachweisen, dass die Injektion eines einzigen Zytokins ausreicht, um autismus- und schizophrenieähnliche Verhaltensweisen bei den Nachkommen auszulösen.
Einem anderen Mechanismus geht Alexandre Bonnin von der University of Southern California und dem Children's Hospital Los Angeles nach. Bonnin ist ebenfalls ein Neurowissenschaftler, der die Plazenta erst in einer späteren Phase seiner Karriere als Forschungsobjekt für sich entdeckt hat. Noch vor rund zehn Jahren, sagt er, interessierte er sich nicht sonderlich für sie; da fokussierte er sich vor allem auf das fötale Gehirn. Doch 2011 fand Bonnin heraus, dass die Plazenta in der Lage ist, Serotonin aus der Aminosäure Tryptophan selbst herzustellen. Zuvor hatte man angenommen, das Organ erlaube bloß einen passiven Serotonintransport von der Mutter zum Kind. Mit seiner Entdeckung stellte sich der Einfluss der Plazenta auf die fetale Gehirnentwicklung auf einmal viel aktiver dar.
Wie Alexandre Bonnin 2016 zudem zeigte, wird bei einer schweren Entzündung der Mutter die Serotoninproduktion in der Plazenta hochreguliert. Dementsprechend kommt mehr des Botenstoffs im fötalen Gehirn an. Und das scheint das Wachstum jener Nervenzellen zu hemmen, die dort Serotonin freisetzen. Wie Bonnin außerdem feststellte, stört eine schwere Infektion der Mutter die Ausbildung der kindlichen Blut-Hirn-Schranke. Dieser Schaden bleibt für das ganze Leben bestehen, zumindest bei Mäusen. »Das kann zu einer lebenslangen Entzündung des Gehirns führen, die wiederum nicht selten mit Schizophrenie, Depressionen und vielen anderen neurologischen Störungen einhergeht«, erklärt der Hirnforscher.
Mütterlicher Stress kann sich auf Kind übertragen
Manchmal wirken aber auch weniger sichtbare Einflüsse über die Plazenta aufs Kind ein. So haben Kinder von Müttern mit erhöhter Stressbelastung während der Schwangerschaft ein größeres Risiko für Angsterkrankungen und affektive Störungen, erläutert Claudia Buß, die am Institut für Medizinische Psychologie der Charité an den Auswirkungen von Stress und Trauma auf die Entwicklung des Kindes forscht. Selbst bereits zurückliegende belastende Erfahrungen der Mutter können sich negativ auswirken, vor allem Vernachlässigung und Missbrauchserfahrungen in der Kindheit.
Aus evolutionsbiologischer Sicht könnte das von Vorteil gewesen sein. »Ganz früh bekommt der Fötus das Signal: Du wächst in einer stressreichen, gefährlichen Umwelt auf«, erklärt Buß. Darum sei es eigentlich gut, wenn das Gehirn so programmiert ist, dass man wachsamer ist, also sensitiver gegenüber möglicherweise gefährlichen Reizen. Was in der Vergangenheit einmal überlebenswichtig gewesen sein könnte, wird heute jedoch pathologisiert. Fachleute nennen das Resultat Angststörung.
Eine der ersten Reaktionen des Körpers auf Stress ist die Freisetzung des Hormons Cortisol. Und das ist gut so: Für eine normale Entwicklung und Reifung ist ein Fötus darauf angewiesen. Weil er bis zur Mitte der Schwangerschaft kein eigenes Cortisol bildet, muss er das Hormon von der Mutter erhalten, sagt Claudia Buß. Da es gleichzeitig nicht zu viel sein darf, gibt es in der Plazenta einen Botenstoff, der die Feinsteuerung übernimmt. Er baut aktives in inaktives Cortisol um. So gelangt nur ein kleiner Prozentsatz des mütterlichen Stresshormons zum Kind. Das Problem: Es gibt Hinweise darauf, dass bei chronischem Stress das Umbauhormon herunterreguliert wird. Gleichzeitig ist der Cortisolspiegel der Mutter dann erhöht. Und zusätzlich kann Cortisol die Produktion des Corticotropin-Releasing-Hormons (CRH) in der Plazenta stimulieren, das die Cortisolausschüttung noch mehr aktiviert. All diese miteinander verschränkten Prozesse führen am Ende dazu, dass zu viel Cortisol beim Kind ankommt, wenn die Mutter unter andauerndem Stress leidet.
Ein erhöhter Cortisolspiegel kann sich dann auf Volumen und neuronale Verschaltung von Amygdala und Hippocampus auswirken, wie Claudia Buß nachgewiesen hat. Bei chronischem Stress sind außerdem entzündungsfördernde Zytokine dauerhaft erhöht, ergänzt die Psychologin. Letztere passieren wahrscheinlich nicht einfach die Plazenta, sondern werden aktiv von ihr gebildet.
»Wir haben im Moment keine guten Möglichkeiten, die Funktion der Plazenta von außen zu verfolgen«Anna Penn, Neonatologin
Trägt man all diese Evidenz zusammen, ist es schleierhaft, warum das Organ nicht mit Aufmerksamkeit überschüttet wird. Vergleicht man die Zahl der Veröffentlichungen zur Plazenta mit denen über das Gehirn, kommt Erstere auf einen Anteil von nicht einmal fünf Prozent. Während in den USA in den Jahren 2014 bis 2024 mehr als drei Milliarden US-Dollar für die »BRAIN Initiative« ausgegeben wurden, ein Großprojekt zur Erforschung des Gehirns, gingen auf das Konto des »Human Placenta Project« im gleichen Zeitraum lediglich knapp 100 Millionen US-Dollar. Gibt man den Begriff »Neuroplacentology« in die Medizindatenbank PubMed ein, erscheinen gerade einmal 17 Einträge (Stand 01/2025). »Wir fangen gerade erst an, die Bedeutung der Plazenta für die Entwicklung des kindlichen Gehirns zu verstehen«, sagt Alexandre Bonnin.
Das hat konkrete Auswirkungen. »Wir befinden uns im Zeitalter der hochentwickelten molekularen Medizin«, betont Daniel Weinberger. Dennoch werde bei komplizierten Schwangerschaften nach wie vor häufig schlicht Bettruhe verordnet. An der Johns Hopkins University arbeitet er derzeit gemeinsam mit Bioingenieuren daran, Trophoblasten gezielt aufzuspüren und Entzündungsprozesse darin mit Hilfe von Designermolekülen zu stoppen. Im Moment sei eine solche Anwendung im klinischen Alltag jedoch noch eine Zukunftsvision.
Am nächsten dran an einem Anwendungsszenario ist wahrscheinlich Anna Penn. Sie ging im Tierexperiment noch einen Schritt weiter und verabreichte denjenigen Mäusen, die geringere Mengen des Hormons Allopregnanolon abbekommen hatten, in der späten Schwangerschaft eine einmalige Ersatzdosis. Derart behandelte Mäuse entwickelten kein autismusähnliches Verhalten und wiesen keine entsprechenden Auffälligkeiten im Gehirn auf. Das könnte auch für Menschen eine gute Nachricht sein.
»Wir haben im Moment keine guten Möglichkeiten, die Funktion der Plazenta von außen zu verfolgen«, sagt Anna Penn. »Während einer Schwangerschaft ist es schwierig, weil niemand die Entwicklung des Kindes gefährden möchte.« In Zukunft könnten hier beispielsweise Genanalysen, Bluttests oder Bildgebungsverfahren zum Einsatz kommen.
»Wenn wir den Müttern helfen, helfen wir gleich zwei Personen«Claudia Buß, Psychologin
Gleichzeitig lässt sich mit dem Thema auch Geld verdienen. Und das kann weniger forschungsgetriebene Motive wecken. Im Jahr 2013 stellte ein Team um den Yale-Forscher Harvey Kliman einen kommerziellen Test vor, um das Autismusrisiko eines Kindes anhand der Morphologie der Plazenta nach der Geburt zu beurteilen. Die Wissenschaftler hatten beobachtet, dass abnormale Falten des Organs mit einem erhöhten Risiko für Autismus im Kindesalter einhergehen.
In der Fachwelt sah man diesen Test auf Grund der eher geringen Spezifität kritisch. Anna Penn, die daran nicht beteiligt ist, sagte in einem Interview mit dem amerikanischen Magazin »The Transmitter«, dass solche Falten bei vielen Formen von Plazentastress entstehen können. Alexandre Bonnin, ebenfalls nicht beteiligt, weist darauf hin, dass die Daten, auf die sich die zu Grunde liegende Studie stützt, dürftig erscheinen. Die Aussagekraft des Tests müsse man daher mit Bedacht bewerten. »Die Plazenta hat nach der Geburt ausgedient«, warnt auch Claudia Buß. »Sie ist dann ein totes Organ.« Darum müssen die Erkenntnisse, die man zu diesem Zeitpunkt gewinnt, mit Vorsicht interpretiert werden. Man wisse nämlich nicht genau, was dessen Zustand nach der Entbindung über die gesamte Schwangerschaft aussagt.
Warnung vor Schuldzuweisungen
Wenn man über die Rolle der Plazenta bei der Entwicklung des Gehirns und von psychischen Erkrankungen spricht, sollte man die Formulierungen allerdings behutsam wählen. »Viele Leute glauben, dass man damit den Müttern die volle Verantwortung zuschiebt«, gibt Daniel Weinberger zu bedenken. »Dabei ist die Plazenta ein fötales Organ. Sie stammt vom Fötus, nicht von der Mutter.«
Denjenigen Müttern, denen es ohnehin schon schlecht geht, auch noch die Schuld dafür zu geben, dass ihre Kinder weniger fit sind, sei natürlich das Letzte, was die Plazentaforscher erreichen wollen, sagt Claudia Buß. Ganz im Gegenteil. »Die Forschung soll ja eigentlich zeigen: Wir haben hier eine vulnerable Lebenssituation. Und wenn wir den Müttern helfen, helfen wir gleich zwei Personen.«
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.