Lexikon der Psychologie: Sucht
Essay
Sucht
Wolfgang Heckmann
Begriff
Der alltagssprachliche Umgang mit dem Begriff Sucht hat sich seit der Frühgeschichte der Systematisierung von Krankheitsbegriffen deutlich verändert: Während er zunächst synonym verwendet wurde mit den Begriffen Siechtum oder Krankheit (so etwa in der Schwindsucht oder Wassersucht und heute noch in der Gelbsucht), ist er mittlerweile allein auf zwanghaftes (in den romanischen Sprachen: manisches) Verhalten orientiert. Zugleich hat er sich erheblich erweitert: von den stoffgebundenen Formen (Alkoholismus oder Drogen-Sucht) zu den nicht stoffgebundenen Formen (Spielsucht, Workoholismus). Der sogenannte “weite” Suchtbegriff war zunächst nicht unumstritten, nicht zuletzt von seiten der Suchtkrankenhilfe, weil befürchtet wurde, daß die erst in den 50er Jahren juristisch erreichte Anerkennung des Alkoholismus als Krankheit und die damit einhergehende ethische und versicherungsrechtliche Bewertung durch eine Aufweichung des Suchtbegriffes in Frage gestellt werden könnte. Allerdings findet sowohl im forensischen Bereich (bei der Beurteilung der persönlichen Verantwortung für Straftaten) als auch im therapeutischen System inzwischen zumindest die Spielsucht als nicht stoffgebundene Variante süchtigen Verhaltens Berücksichtigung. Für den Zusammenhang der primären Prävention bzw. der Gesundheitsförderung und der Früherkennung einer Suchtkrankheit ist der weite Suchtbegriff überdies ohnehin nicht mehr verzichtbar. Denn hier stehen eher erste Anzeichen süchtigen Verhaltens in verschiedenen Lebensbereichen (als übermäßiger Konsum von Süßigkeiten, Comics, Fernsehen) und nicht schon manifester Konsum von Substanzen mit Suchtpotential im Mittelpunkt.
Suchtmotive und Suchtverhalten
Eine Reihe wesentlicher Aspekte der Suchtproblematik erfordert psychologische Expertise.
1) Süchtiges Verhalten wird in der Regel als quantitativ oder qualitativ bewertete Verwahrlosung von verbreitetem, “normalen”, alltäglichen Verhalten wahrgenommen. Das macht die Diagnose eines Verhaltens als (behandlungsbedürftige) Suchterkrankung so kompliziert: Es erschwert die Selbsterkenntnis und erfordert aufwendigere, dem Prozeß folgende, diagnostische Verfahren.
2) Die meisten Gesellschaften leisten sich eine Doppelmoral gegenüber dem Drogenkonsum: Sie tolerieren einige Drogen und stellen andere unter Prohibition; sie akzeptieren oder fördern gar ein gewisses Maß an Konsum, ächten aber die nicht mehr maßvollen Konsumenten und ziehen sie zur Verantwortung. Das führt vor allem bei jungen Menschen zu einer doppelten Kommunikation, die sich zum einen an den allgemeinen gesellschaftlichen Erwartungen, zum anderen an der jeweiligen subkulturellen Einbindung orientiert. Dadurch wird verdecktes Verhalten (im “Dunkelfeld”) begünstigt.
3) Der Konsum von Suchtstoffen und auch andere exzessive Verhaltensweisen können nach einer Phase der Gewöhnung in eine psychische Abhängigkeit führen. Obwohl in der öffentlichen Diskussion eher die physische Abhängigkeit mit dem Begriff Sucht assoziiert ist, zeigt sich bei näherer Analyse, daß die seelische Abhängigkeit immer erkennbar wird, während die körperliche Abhängigkeit nicht bei allen als Drogen bezeichneten Substanzen nachweisbar ist. Auch die Behandlung einer manifesten Suchterkrankung muß sich schon nach kurzer Zeit in weit größerem Umfang auf sozial- und psychotherapeutische als auf somatische Elemente konzentrieren (Drogenwirkungen).
4) Auch andere psychische Folgen des süchtigen Verhaltens spielen im Prozeß der Erkrankung eine Rolle. Es entsteht z.B. in vielen Fällen eine Art “psychischer Kater”; nach dem Verhaltens-Exzeß setzt Bedauern und schlechtes Gewissen ein, weil man sich eigentlich vorgenommen hatte, abstinent zu bleiben oder es zumindest nicht wieder so weit kommen zu lassen. Daneben sind bei Drogen ohne körperliches Abhängigkeits-Potential auch psychische bzw. psychosomatische Entzugserscheinungen zu beobachten.
5) Die Motive süchtigen Verhaltens variieren individuell und sind sehr komplex. In der Regel lassen sich jedoch zwei funktionale Richtungen finden, die bei jedem Einzelfall auftreten, z.T. gleichzeitig nebeneinander, z.T. mit ungleichen und wechselnden Gewichten: das Flucht-Motiv (das lange Zeit und viel zu einseitig mit dem Drogen-Konsum gleichgesetzt wurde), d.h. eine Instrumentalisierung süchtigen Verhaltens als Abschalten, vor den Problemen Davonlaufen, ein Bestreben, sich selbst und die Umwelt nicht spüren zu müssen – und das Such-Motiv (das immer noch zu oft vernachlässigt wird), d.h. die Hoffnung, im Zuge des süchtigen Verhaltens tiefe Sehnsüchte, die auf anderem Wege nicht erfüllbar erscheinen, zu stillen, ein Sich-nicht-zufrieden-Geben mit dem, was die Welt bietet.
6) In vielen Fällen sind süchtige Verhaltensweisen auch Ausdruck einer mangelnden Fähigkeit, Bedürfnisse aufzuschieben. Der Konsum von Drogen, insbesondere das Injizieren von Opiaten, symbolisiert geradezu, wie in einem einzigen Akt, gewissermaßen auf Knopfdruck, eine Vielzahl von Bedürfnissen gleichzeitig befriedigt wird: nach Wärme, nach Nähe, nach Nahrung, nach Sexualität, nach Transzendenz. In der Entstehungsgeschichte süchtigen Verhaltens und auch im Rückfallgeschehen dokumentiert sich sehr häufig, daß das Einverleiben von Suchtstoffen als apersonale Antwort auf personale Bedürfnisse, z.B. nach sozialem Kontakt, gegeben wird.
7) Ein ebenfalls bedeutendes Motiv kann in dem Versuch einer Selbstheilung durch Drogenkonsum bestehen: Kritische Lebensereignisse werden mit einer Alkohol-Phase überbrückt, oder eine psychische Störung wird durch Selbst-Medikation mit legalen oder illegalen Stoffen zu regulieren versucht. In sehr vielen Fällen von Co-Morbidität ist nicht mehr erkennbar, ob eine psychische Auffälligkeit Ausgangspunkt eines süchtigen Verhaltens war oder ob sie infolge eines Drogenmißbrauchs entstanden ist.
8) Charakteristisch an süchtigen Verhaltensweisen ist der Widerspruch zwischen Ziel-Orientierung und Mittel-Orientierung, d.h. ein sehr starker Wunsch nach einem besonderen, rauschhaften Erleben, dabei gleichzeitig ein Mangel an Kenntnissen über die dafür geeigneten Mittel, an Konzentration auf notwendige Vorsichtsmaßregeln. Die Folge sind bei einigen Formen süchtigen Verhaltens erhebliche Risiken bis hin zur Überdosierung und zur Mortalität.
9) Das Merkmal der Unangemessenheit des süchtigen Verhaltens, wie es vom sozialen Umfeld wahrgenommen wird, dringt im Laufe eines Suchtprozesses (oder einer sogenannten “Drogenkarriere”) auch in das Bewußtsein der Betroffenen, sei es, weil sie mit Rechtsnormen in Konflikt geraten, sei es, weil sie negative Folgen aus dem Drogenkonsum (z.B. Erkrankungen, berufliche oder ökonomische Folgen) selbst zu spüren bekommen. Schließlich geraten sie in einen Zustand, in dem sie nicht mehr die Herrschaft über die Droge ausüben, sondern der Stoff zum Organisator des Alltags wird, seiner Beschaffung und seinem Konsum alle anderen Lebens-Abläufe, Interessen und Pflichten untergeordnet werden. In dieser Situation kommt es bei manchen spontan zur “Kapitulation” vor der Droge, was zweifellos die günstigste Voraussetzung für eine Veränderung ist und bei den Selbsthilfegruppen und Abstinenten-Bünden in der Regel auch von ihren Mitgliedern erwartet wird.
10) Der Suchtprozeß ist aber fließend, und auch eine einmal erreichte Ausstiegs-Motivation bleibt nicht stabil. Professionelle Hilfe hat zu berücksichtigen, daß nicht in jedem Fall die Hilfesuchenden bereits vollständig von ihrem süchtigen Verhalten distanziert sind, sondern daß sie sich (auch noch über längere Zeit) in einem Ambivalenz-Konflikt befinden. Suchtkrankenhilfe muß deshalb ihr Klientel in jedem Einzelfall dort abholen, wo es sich befindet, und ganz unterschiedliche Maßnahmen anbieten, die insgesamt einer sich gegenseitig ergänzenden und miteinander vernetzten biopsychosozialen Strategie entsprechen (Drogen-Wirkungen).
Suchttheorien
Die wissenschaftlichen Beiträge zu den Ursachen der Drogenabhängigkeit lassen sich in vier z.T. miteinander konkurrierende, z.T. einander ergänzende Modelle zusammenfassen.
1) Das psychoanalytische Modell sieht im Drogenkonsum, insbesondere im Rausch, ein Moment der Regression, das auf einer prämorbiden Persönlichkeitsstruktur beruht. Diese wiederum wird auf eine frühkindliche Störung der Mutter-Kind-Beziehung zurückgeführt. In diesem theoretischen Rahmen spielen Begriffe wie "pharmakogener Orgasmus" und "Fetisch-Ersatz für die Mutterbrust" (Jenner in Fleisch, Haller & Heckmann, 1997) sowie "Kannibalismus", "Narzißmus" und "Koprophagie" eine bedeutende Rolle für die Erklärung des Phänomens.
2) Das lernpsychologische Modell sieht im Drogenkonsum jeglicher Art ein in der sozialen Situation erworbenes Verhalten, das im Zusammenhang gesellschaftlicher oder subkultureller Normen verstärkt wird. Positive Erfahrungen mit dem Stoff im Anfangsstadium der Abhängigkeit wirken ebenfalls als Verstärker. In diesen theoretischen Rahmen gehören Begriffe wie "Lernmodell", "Erreichbarkeit" und "setting" sowie "sozialer Druck", "Selbstkontrolle" und "Aufschiebenkönnen von Befriedigungen" (Günther & Gritsch in Fleisch, Haller & Heckmann, 1997).
3) Das soziologische oder sozialisationstheoretische Modell sieht im Drogenkonsum einen Ausdruck einer spezifischen gesellschaftlichen Situation und eines spezifischen Herkunftsmilieus. Hinzu kommen als übergreifende Bedingungsfaktoren kulturelle Veränderungen und gesellschaftspolitische Faktoren. In diesen theoretischen Rahmen fallen Begriffe wie "repressive/permissive Erziehung", "sozioökonomischer Status", "verwaltete Welt", "Konsummoloch" und "Anonymität" (Gerdes & von Wolffersdorf-Ehlert, 1974).
4) Das multifaktorielle Modell sieht im Drogenkonsum das Zusammenwirken mehrerer Faktoren, die in unterschiedlicher Weise voneinander abhängen und sich gegenseitig bedingen. Das Modell geht auf die Definitonsbemühungen der WHO zurück und wurde mit einigcr Verzögerung für die europäische Fachliteratur adaptiert (Kielholz & Ladewig, 1973). Die vielen Einzelmerkmale der Entwicklung zur Drogenabhängigkeit werden in diesem theoretischen Rahmen in die drei Faktoren "Droge", "Persönlichkeit des Drogenkonsumenten" und "Gesellschaft" (oder "sozialer Nahraum und gesellschaftliches Umfeld") zusammengefaßt ( Abb. ). Verständlicherweise hat sich das multifaktorielle Modell für die praktische Arbeit noch am ehesten als hilfreich erwiesen, da es die einheitliche Ursache für Drogenkonsum ebensowenig gibt wie den Konsumententypus. Vielmehr finden sich in den Lebensgeschichten von Drogenabhängigen vielfältige Faktoren, die zu einem Geflecht von Bedingungen kumulieren, deren einzig mögliche Konsequenz oder deren einzig möglicher Ausweg im Suchtverhalten liegt.
Zugleich wird immer wieder deutlich, daß nur selten aus der Lebensgeschichte und Lebenswelt ableitbar ist, für welche Droge sich der Konsument entscheidet, sondern dies von eher zufälligen Angeboten und Begegnungen abhängt. So ergibt sich entgegen der verbreiteten Sucht, alle bedrückenden Phänomene eindimensional durch Schuldzuweisung erklären zu wollen, für die Abhängigkeit vom Herointyp, vom Alkoholtyp usw. eine Dialektik von Zufall und Notwendigkeit: Notwendig entwickelt sich eine Persönlichkeit aus ihrer Lebenswelt zum abweichenden Verhalten oder zum Suchtverhalten, zufällig ist es der Heroin-Dealer, dem sie in der entscheidenden Krisensituation ausgeliefert ist.
Obwohl die Reduktion der WHO-Definition auf stoffgebunde Suchtverhalten das gesamte gesellschaftliche Ausmaß der Suchtproblematik verschleiert, ist doch in der allgemeinen Verbreitung der Ursachen-Trias Droge-Persönlichkeit-Gesellschaft” ein Durchbruch fortgeschrittenen wissenschaftlichen Denkens zu erkennen, das eine Abschiebung der Problematik auf Randgruppenexistenzen nicht zuläßt. Dennoch ist auch unter Verwendung der Ursachen-Trias möglich, die Gewichte unterschiedlich zu verteilen und auf der Grundlage dieser eher politischen Entscheidung bestimmten Maßnahmengruppen (z.B. zur Vernichtung der ursächlich beteiligten Drogen) Vorrang einzuräumen. Neben der Ursachen-Trias gibt es weitere Versuche, die Vielfalt der Entstehungsbedingungen und Einflußfaktoren für süchtiges Verhalten zu systematisieren (Vier-M-Modell der Sucht, Fünf-Faktoren-Modell der Sucht).
Literatur
Fleisch, E., Haller, R. & Heckmann, W. (Hrsg.). (1997) Suchtkrankenhilfe. Lehrbuch zur Vorbeugung, Beratung und Therapie. Weinheim und Basel.
Gerdes, K. & von Wolffersdorf-Ehlert, C. (1974). Drogenszene – Suche nach Gegenwart. Stuttgart.
Gros, H. (Hrsg.). (1996). Rausch und Realität. Eine Kulturgeschichte der Drogen. Stuttgart/München/Düsseldorf/Leipzig.
Heckmann, W. (1991). Drogentherapie in der Praxis. Weinheim.
Kielholz, P. & Ladewig, D. (1973). Die Abhängigkeit von Drogen. München.
Schuller, A. & Kleber, J.A. (Hrsg.). (1993). Gier. Zur Anthropologie der Sucht. Göttingen.

Abb. Sucht: Ursachen für Sucht
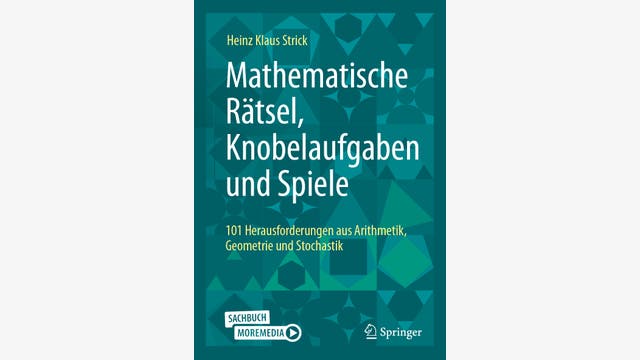


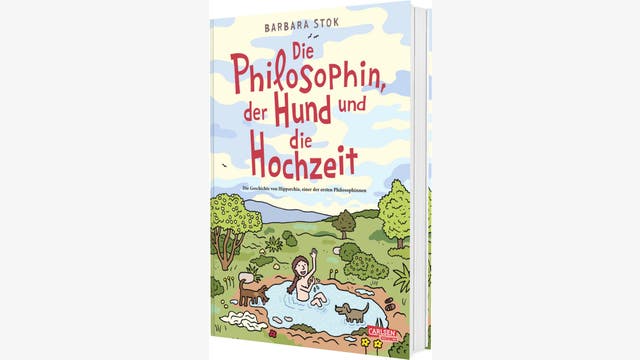



Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.