Belastungen: Gelassener mit Stress umgehen

Im Juni 2019 sorgte Angela Merkel weltweit für Schlagzeilen – allerdings nicht mit einer politischen Entscheidung: Beim Antrittsbesuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj begann die damalige Kanzlerin am ganzen Leib zu zittern und löste damit ein gewaltiges Rauschen im Blätterwald aus. Rund um den Globus spekulierten Journalisten über Merkels Gesundheitszustand. Der Tremor könne das Resultat einer Stressantwort sein, zitierte der britische »Guardian« einen Experten. »Zu hohes Pensum, zu wenig Pause?«, fragte die »Berliner Morgenpost«.
Ob es tatsächlich an ihrer immensen Arbeitsbelastung lag oder doch nur – wie Merkel nach dem Vorfall selbst zu Protokoll gab – schlicht an der Tatsache, dass sie zu wenig getrunken hatte, sei dahingestellt. Klar ist jedoch, dass der Arbeitsalltag im Kanzleramt nicht ohne ist. Der ständige Termindruck. Das Bewusstsein, dass jede Entscheidung Wohl und Wehe zahlloser Menschen beeinflusst. Die Tatsache, dass jeder Schritt von den Medien kritisch beäugt wird. Und dass politische Gegner nur darauf warten, etwaige Fehler auszuschlachten.
Diese Rahmenbedingungen gehören zur Jobbeschreibung politischer Spitzenpositionen. Und Angela Merkel hat sie in ihren vielen Jahren im Amt erstaunlich gut verkraftet. Sie sei berühmt für ihre Disziplin und Ausdauer; die letzte Staatenlenkerin, die nach langen Nachtsitzungen noch auf den Beinen sei, urteilte die BBC. Der britische »Guardian« bezeichnete ihr Stehvermögen gar als »legendär«. Vielleicht stieß ihr Zittern auch deshalb auf so viel Medienresonanz: weil man davor eher das Gefühl hatte, dass sie sich selbst unter höchster Belastung nicht aus der Ruhe bringen ließ. Warum ist das so? Warum gehen manche Menschen gelassener mit Drucksituationen um als andere? Und lässt sich das lernen?
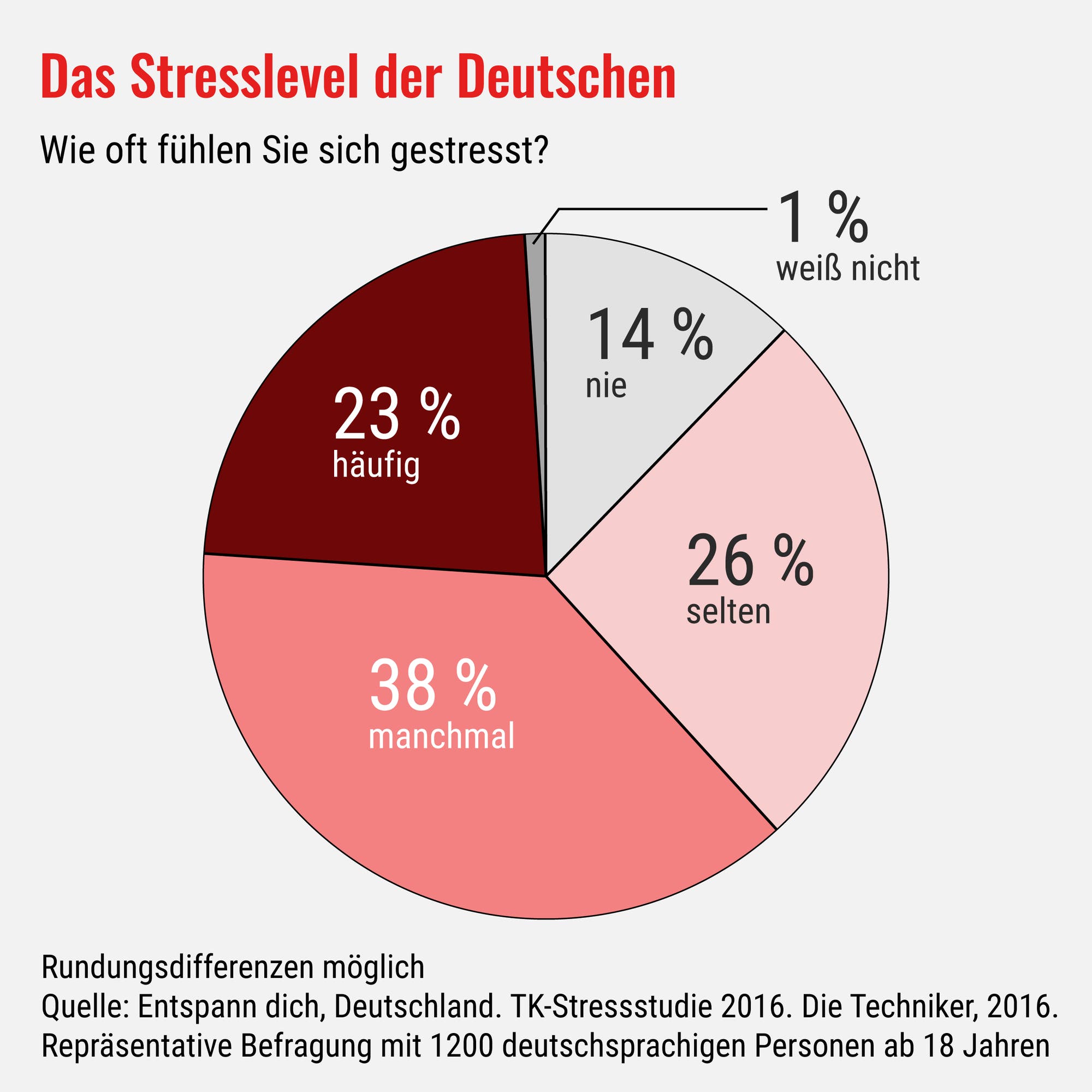
Gut 200 Kilometer vom Berliner Regierungsviertel entfernt sitzt eine Frau in einem Lüneburger Café und wischt über ihr Handy. Dörte Behrendt kennt sich aus mit Stress; sie begegnet dem Thema nahezu täglich. Zum einen hautnah, bei ihrer Arbeit als Schulpsychologin. Und zum anderen als Wissenschaftlerin – in ihrer Doktorarbeit an der Universität der 70 000-Einwohner-Stadt beschäftigt sie sich mit Resilienz. Der etwas sperrige Begriff bezeichnet die Fähigkeit, schwierige oder belastende Lebensumstände durchzustehen. Dabei helfen kann zum Beispiel die Besinnung auf innere Kraftquellen. Unter Stress tendieren wir dazu, diese Ressourcen aus den Augen zu verlieren. »Wir sehen dann nur noch das Bedrohliche«, sagt Behrendt. Folge: Wir fühlen uns überfordert, getrieben; außer Stande, die Anforderungen, die an uns gestellt werden, zu erfüllen.
Die Psychologin hat eine Handy-Applikation entwickelt, die dabei helfen soll, diesem Tunnelblick zu entkommen. Der Gedanke dahinter: Das Gehirn ist ein Muskel, den man trainieren kann – auch darauf, sich bewusst zu machen, wie viel wir tatsächlich zu leisten im Stande sind. »Die App hilft mir dabei, täglich so genannte Resilienzmomente zu sammeln«, sagt Behrendt. »Das sind herausfordernde Situationen, die ich gut gemeistert habe.« Sie nimmt einen Schluck von ihrem Tee und greift dann wieder zum Smartphone. »Sehen Sie, hier habe ich das Interview eingetragen. Jetzt mache ich noch ein Foto dazu, zur Erinnerung. Abends blättere ich dann durch meine gesammelten Momente und überlege noch einmal, was genau daran gut war.«
Mit Optimismus gegen Stress
Ziel ist es, den Blick auf solche kleinen Erfolge gezielt zu schulen. Um so langfristig insgesamt eine optimistischere Haltung zu entwickeln: Keine Angst, ich schaffe das schon. Wir nehmen die stressige Situation dann nicht mehr als Bedrohung wahr, sondern als Herausforderung. Psychologen sprechen auch von einem positiven Bewertungsstil (»positive appraisal style«). Möglicherweise ist er sogar der zentrale Faktor, der darüber entscheidet, wie gut wir mit Belastungen zurechtkommen. Dieser Ansicht sind zumindest Raffael Kalisch, Marianne Müller und Oliver Tüscher vom Deutschen Resilienz Zentrum in Mainz, die dazu 2015 einen umfassenden Artikel veröffentlicht haben. Darin bezeichnen sie einen positiven Bewertungsstil als Schlüsselmechanismus, der gegen die schädlichen Auswirkungen von Stress schütze.
5 Tipps für einen entspannten Umgang mit Stress
1. Halten Sie täglich belastende Situationen fest, die Sie gut gemeistert haben. Je länger Sie solche Resilienzmomente sammeln, desto wirkungsvoller ist die Methode.
2. Versuchen Sie, typische Stresssymptome wie Herzklopfen nicht als etwas Schlechtes zu betrachten – sondern als einen Mechanismus, der Ihren Körper im Angesicht von Herausforderungen leistungsfähiger macht.
3. Gönnen Sie sich bei größeren Belastungen regelmäßige Pausen, um runterzukommen. Dabei helfen zum Beispiel Atemübungen, Achtsamkeitstraining, Muskelentspannung oder Sport.
4. Hinterfragen Sie kritisch, ob etwas, was Ihnen nicht gelingt, wirklich langfristig negative Folgen für Sie haben wird.
5. Meiden Sie herausfordernde Situationen nicht, sondern setzen Sie sich ihnen gezielt aus. Dadurch erlernen Sie mit der Zeit die richtigen Strategien, um diesen Herausforderungen zu begegnen, und haben im Ernstfall die Gewissheit: »Ich schaffe das schon!«
Und die können gravierend sein. Ständige Anspannung kann zu Angststörungen und Depressionen führen, zu Herzerkrankungen oder Diabetes. Zählt man indirekte Folgen wie Alkoholismus hinzu, verursacht Stress europaweit Schätzungen zufolge jährlich Kosten von 300 Milliarden Euro. »Eigentlich ist die Stressantwort aber ein Mechanismus, der sich im Lauf der Evolution als äußerst sinnvoll erwiesen hat«, betont Johannes Laferton von der Psychologischen Hochschule Berlin. »Wenn der Steinzeitmensch im Gebüsch ein Knacken gehört hat, musste er schnell seine Ressourcen aktivieren, um zu kämpfen oder zu fliehen.« Bei Gefahr sorgt der Sympathikus (ein Teil unseres vegetativen Nervensystems) daher dafür, dass Blutdruck, Puls- und Atemfrequenz steigen, ebenso wie die Muskelspannung. Die Wahrnehmung fokussiert sich vollständig auf die mögliche Bedrohung; alles andere wird ausgeblendet. Zusätzlich fährt der Körper die Immunantwort hoch, so dass etwa bei einer Verletzung Wunden schneller heilen. Sobald die Gefahr vorüber ist, normalisieren sich diese Funktionen wieder.
An die Stelle des Säbelzahntigers sind heute Termin- und Leistungsdruck getreten. Zusätzlich liefern uns die Medien rund um die Uhr bedrohliche Nachrichten frei Haus. Vielen Menschen fehlen daher zunehmend die Ruhephasen, in denen sie herunterfahren können – der Stress wird chronisch. Als Folge dieser Dauererregung schüttet der Körper Hormone aus, die das Immunsystem langfristig unterdrücken. Resultat können chronische Entzündungen sein, die zum Teil auch für Folgeerkrankungen verantwortlich sind. Nicht umsonst hat Stress so einen schlechten Ruf. Vielleicht verstärkt dieser aber sogar noch seine negativen Konsequenzen, wie Johannes Laferton kürzlich zusammen mit seiner Kollegin Susanne Fischer von der Universität Zürich festgestellt hat: Wer Stress als Bedrohung sieht, reagiert demnach auf Drucksituationen im Alltag stärker mit unangenehmen Emotionen wie Angst. Anderen Ergebnissen zufolge entwickeln Menschen, die eine negative Einstellung zu Stress haben, unter Anspannung häufiger psychosomatische Beschwerden, zum Beispiel Rückenschmerzen oder Schlafstörungen. »Möglicherweise ist das ein Risikofaktor, bei dem man mit gezielten Interventionen ansetzen kann«, meint Laferton. Zweifelsfrei bewiesen sind diese Zusammenhänge aber noch nicht.
Besser untersucht ist das so genannte »Reappraisal«. Dabei lernen Menschen, typische Stresssymptome – die schwitzigen Hände, das rasende Herz – nicht als Ausdruck von etwas Schlimmem zu sehen (»Ich stehe gerade unter extremem Druck«). Stattdessen interpretieren sie sie als Reaktionen des Körpers, die ihn im Angesicht einer Herausforderung leistungsfähiger machen. Typischerweise empfinden sie Drucksituationen dadurch als weniger unangenehm, wie unlängst eine Metastudie aus Kanada zeigen konnte. Zudem schneiden sie oft auch besser ab, etwa in einem Experiment des US-Psychologen Jeremy P. Jamieson. Darin teilte er Fachhochschulstudierende mit Mathedefiziten in zwei Gruppen auf. Die einen erhielten Informationen über die segensreichen Wirkungen der Stressantwort. Sie zeigten sich daraufhin in einer Prüfungssituation weniger ängstlich und erzielten bessere Ergebnisse.
»Diese Strategie funktioniert«, bestätigt Donya Gilan vom Deutschen Resilienz Zentrum in Mainz. »Man kann die Erregung in der Tat für sich nutzen und dadurch bessere Leistungen erzielen. Das gelingt aber nur, solange der Stress nicht zu groß ist.« Bei sehr hoher Belastung sei es dagegen wichtig, die Anspannung herunterzufahren – einerseits durch regelmäßige kurze Pausen und andererseits durch Atemübungen, Achtsamkeitstrainings oder Muskelentspannung. All diese Methoden stimulieren den Parasympathikus, den Gegenspieler des Sympathikus. »Man sollte ausprobieren, wofür man individuell am empfänglichsten ist. Und zusätzlich natürlich durch Sport oder andere körperliche Betätigung Dampf ablassen.«
Die Perspektive wechseln
Es gebe viele Faktoren, die unseren Umgang mit Stress beeinflussen, betont Gilan: unsere Erbanlagen; die Tragkraft unseres sozialen Netzes; ob wir arm sind oder reich; und natürlich einschneidende negative Lebenserfahrungen, vor allem in der Kindheit. »Es wäre ganz sicher zynisch zu sagen, dass unser Verhalten in Drucksituationen nur von unserer Einstellung abhängt.« Dennoch spielt auch für sie die Bewertung des Stressors eine ganz zentrale Rolle. Wo möglich, solle man sich daher auf positive Aspekte konzentrieren: Wo habe ich noch eine Handlungsmöglichkeit? Kann ich einen Freund fragen, ob er mir hilft? Was habe ich früher in ähnlichen Situationen gemacht? »In Stresssituationen verzerrt sich die Wahrnehmung in eine negative Richtung«, sagt Gilan. »Das muss man korrigieren. Was aber keineswegs bedeutet, die rosarote Brille aufzusetzen und sich selbst zu betrügen.«

Ansatzpunkte für einen solchen Perspektivwechsel gibt es mehrere – nicht nur die Besinnung auf positive Vorerfahrungen. Die hilft uns zwar, unsere Fähigkeiten und Ressourcen realistischer einzuschätzen. Doch auch dann können wir eine Situation als sehr bedrohlich empfinden, wenn ein Scheitern böse Konsequenzen wie den Verlust des Arbeitsplatzes hätte. Donya Gilan sieht heute eine Tendenz zur Katastrophisierung: »Viele Menschen können nicht mehr unterscheiden, welche Reize tatsächlich gefährlich sind und welche nicht.« Wie schlimm ist es wirklich, dass das Bad nicht geputzt ist, obwohl gleich die Gäste auf der Matte stehen? Werden sie mich in Zukunft wie einen Aussätzigen behandeln, nur weil im Waschbecken noch Zahnpastaspuren kleben?
Um zu einer realistischeren Einschätzung zu kommen, kann es zum Beispiel helfen, sich von dem bedrohlichen Ereignis zu distanzieren. Die US-Psychologinnen Emma Bruehlman-Senecal und Ozlem Ayduk baten vor einigen Jahren Studierende ins Labor, die bei einer wichtigen Prüfung schlechte Ergebnisse erzielt hatten. Die Teilnehmer sollten sich mental zehn Jahre in die Zukunft versetzen und darüber nachdenken, inwieweit ihre Note dann noch ihre Gefühle beeinflussen werde. Die Studierenden waren danach deutlich besserer Stimmung als Kommilitonen in einer Kontrollgruppe. Außerdem waren sie häufiger davon überzeugt, dass ihr schlechtes Abschneiden langfristig keine bösen Konsequenzen haben würde.
»Viele Menschen können nicht mehr unterscheiden, welche Reize tatsächlich gefährlich sind und welche nicht«
Donya Gilan, Deutsches Resilienz Zentrum
Stress entsteht zum großen Teil durch Denkmuster, die sich über Jahrzehnte eingeschliffen haben – ganz ähnlich, wie das ständige Herumlümmeln auf dem Bürostuhl mit der Zeit Haltungsschäden verursacht. Die zu korrigieren, erfordert jahrelange Rückenübungen. Das ist mit der Haltung gegenüber Stress nicht anders: Am besten trainiere man diese »genauso wie beim Sport«, betont die Lüneburger Psychologin Dörte Behrendt. »Nämlich durch regelmäßige Wiederholung.« Soll heißen: Sich ein paar Tage hinzusetzen und Resilienzmomente zu sammeln, reicht nicht. Wer das aber einige Monate durchhält, dem kann diese Methode tatsächlich enorm helfen – das zeigten zumindest die vorläufigen Ergebnisse, sagt Behrendt.
Am besten sei es jedoch, sich immer wieder in herausfordernde Situationen zu bringen, betont Donya Gilan. »Das ist das wirksamste Resilienztraining.« Denn nur auf diese Weise lernen wir mit der Zeit die nötigen Strategien, mit Herausforderungen umzugehen. Als Folge steigt dann langfristig unsere Selbstwirksamkeitserwartung: die sichere Annahme, die Lage mit Hilfe unserer Kompetenzen und Ressourcen bewältigen zu können; nicht getrieben, sondern Herr oder Herrin der Lage zu sein.
Angela Merkel scheint diese Fähigkeit jedenfalls zu haben. In Gesprächen mit der Fotografin Herlinde Kölbl berichtete sie Anfang der 1990er Jahre von den enormen Strapazen ihres Berufs, die sie manchmal an die Grenzen ihrer Belastbarkeit brächten. Gleichzeitig verlieh sie darin aber einer festen Überzeugung Ausdruck: »Ich weiß, dass ich durchkomme.«





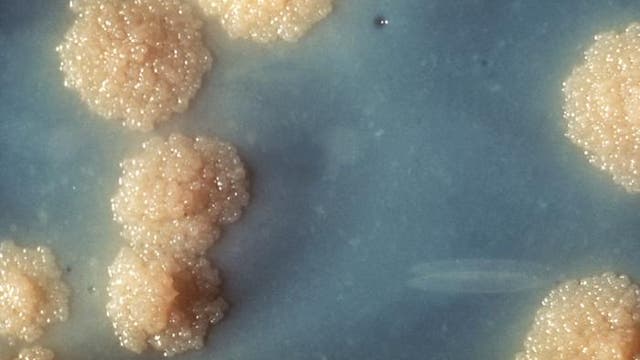
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.