Human Brain Project: Die Vision vom simulierten Hirn
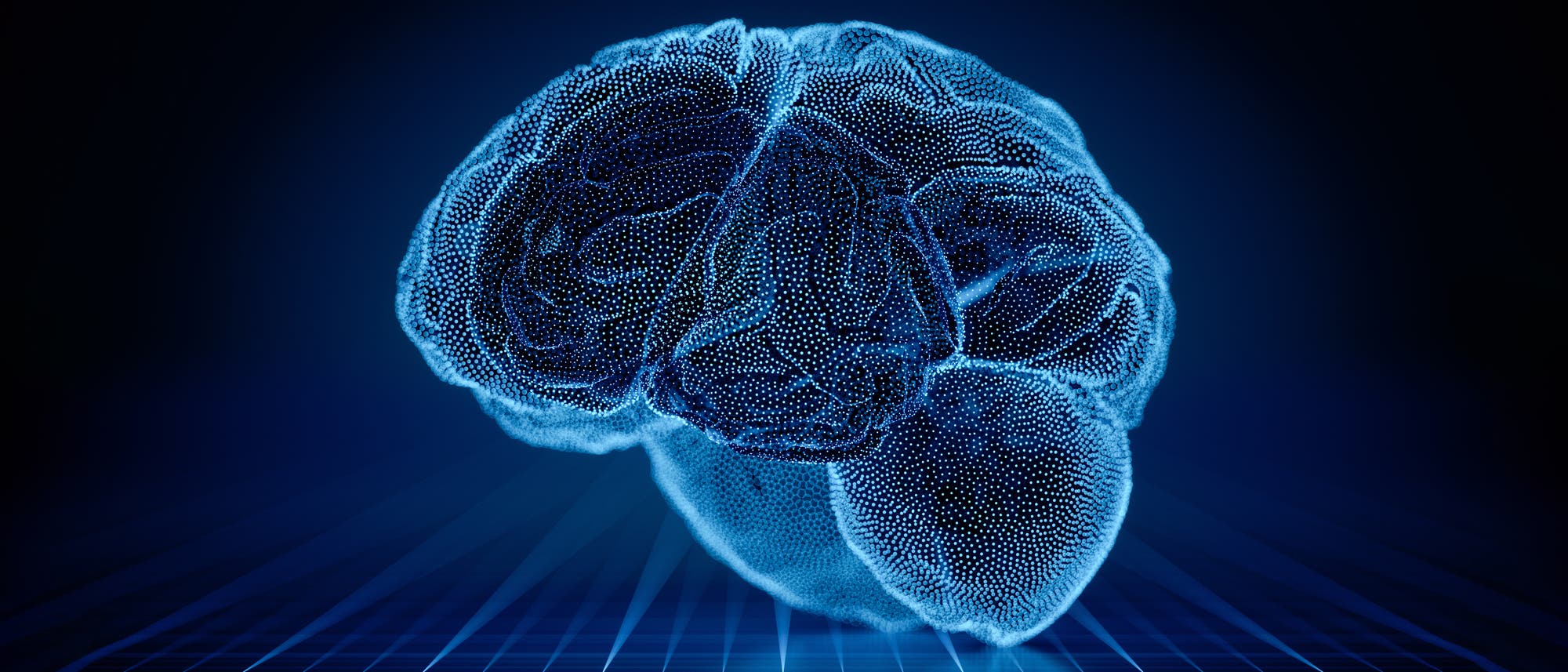
Am Anfang stand die Vision: ein allumfassendes, realistisches Computermodell des menschlichen Gehirns. Mit Visionen ist es aber so eine Sache. Sie klingen im ersten Moment ungemein attraktiv. Nach einem gründlichen Realitätscheck können sie sich jedoch schnell als naive Träumerei entpuppen, gar als Fantasterei. So geschehen beim Human Brain Project (HBP), einem EU-Projekt, an dem 122 Forschungseinrichtungen aus 17 Ländern teilnahmen und das im September 2023 auslief.
Man wollte das Gehirn komplett entschlüsseln, neurodegenerative Krankheiten heilen und so die Gesellschaft als Ganzes voranbringen. Diese hochtrabenden Versprechungen fielen dem Vorhaben schnell auf die Füße. Von »unrealistischen Erwartungen« und »einem Verlust an wissenschaftlicher Glaubwürdigkeit« war rasch die Rede. Nach Projektende fällt das Fazit der Verantwortlichen dennoch positiv aus. Konnte sich das HBP also nach den Startschwierigkeiten berappeln? Welche Ziele hat man erreicht?
Rückblick. Henry Markram, Professor für Neurowissenschaften an der École Polytechnique Fédérale de Lausanne, stellte sein Vorhaben 2009 in einem TED-Talk erstmals der Öffentlichkeit vor: Er wolle die knapp 100 Milliarden Neurone und 100 Billionen Synapsen des menschlichen Gehirns in einem realistischen Computermodell simulieren. Er deutete sogar an, dass dieses zu Intelligenz und Selbstbewusstsein fähig sein könnte. »In nur zehn Jahren werden wir euch ein Hologramm schicken, das mit euch spricht«, prognostizierte er euphorisch. Man würde damit neurodegenerative Krankheiten und psychische Störungen wie Schizophrenie verstehen und Therapien dagegen entwickeln können. Auf viele Tierversuche ließe sich künftig verzichten. Und er bezeichnete den Plan als einen »wesentlichen Schritt in der Evolution«.
Markram gelang es nicht nur, das Publikum in seinen Bann zu ziehen, sondern auch die EU-Kommission. Seine Idee sollte als Fundament eines europaweiten Forschungsprojekts dienen, das ab 2013 über zehn Jahre mit mehr als 600 Millionen Euro gefördert wurde: das Human Brain Project. Schon ein Jahr später gab es massive Kritik an dem Projekt. Im Juli 2014 attackierten Fachleute unter Führung der Kognitionswissenschaftler Alexandre Pouget von der Universität Genf und Zachary Mainen von der Champalimaud Foundation in Lissabon das HBP in einem offenen Brief. Vor allem die unklare Zielsetzung, falsche Versprechen sowie undurchsichtige Entscheidungsprozesse waren ihnen ein Dorn im Auge. Schnell kamen mehr als 800 Unterschriften zusammen, auch von vielen namhaften Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Die Unterzeichner drohten gar mit einem Boykott des Unterfangens. Ein Schlichtungsverfahren wurde eingeleitet und ein Ausschuss von 27 Experten prüfte die Argumente der Kritiker.
Eines der wesentlichsten fußte darauf, dass alle Forschungspläne zur Kognition aus dem HBP gestrichen worden waren. Man könne das Denkorgan allerdings niemals verstehen, wenn man es nur von einzelnen Neuronen und Synapsen ausgehend modellieren würde, so die Begründung. Man brauche neben einem solchen »Bottom-up-« auch einen »Top-down-Ansatz«, von »oben nach unten«. Und zwar, indem man das Gehirn und seine vielfältigen kognitiven Funktionen als Ganzes betrachte und daraus Rückschlüsse auf seine Netzwerkarchitektur ziehe.
Der Krach war vorprogrammiert
Andreas Herz, Professor für Computational Neuroscience an der LMU München, war damals Teil des Mediationskomitees. »Die Fördermittel fielen geringer aus als anfangs angenommen. Daher musste die Projektleitung überlegen, wie sich am besten Geld einsparen lässt«, sagt er. Und da das HBP vorrangig als datenwissenschaftliches Projekt geplant gewesen sei, habe man bei den Kognitionswissenschaften angesetzt, erklärt er das Vorgehen der Führungsriege. »Verständlicherweise fühlten sich dann Forscher auf den Schlips getreten, die erfolgreich zur Antragstellung beigetragen hatten und nun plötzlich keine Rolle mehr spielen sollten«, erinnert sich Herz. Er kritisiert außerdem die ursprüngliche Verteilung der Finanzmittel: »In der Regel sind Personen, die in den Entscheidungsgremien sitzen, nicht an der Forschung beteiligt.« Beim HBP sei das jedoch der Fall gewesen. Hinzu komme, dass viele »Alphamännchen mit starken Partikularinteressen« involviert waren, »der Krach war somit vorprogrammiert«.
Andreas Draguhn, Neurophysiologe und Professor an der Universität Heidelberg, hat damals den offenen Brief mit unterzeichnet. »Die Idee, von molekularer Ebene ausgehend ein Abbild des Gehirns zu bauen, ist im Grunde eine Allmachtsfantasie«, denkt er. Und damit dann herauszufinden, wie psychiatrische Erkrankungen entstehen, hält er für völlig realitätsfern. Er kritisiert, dass auf diese Art »bombastische Erwartungshaltungen« geweckt wurden: »Irgendwann werden uns Angehörige von Alzheimer- oder Schizophreniepatienten fragen, wann wir endlich liefern.«
»Die Idee, von molekularer Ebene ausgehend ein Abbild des Gehirns zu bauen, ist im Grunde eine Allmachtsfantasie«Andreas Draguhn, Mediziner
Herz ist überzeugt: Den Verantwortlichen war durchaus bewusst, unrealistische Zusagen gemacht zu haben. Aber man wollte das Projekt gegenüber den Geldgebern möglichst gut verkaufen. »Das offizielle Ziel – eine umfassende Simulation des Gehirns – war ein großer Fehler«, glaubt er. »Modelle leben davon, unwichtige Aspekte wegzulassen und sich auf die relevanten zu konzentrieren.« Die Vision einer »Eins-zu-eins-Kopie« des Denkorgans sei also mit dem naturwissenschaftlichen Konzept eines Modells überhaupt nicht vereinbar.
Der Abschlussbericht des Schlichtungsverfahrens gab den Kritikern um Pouget in der Sache Recht: Die Versprechungen von Henry Markram und seinen Mitstreitern waren zu hoch, was zu einem Verlust an Glaubwürdigkeit geführt habe. Entscheidungen seien zudem nicht transparent gewesen, und man brauche die kognitiven Neurowissenschaften. Eine Konsequenz war, dass Markram als wissenschaftlicher Leiter nicht wiedergewählt wurde. Katrin Amunts, Professorin für Hirnforschung an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Direktorin des Instituts für Neurowissenschaften und Medizin am Forschungszentrum Jülich, trat 2016 seine Nachfolge an.
»Die Transparenz hat sich verbessert, die administrativen Strukturen wurden umgestellt, es gab eine neue Führungsmannschaft«, äußert Draguhn rückblickend. Das alles habe dazu beigetragen, das HBP »seriöser aufzustellen«. Herz glaubt ebenfalls, dass man sich sehr um Verbesserungen bemüht und einige sinnvolle strategische und strukturelle Änderungen vorgenommen habe. Und die Grundidee des Projekts, nämlich eine riesige Menge an Daten über das Gehirn zu sammeln, zu ordnen und verfügbar zu machen, bewerten sowohl Draguhn als auch Herz uneingeschränkt positiv.
Videoanruf bei Katrin Amunts, die die Wogen schon in der Anfangsphase des Projekts glätten musste: Sie bestätigt, dass der Fokus anfangs besonders auf dem Bottom-up-Ansatz gelegen hätte, also hochdetaillierten Neuronenmodellen. »Das wurde sehr in den Mittelpunkt gerückt«, sagt sie, »von der damaligen Projektführung und auch von den Medien«. Schnell habe man aber begriffen: »Um die Komplexität des Gehirns zu erfassen, braucht es viele unterschiedliche Vorgehensweisen. Man kann sich nicht nur auf die Simulation beschränken«, so Amunts. Eine solche habe immer eine spezifische Fragestellung und sei per se eine starke Vereinfachung eines Aspekts, beispielsweise der Weiterleitung von Reizen von einer Nervenzelle zur anderen. »Das kann man modellieren. Aber sagt uns das alles über das Gehirn? Nein, ganz sicher nicht.«
Die anfängliche Kritik habe man als Chance begriffen, die Ausrichtung neu zu denken. »Das Erste, was wir gemacht haben, war eine Ausschreibung für Kognitionswissenschaftler.« Vier Arbeitsgruppen seien hinzugekommen. »Die waren Gold wert«, resümiert Amunts. Und die Simulation hätte man nun als Bestandteil eines ganzen Instrumentariums verstanden: »Nur mit einem einzigen Werkzeug lässt sich auch kein Haus bauen«, veranschaulicht sie die Situation.
Man musste Brücken schlagen
Das Gehirn ist auf mehreren räumlichen und zeitlichen Ebenen organisiert. Über Moleküle und elektrische Signale kommunizieren Neurone miteinander. Diese wiederum bilden kleinere und größere Netzwerke, die verschiedene Regionen des Gehirns verbinden. Schließlich müssen diverse Bereiche zusammenarbeiten, um komplexe Funktionen wie Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Lernen, Denken, Entscheidungsfindung und Sprache zu ermöglichen. Dabei sind vollkommen unterschiedliche Zeiträume relevant. Während sich etwa die sinnliche Wahrnehmung im Bereich weniger Millisekunden abspielt, wird die dazugehörige Gedächtnisspur mitunter für viele Jahrzehnte angelegt. »Für ein umfassendes Verständnis des Gehirns müssen wir eine Brücke schlagen zwischen den vielen räumlichen und zeitlichen Ebenen«, empfiehlt Amunts.
Zu diesem Zweck gelte es auch, zwischen Arbeitsgruppen und Disziplinen Brücken zu bauen. Denn man benötige eine Vielzahl von Methoden: Bildgebung, Datenanalysen, Landkarten des Gehirns, experimentelle Verfahren zum Messen von Hirnströmen und Nervenzellaktivitäten, künstliche Intelligenz, aber eben auch Simulationen und Modellierungen. Das Projekt sei daher deutlich vielseitiger geworden. »Es hat all diejenigen Wissenschaftler unter einem Dach zusammengeführt, die die Verbindung zwischen Hirnstruktur und -funktion verstehen wollen«, merkt Amunts an. Dazu zählt sie Neuro- und Kognitionsforscher, Mediziner, Ingenieure, Informatiker und Physiker. »Wir haben eine gemeinsame Sprache gefunden.« Die Fragmentierung der Hirnforschung sei dadurch in vielerlei Hinsicht überwunden worden. »Das hat die Möglichkeit inter- disziplinärer Zusammenarbeit massiv befördert«, betont sie.
Viktor Jirsa, einer der leitenden Wissenschaftler des HBP und Direktor des Institut de Neurosciences des Systèmes in Marseille, äußert sich ähnlich: »Das Human Brain Project hat großen Wert auf Fortschritt durch Integration gelegt – insbesondere darauf, Daten, Methoden und Modelle so anzupassen, dass sie sich nahtlos verbinden lassen.« Im Hinblick darauf sei das Projekt einzigartig. Aber was hat man denn nun konkret erreicht? Amunts fallen hier etliche Dinge ein (siehe »Meilensteine des HBP«). Gemeinsam mit ihrem Team in Jülich und Düsseldorf hat sie beispielsweise einen detaillierten und umfangreichen Hirnatlas entwickelt. »Man kann sich das als eine Art Google Maps für das Gehirn vorstellen«, erklärt sie. Die Karte integriert viele unterschiedliche Informationen: funktionelle, molekulare und genetische Daten. »Damit werden Dinge vergleichbar, die vorher nicht vergleichbar waren«, sagt Amunts. »Wir haben mit dem Atlas eine langfristige Ressource für die gesamte neurowissenschaftliche Community geschaffen.« Schon heute nutzen ihn etwa Ärztinnen und Ärzte, um die Hirnaufnahmen ihrer Patienten besser zu interpretieren.
Direkter Nutzen für Patienten
Dass solche digitalen Werkzeuge tatsächlich einen klinischen Wert haben können, zeigt Viktor Jirsas Forschung. Mit seinem Team entwickelt er das Computerprogramm The Virtual Brain, welches die Aktivität in einem individuellen Gehirn vorhersagt. In Zusammenarbeit mit dem Neurologen Fabrice Bartolomei wandte Jirsa das Modell auf Epilepsiepatienten an, um bei ihnen die Ausbreitung und die Herde der Anfälle zu bestimmen. »Der Erfolg einer Operation hängt davon ab, wie präzise diese Bereiche lokalisiert werden können. In der Praxis erweist sich das oft als sehr schwierig«, erklärt Jirsa. Daher liege die durchschnittliche Erfolgsquote bei chirurgischen Eingriffen, bei denen der Anfallsherd entfernt werden soll, nach wie vor bei nur etwa 60 Prozent. »Jede Verbesserung hätte für viele Patienten große Auswirkungen«, glaubt Jirsa. In einer klinischen Studie wird momentan getestet, inwiefern das Programm den Neurochirurgen helfen kann. »Die harmonische Verknüpfung von Daten über Modellierung und zurück zum Patienten ist beim HBP meiner Meinung nach einzigartig«, sagt Jirsa.
Sowohl Amunts' Hirnatlas als auch The Virtual Brain stehen bereits auf der Plattform EBRAINS zur Verfügung. Diese bietet außerdem Zugang zu High Performance Computing, um die mitunter riesigen Datenmengen zu verwalten und zu bearbeiten. »Supercomputer stehen nicht in jedem Labor zur Verfügung«, erklärt Amunts. Dafür habe das HBP erreicht, dass sich fünf auf dem Gebiet führende Institute in Europa zusammengeschlossen haben: »So können besonders rechenintensive Probleme von überall aus gelöst werden.«
Draguhn hofft, dass sich EBRAINS zu einer wertvollen Plattform entwickelt, die ein professionelles Datenmanagement und umfangreichen Austausch ermöglicht: »So etwas ist längst überfällig.« Herz lobt den Versuch, die enorme Wissensmenge zu strukturieren und aufzubereiten: »Die dröge Archivarbeit anzugehen ist eine großartige Idee.« In den Neurowissenschaften bekomme man die größten Lorbeeren für die Entdeckung von etwas Neuem, etwas Unerwartetem. »Im Prinzip ist das HBP die Gegenthese dazu.«
Positiv sei außerdem, dass auf diese Weise die Reproduzierbarkeit von Daten thematisiert wurde. Das komme in dem Forschungsbereich viel zu kurz, kritisiert Herz. »Ich wage zu behaupten, dass die wenigsten Experimente in den Neurowissenschaften den strikten Vorgaben der Statistik folgen, wie Hypothesen zu testen sind.« Diesbezüglich habe er sich allerdings eine noch deutlichere Rolle des HBP gewünscht. »Man hätte ein Regelwerk entwickeln können, um Experimente in der Hirnforschung besser und wiederholbar zu konzipieren und zu dokumentieren.« Das sei aber nicht ausreichend passiert.
Auch habe man die grundlegenden Fragen der Hirnforschung zu wenig diskutiert, glauben sowohl Herz als auch Draguhn. »Was meinen wir genau mit einem Verständnis des Gehirns? Welche Ansätze und Modelle gibt es, und was ist ihr Geltungsanspruch?«, fragt Draguhn. Es fehle immer noch ein Konzept davon, was überhaupt erklärt werden soll. Und Herz sagt: »Der Neurowissenschaft mangelt es an einer umfassenden Theorie, die dann experimentell getestet werden könnte.« Für Draguhn stellt sich daher die Frage, ob es nicht sinnvollere Wege gäbe als ein Großprojekt wie das HBP: »Wenn die Situation so unübersichtlich ist, dann brauchen wir eben keinen Totalerklärungsansatz, sondern sollten kleinere Projekte finanzieren«, empfiehlt er.
Kritiker des Human Brain Project wie etwa Alexandre Pouget haben das International Brain Laboratory, kurz IBL, ins Leben gerufen. Daran sind 22 Forschungsgruppen aus fünf Ländern beteiligt. Ähnlich wie beim HBP will man eine Vergleichbarkeit schaffen, wie es auf der Website heißt: »Viele von uns waren frustriert über die fehlende Standardisierung in der Neurowissenschaft, die einen Vergleich unserer Ergebnisse sehr schwierig macht – selbst mit Laboren, die ganz ähnliche Arbeiten durchführen.«
»Open Source allein reicht nicht«
Langfristig wolle man IBL zu »einem offenen Standard machen«. Die Plattform fokussiert sich bewusst auf einen Prozess im Gehirn, nämlich, wie dieses Entscheidungen trifft. Das sei eine elementare Funktion. Die Vision ist »ein Kollektiv, das auf demokratische Weise auf ein gemeinsames wissenschaftliches Ziel hinarbeitet«. Im Gegensatz zum HBP gibt es nur ein Minimum an Kontrolle von oben und so wenig Bürokratie wie möglich. Unter anderem die experimentelle Software sei als Open Source verfügbar, und man ermutige alle, sie zu nutzen und zum Projekt beizutragen, heißt es weiter.
Jirsa begrüßt diesen offenen Ansatz in der Forschung, weil er die Hirnforschung voranbringen kann. »Das ermöglicht den Austausch zwischen Wissenschaftlern, Instituten und Industriepartnern«, sagt er. Langfristig helfe das allen Beteiligten – auch wenn es in der Anfangsphase länger dauert. Doch der Physiker betont: »Open Source allein reicht nicht aus, und es braucht einen gewissen Grad an Koordination. Und das zeichnet das HBP aus.« Für den Erfolg seiner eigenen Arbeit sei genau diese Struktur von entscheidender Bedeutung gewesen.
Andreas Herz glaubt, dass die Forschung Einzelner tatsächlich vom Human Brain Project sehr profitiert hat – aber: »Es ist kläglich daran gescheitert, die breite Masse der Neurowissenschaftler zu erreichen.« Im Vorfeld des Gesprächs mit »Spektrum.de« hat er sich mit Fachkolleginnen und -kollegen über den Einfluss des HBP auf ihre Arbeit ausgetauscht: »Für mehr als die Hälfte hat es keinerlei Veränderung gebracht, es ist an ihnen schlichtweg vorbeigegangen.« Grundsätzlich ist das nicht überraschend – von keinem Vorhaben der Welt profitieren jemals alle in einem Forschungsfeld. Für Herz besteht jedoch folgendes Problem: »Ein solches Projekt bindet umfangreiche Ressourcen, die nur einem Teil der Community zugutekommen.« Geldgeber seien der Meinung gewesen, die theoretische Hirnforschung wäre durch das HBP gut abgedeckt. Das erschwerte es vor allem kleineren Gruppen, deren Forschung nicht zu dem Großprojekt gepasst habe, finanzielle Mittel einzuwerben. Doch der wissenschaftliche Output des HBP sollte »überschaubar ausfallen«: etwa 2000 Publikationen in zehn Jahren von rund 500 Fachleuten. »Für jeden Beteiligten im Schnitt eine Publikation alle zweieinhalb Jahre. Ist das eine Erfolgsgeschichte?«, fragt Herz.
»Es ist nicht so, dass das Projekt sinnlos gewesen wäre oder nichts hervorgebracht hätte. Aber die Diskrepanz zwischen den Erwartungen und dem, was man letztlich realisiert hat, ist schon sehr groß«, kritisiert Draguhn. Für Amunts dagegen hat das HBP »Pionierarbeit geleistet«: Das breite Spektrum von Grundlagenforschung, Computing und medizinischen Anwendungen zusammenzuführen – das habe die Wissenschaftslandschaft nachhaltig verändert. »Es war ein mutiger Schritt von der EU, solch ein Flagship-Projekt zu fördern. Ich denke, es war der richtige Weg. Wir wären ohne es in der Hirnforschung nicht da, wo wir heute sind.«
Über die Errungenschaften und den Wert des HBP herrscht in der Forschungsgemeinde also keine Einigkeit. Das machte sich auch bei Interviewanfragen bemerkbar: Die Reaktionen reichten von »keine namentliche Nennung im Artikel« bis hin zu »keine Stellungnahme zu diesem Thema«. Unter der Hand gibt es vernichtende Urteile, darunter: Es sei von Anfang an klar gewesen, dass das Projekt nur eine riesige Menge an Geld verschwenden werde. Das liegt auch an den übertriebenen Versprechungen, die gemacht wurden. Denn natürlich muss sich ein Projekt an diesen messen lassen – selbst wenn die Verantwortlichen sie rückblickend ebenfalls kritisch sehen. Wie eingangs erwähnt: Mit Visionen ist es eben so eine Sache.
Meilensteine des HBP
Detaillierter Hirnatlas
Den bislang umfangreichsten Atlas des menschlichen Gehirns hat ein Team vom Forschungszentrum Jülich erstellt. Er enthält Karten von vielen verschiedenen Hirnarealen und zeigt die zelluläre Architektur im Dreidimensionalen. Die Datenmengen zu organisieren, erfordert Supercomputer und künstliche Intelligenz. Auf der Plattform EBRAINS ist der Atlas offen zugänglich. Die Kartensammlung wird außerdem permanent mit neuen Daten erweitert.
Amunts, K. et al.: Julich-Brain: A 3D probabilistic atlas of the human brain’s cytoarchitecture. Science 369, 2020
Subzellulärer Blick ins Gehirn
Experten aus Deutschland, Italien und Großbritannien haben hochauflösende Methoden entwickelt, um Mäusehirne auf subzellulärer Ebene abzubilden. Zudem gelang es ihnen, das Konnektom – die Gesamtheit der Verbindungen im Nervensystem – verschiedener Tierarten in hoher Auflösung darzustellen und zu vergleichen. Selbstlernende Algorithmen, die auf Supercomputern laufen, analysieren die riesigen Mengen an Daten.
Schiffer, C. et al.: Convolutional neural networks for cytoarchitectonic brain mapping at large scale. Neuroimage 240, 2021
Stacho, M. et al.: A cortex-like canonical circuit in the avian forebrain. Science 369, 2020
Silvestri, L. et al.: Universal autofocus for quantitative volumetric microscopy of whole mouse brains. Nature Methods 18, 2021
Verbesserte Epilepsie-Chirurgie
Schlagen Medikamente bei Epilepsie nicht an, gibt es die Option, den Anfallsherd chirurgisch zu entfernen. Dazu muss dieser aber genau lokalisiert werden. Ein Forschungsteam aus Frankreich ist nun in der Lage, individuelle Modelle vom Gehirn zu erstellen, um die betroffenen Bereiche exakt zu identifizieren. Derzeit läuft eine klinische Studie mit 400 Patienten, um Chirurgen ein präzises Werkzeug an die Hand zu geben, das ihnen hilft, individuelle Entscheidungen zu treffen und die Ergebnisse zu verbessern. Der EBRAINS-Atlas dient dazu, die Genauigkeit weiter zu erhöhen.
Wang, H. E. et al.: Delineating epileptogenic networks using brain imaging data and personalized modeling in drug-resistant epilepsy. Science Translational Medicine 15, 2023
Roboter mit menschenähnlichen Fähigkeiten
Eine Forschergruppe aus Spanien stattete einen Roboter mit einer Simulation des Kleinhirns aus – eines Hirnteils, der an der motorischen Kontrolle beteiligt ist. Das System kann sich präziser bewegen und besser auf Unvorhersehbares reagieren als vorherige Entwicklungen. Damit ist der Roboter prädestiniert dafür, mit Menschen zu interagieren. Forscherinnen und Forscher aus den Niederlanden und Großbritannien haben außerdem die EBRAINS Neurorobotics Platform genutzt, um ihren Robotern beizubringen, wie sie sich Orte merken und ihre Navigation verbessern können.
Abadía, I. et al.: A cerebellar-based solution to the nondeterministic time delay problem in robotic control. Science Robotics 6, 2021
Pearson, M. et al.: Multimodal representation learning for place recognition using deep Hebbian predictive coding. Frontiers in Robotics and AI 8, 2021
Bewusstsein messen
Nach Hirnverletzungen ist es oft schwer festzustellen, ob die Betroffenen noch bei Bewusstsein sind. Fachleute aus Italien und Belgien haben eine Methode entwickelt, mit der sich der Bewusstseinszustand mit noch nie da gewesener Empfindlichkeit ermitteln lässt. Dabei wird das Gehirn von außen magnetisch stimuliert und seine Reaktion mit einem Elektroenzephalogramm (EEG) gemessen. Anhand des EEG-Musters lassen sich Rückschlüsse auf den Bewusstseinszustand ziehen.
Lutkenhoff, E. S. et al.: Subcortical atrophy correlates with the perturbational complexity index in patients with disorders of consciousness. Brain Stimulation 13, 2020
Energieeffizientere KI
In puncto Energieverbrauch ist das Gehirn den künstlichen neuronalen Netzen heutiger KIs haushoch überlegen. Ein Team aus Österreich, Deutschland und der Schweiz ließ sich von der Arbeitsweise des menschlichen Denkorgans inspirieren, um KI-Algorithmen energieeffizienter zu gestalten als die herkömmlichen Deep-Learning-Ansätze. Die daraus resultierenden künstlichen neuronalen Netze wurden in zwei Systemen eingesetzt, die im Rahmen von HBP entwickelt wurden und auf der Plattform EBRAINS frei zugänglich sind.
Bellec, G. et al.: A solution to the learning dilemma for recurrent networks of spiking neurons. Nature Communications 11, 2020
Cramer, B. et al.: Control of criticality and computation in spiking neuromorphic networks with plasticity. Nature Communications 11, 2020
Göltz, J. et al.: Fast and energy-efficient neuromorphic deep learning with first-spike times. Nature Machine Intelligence 3, 2021
Neuronale Implantate für Blinde und Querschnittsgelähmte
Ein Hirnimplantat, das blinden Menschen künftig beim Sehen helfen könnte, wurde von einer niederländischen Forschergruppe entwickelt. Das Bauteil stimuliert die Sehrinde mit winzigen Stromimpulsen. Bei Affen konnte damit schon erfolgreich eine visuelle Wahrnehmung hervorgerufen werden. Ein erster Test an einer blinden Frau versetzte sie in die Lage, ansatzweise Formen zu sehen. In der Schweiz setzten Fachleute neuronale Implantate ein, die das Rückenmark stimulieren, um Querschnittsgelähmten das Gehen zu ermöglichen. In ersten Versuchen erlangten die Probanden die willentliche Kontrolle über zuvor gelähmte Muskeln wieder und konnten während der Stimulation gehen oder Rad fahren.
Chen, X. et al.: Shape perception via a high-channel-count neuroprosthesis in monkey visual cortex. Science 370, 2020
Fernandez, E. et al.: Visual percepts evoked with an intracortical 96-channel microelectrode array inserted in human occipital cortex. The Journal of Clinical Investigation 131, 2021
Wagner, F. et al.: Targeted neurotechnology restores walking in humans with spinal cord injury. Nature 563, 2018
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.