Tensornetzwerke: Sind klassische Rechner Quantencomputern nun doch überlegen?
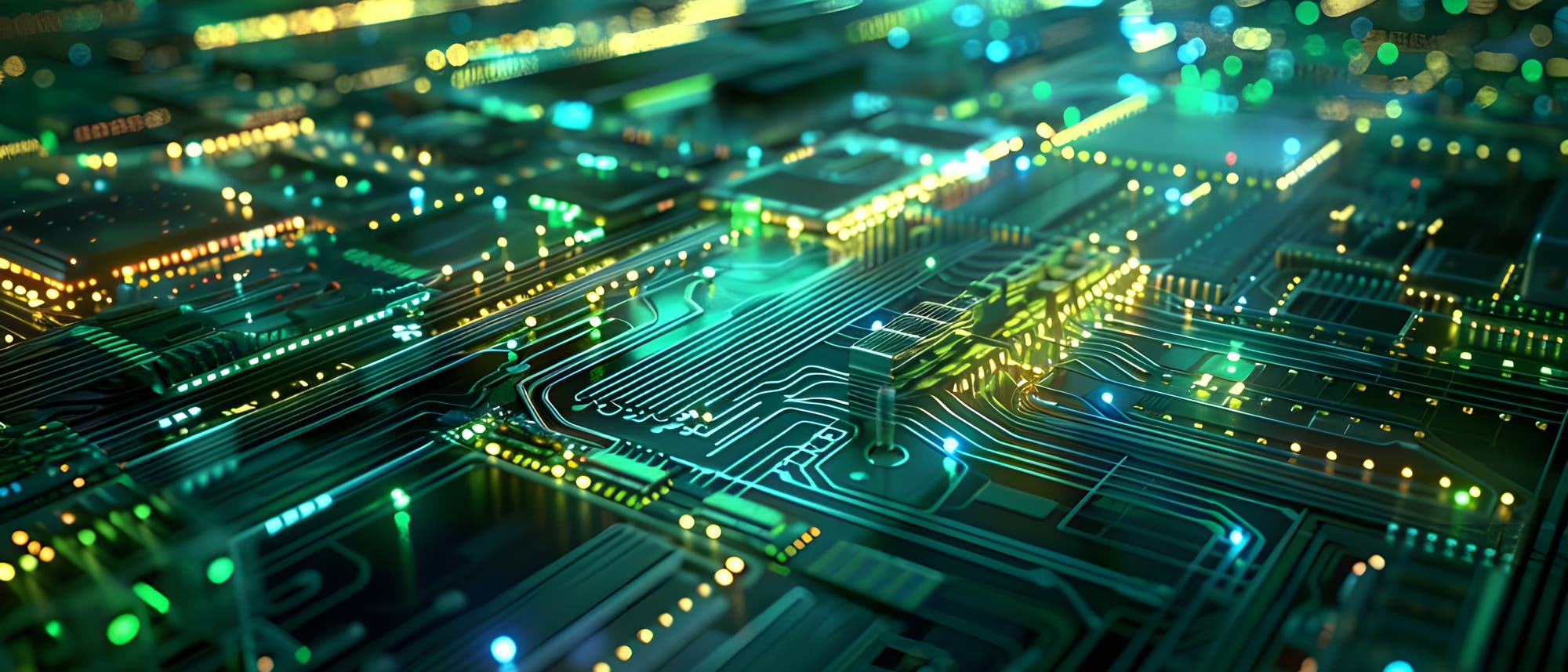
Am 23. Oktober 2019 überraschte eine vollmundige Ankündigung von Google die Fachwelt: Die US-amerikanische Techfirma gab bekannt, einen Meilenstein beim Quantencomputing erreicht zu haben, der als Quantenvorteil bekannt ist. Zum ersten Mal sollte ein Quantencomputer einen klassischen Rechner bei der Lösung einer Aufgabe geschlagen haben.
Aus experimenteller Sicht hat das Team um John Martinis eine unbestreitbare Meisterleistung vollbracht. Die Forschenden hatten einen Quantencomputer mit 53 supraleitenden Qubits entwickelt, die sie mit Hilfe einer innovativen Mikrowellentechnik steuerten. Mit diesem Gerät waren sie erstmals in der Lage, ein mathematisches Problem zu lösen, das »random quantum circuit sampling« – eine Aufgabe ohne jeden praktischen Nutzen. Allerdings scheitern herkömmliche Computer in der Regel daran. Das US-amerikanische Unternehmen schätzte, dass der damals leistungsstärkste Supercomputer 100 000 Jahre rechnen müsste, um das Problem zu lösen. Der Google-Quantencomputer Sycamore brauchte nur 200 Sekunden.
Ein solcher Quantenvorteil ist möglicherweise ein Vorbote für das Potenzial künftiger Quantencomputer, die auch reale Probleme bewältigen könnten, wie sie etwa bei der medizinischen Wirkstoffentwicklung oder der Fertigung neuer Materialien auftauchen. So zumindest die Hoffnung.
Googles Ankündigung stieß schnell auf Kritik. Hatte die US-Firma wirklich einen Quantenvorteil erreicht? Bereits im folgenden Jahr rechneten mehrere Forschergruppen das Ergebnis mit klassischen Computern nach. Googles Befund ließ sich in wenigen Minuten mit einem Supercomputer replizieren – und zwar ohne die hohe Fehlerquote eines Quantencomputers. Mehr noch: Als Yiqing Zhou und Miles Stoudenmire vom Flatiron Institute in New York und Xavier Waintal von der CEA in Grenoble ihren Algorithmen die gleiche Fehlerrate erlaubten, wie sie beim Sycamore-Quantenprozessor auftritt, ließ sich die Berechnung auf einem einfachen Desktop-Computer ausführen.
Der Schlüssel für diesen ungeahnten Erfolg klassischer Computer steckt in einer bestimmten Form von Algorithmen, die als Tensornetzwerke bezeichnet werden. Diese machen Quantencomputern ernsthafte Konkurrenz, gerade wenn es um symbolische Probleme wie das »random quantum circuit sampling« geht. Doch der eigentliche Kampf wird nicht beim Quantenvorteil ausgetragen. Auf dem Gebiet geht es um wesentlich mehr als ein paar nutzlose Aufgaben. Vielmehr sind die Forschenden an der Lösung eines 100 Jahre alten und überaus hartnäckigen Rätsels interessiert: des quantenmechanischen N-Körper-Problems.
Ein Haufen unlösbarer Gleichungen
Dieses tritt auf, sobald man Quantensysteme mit vielen Teilchen untersucht. Auch wenn es bislang keine endgültige physikalische Theorie – eine Art Weltformel – gibt, lassen sich im Prinzip alle aktuell durchführbaren Experimente der Teilchenphysik hervorragend durch die Quantentheorie beschreiben. Daher sollte es zumindest theoretisch möglich sein, die Eigenschaften eines jeden Moleküls oder Materials zu berechnen – ausgehend von den Gleichungen der Quantenphysik, die sich leicht aufschreiben lassen.
Es gibt allerdings einen Haken. Die Gleichungen lassen sich in fast allen interessanten Situationen nicht lösen. Grund dafür ist, dass die Anzahl der Parameter bei einem System aus N Quantenteilchen exponentiell mit N wächst.
Selbst mit allen Computern und Supercomputern der Welt wäre es unmöglich, auch nur die Koeffizienten der Wellenfunktion von 100 Teilchen zu speichern
Abgesehen von einfachsten Fällen, etwa einem einzelnen Wasserstoffatom im Vakuum, sind bei relevanten physikalischen Phänomenen zahlreiche miteinander wechselwirkende Quantenteilchen beteiligt, zum Beispiel die Elektronen in einem komplexen Molekül, die seine chemischen Eigenschaften bestimmen. Selbst mit allen Computern und Supercomputern der Welt wäre es unmöglich, auch nur die Koeffizienten der Wellenfunktion von 100 Teilchen zu speichern. Erst recht ist es undenkbar, mit dieser Wellenfunktion Berechnungen anzustellen. Somit sind Vielteilchen-Quantensysteme aus theoretischer Sicht vollkommen unzugänglich. Das ist als quantenmechanisches N-Körper-Problem bekannt.
In der Praxis ist man gezwungen, entweder Näherungsverfahren zu nutzen (die allerdings nicht immer genau genug sind) oder die interessanten Eigenschaften direkt durch ein Experiment zu bestimmen. Das quantenmechanische N-Körper-Problem hindert Physiker daran, Fragen zu beantworten, die den Weg für nützliche Anwendungen ebnen könnten. Damit ist es – zumindest aus praktischer Sicht – eine viel größere Herausforderung als die Suche nach einer Weltformel.
Die Fachleute wurden sich des Problems erstmals im Jahr 1929 bewusst, als Paul Dirac eine bahnbrechende Arbeit zur Quantenchemie veröffentlichte. Mit der damals entwickelten Quantenmechanik schien es auf den ersten Blick möglich, chemische Reaktionen genau zu beschreiben. Doch Dirac stellte fest, dass die Anzahl der beteiligten Variablen riesig ist und man daher Näherungsverfahren bräuchte, um konkrete Ergebnisse zu berechnen.
Seitdem haben theoretische Physikerinnen und Physiker zahlreiche Methoden entwickelt, um sich den Lösungen des quantenmechanischen N-Körper-Problems zu nähern. In der Chemie ermöglicht es beispielsweise die Dichtefunktionaltheorie (DFT), die Eigenschaften einfacher Moleküle vorherzusagen. Und in der Festkörperphysik lassen sich die elektrischen Merkmale vieler Materialien durch die dynamische Molekularfeldtheorie (DMFT) verstehen.
Trotz dieser Fortschritte ist ein Großteil des quantenmechanischen N-Körper-Problems unzugänglich. Das gilt insbesondere für »stark korrelierte« Systeme, bei denen die Quantenteilchen verschränkt sind. Verschränkung ist eine Quanteneigenschaft, die Teilchen selbst über große Distanzen hinweg miteinander verbindet. Dadurch lassen diese sich nicht mehr einzeln charakterisieren. Man kann die Teilchen dann nur durch eine gemeinsame Wellenfunktion beschreiben. In der Kernphysik, bei Hochtemperatur-Supraleitern oder bei der Untersuchung von Katalysatoren trifft man meist auf stark korrelierte Systeme.
Quanten simulieren Quanten
Quantencomputer und Tensornetzwerke reihen sich als zwei neuere Ideen in die lange Tradition der Lösungsansätze für das quantenmechanische N-Körper-Problem ein. Der Ansatz hinter Quantencomputern besteht darin, die Quantenmechanik zu nutzen, um ein Quantensystem zu simulieren. Richard Feynman äußerte als Erster die Vorstellung eines Quantensimulators, bei dem ein zu untersuchendes System mit Hilfe eines leicht konfigurierbaren Analogons modelliert wird. Beispielsweise kann man Atome nutzen, die auf einem zweidimensionalen Gitter gefangen sind und sich präzise steuern lassen, um ein kompliziertes Material nachzuahmen.
Ein Quantencomputer ist eine Verfeinerung dieser Idee: Man ersetzt das analoge System durch eine digitale Version, die mit Quantenbits rechnet, so genannten Qubits. Das hat den Vorteil, dass sich mit solchen Geräten eine beliebige Genauigkeit erreichen ließe, wenn man gleichzeitig Fehler durch entsprechende Codes korrigiert. Quantencomputer sind somit – zumindest theoretisch – genauso verlässlich wie klassische Computer und leiden nicht unter den Schwächen von analogen Rechnern, deren Genauigkeit begrenzt ist.
Die Begeisterung für Quantencomputer kam 1994 richtig in Gang, als der US-amerikanische Mathematiker Peter Shor einen Quantenalgorithmus vorstellte, der beliebig große Zahlen in ihre Primteiler zerlegt. Diese Berechnung kann kein bekannter klassischer Algorithmus durchführen. Shors Ergebnis stellt damit eine reale Bedrohung für viele der heute verwendeten Verschlüsselungen dar, denn diese stützen sich auf Probleme, die sehr schwierig zu berechnen sind – darunter die Primfaktorzerlegung.
Dieses unerwartete Potenzial im Hinblick auf die Lösung eines mathematischen Problems, das keinerlei Bezug zur Quantenmechanik hat, ließ Hoffnungen aufkommen auf weitere Anwendungen von Quantencomputern außerhalb der Physik. Doch diese sind bisher nicht besonders zahlreich. Am vielversprechendsten ist noch immer die Lösung des quantenmechanischen N-Körper-Problems.
Die Wellenfunktion komprimieren
Während Quantencomputer eine hardwareseitige Lösung für das Problem bieten, arbeiten Tensornetzwerke auf Softwareebene. Die Idee hinter den Algorithmen besteht darin, die Wellenfunktion eines Teilchensystems zu komprimieren, also die Anzahl der Parameter zu reduzieren, um sie auf einem gewöhnlichen Computer zu speichern. Tensornetzwerke sind somit für die Quantenmechanik das, was das JPEG für Bilder ist: ein Mittel, um eine Darstellung zu komprimieren – und zwar so, dass die Qualität darunter möglichst wenig leidet.
Allerdings muss man dabei im Hinterkopf behalten, dass es keine magische Kompression gibt. Jedes solcher Verfahren nutzt eine Struktur, die den zu verarbeitenden Daten zu Grunde liegt. Ein Bild aus zufälligen Pixeln lässt sich zum Beispiel nicht komprimieren. Die einzige Lösung besteht darin, den Wert jedes einzelnen Pixels zu speichern. Das Bild einer Katze oder einer Landschaft ist hingegen völlig anders. So haben etwa nah beieinanderliegende Pixel oft die gleiche Farbe. Diese Struktur wird von Algorithmen wie demjenigen hinter dem JPEG-Format genutzt, um die Größe des Bilds zu reduzieren – auf minimale Kosten der Qualität.
Ähnlich ist es in der Quantenmechanik. Wenn die Wellenfunktion völlig zufällig ist, wie ein Bild aus unverwandten Pixeln, dann lässt sie sich nicht sparsam darstellen. In diesem Fall ist nur ein Quantencomputer in der Lage, sie zu verarbeiten. Damit ist klar, in welchen Bereichen ein Quantenvorteil erreichbar ist: nämlich dort, wo Kompression unmöglich ist.
Die entscheidende Frage ist also, ob die Wellenfunktionen, die in den interessanten Fällen des quantenmechanischen N-Körper-Problems auftreten, eine Struktur haben, die sie – zumindest prinzipiell – komprimierbar macht. Damit wäre für diese Fälle kein Quantencomputer zur Berechnung nötig. Und wie sich herausstellt, scheint das tatsächlich der Fall zu sein.
Erste Schritte in einer Dimension
1992 lieferte der Festkörperphysiker Steve White von der University of California in Irvine den ersten Ansatz für eine effiziente Kompression einer Wellenfunktion. Damals beschäftigte er sich mit dem Spezialfall des quantenmechanischen N-Körper-Problems in einer Raumdimension, bei dem die Bewegungen von Quantenteilchen auf eine Linie beschränkt sind. Dadurch lassen sich die zugehörigen Gleichungen vereinfachen und teilweise exakt lösen, so dass sich neue Ansätze besser prüfen lassen. Zudem versagen in eindimensionalen Fällen (1-D) Näherungsverfahren wie die Molekularfeldtheorie. 1-D ist somit die ideale Spielwiese, um neue Ideen zu testen.
Der von White entwickelte DMRG-Algorithmus (density matrix renormalization group) löste auf einen Schlag fast alle eindimensionalen quantenmechanischen N-Körper-Probleme. Für eine große Klasse von Gleichungen, welche die meisten interessanten Situationen umfassen, berechnet der Algorithmus den Zustand eines Vielteilchen-Quantensystems, ohne dafür einen Supercomputer zu benötigen. Das war eine Revolution. Denn dieses Problem schien bis dahin ohne Quantencomputer unlösbar.
Doch damals verstand niemand, warum Whites Algorithmus so effektiv ist
Der DMRG-Algorithmus ist äußerst effizient und reduziert das eindimensionale quantenmechanische N-Körper-Problem auf grundlegende Aufgaben der linearen Algebra, womit gewöhnliche Rechner gut umgehen können. Damals verstand allerdings niemand, warum Whites Algorithmus so effektiv ist.
Auf der anderen Seite des Atlantiks führten im selben Jahr die drei Mathematiker Mark Fannes, Bruno Nachtergaele und Reinhard Werner unabhängig von White eine neue Klasse von Quantenzuständen ein, so genannte Matrixproduktzustände (kurz MPS). Diese lassen sich durch sehr wenige Parameter beschreiben und sind daher leicht zu charakterisieren.
Mathematisch lässt sich die Wellenfunktion eines Quantenzustands aus N Teilchen durch einen Tensor mit N Indizes darstellen. Dabei handelt es sich um eine Verallgemeinerung von Matrizen (eine zweidimensionale Tabelle) in N-Dimensionen. Wenn jedes der N Teilchen d mögliche Zustände hat, dann enthält dieser Tensor dN Zahlen (was einer gigantischen Anzahl entspricht, wenn N groß ist). Fannes, Nachtergaele und Werner untersuchten besondere Wellenfunktionen, bei denen sich dieser Tensor mit N Indizes als Produkt von kleinen Matrizen schreiben lässt.
Es dauerte drei Jahre, bis die Fachwelt die Verbindung zwischen dem DMRG-Algorithmus und MPS verstand. 1995 zeigten die Physiker Stellan Östlund und Stefan Rommer von der schwedischen Chalmers University of Technology, dass der DMRG-Algorithmus von White die Quantenzustände durch eine MPS-Darstellung komprimiert.
Damit lösten die beiden Forscher einen Teil des Rätsels. Aber es blieb unklar, warum Tensornetzwerke so gut funktionieren. Warum lassen sich offenbar alle relevanten Quantensysteme durch Matrixproduktzustände darstellen?
Eine Verbindung zu Schwarzen Löchern
Anfang der 2000er Jahre vermuteten Fachleute, dass die Wellenfunktionen des quantenmechanischen N-Körper-Problems eine Eigenschaft besitzen, die sie nicht völlig zufällig – und damit komprimierbar – macht. Innerhalb der interessanten Wellenfunktionen scheint die Verschränkung einem Flächengesetz zu folgen.
Das quantenmechanische N-Körper-Problem hat auf den ersten Blick nichts mit der Schwerkraft zu tun, aber bei der Verschränkung lässt sich ein ähnliches Phänomen wie bei der Entropie Schwarzer Löcher beobachten
Der Begriff tauchte ursprünglich im Zusammenhang mit Schwarzen Löchern auf, als Jacob Bekenstein und Stephen Hawking herausfanden, dass die Entropie Schwarzer Löcher proportional zu ihrer Oberfläche ist – und nicht zu ihrem Volumen, wie es bei gewöhnlichen Objekten der Fall ist. Der Begriff Entropie bezeichnet eine Größe, die angibt, wie viele mögliche Zustände in einem System vorkommen können. Das quantenmechanische N-Körper-Problem hat auf den ersten Blick nichts mit der Schwerkraft zu tun, doch bei der Verschränkung lässt sich ein ähnliches Phänomen wie bei der Entropie Schwarzer Löcher beobachten.
Mehrere Quantenteilchen können mehr oder weniger stark miteinander verschränkt sein. Um die Stärke dieser Verbindung abzuschätzen, kann man das System in zwei Teile separieren und untersuchen, wie viele Verbindungen man dafür durchtrennen muss. Diese Zahl wird als Entropie der Verschränkung bezeichnet.
Bei einem zufälligen Quantenzustand sind die Teilchen willkürlich miteinander verschränkt, ungeachtet ihres Abstands zueinander. Wenn man also eine Teilmenge der Teilchen betrachtet, sind die meisten von ihnen auch mit Exemplaren außerhalb dieser Menge verbunden. In diesem Fall ist die Entropie der Verschränkung proportional zur Anzahl der Teilchen in der betrachteten Teilmenge – und damit zu ihrem Volumen. Das System erfüllt also ein Volumengesetz.
Aber in der Natur regiert nicht der Zufall. Eine Wellenfunktion, die ein physikalisches System beschreibt, gehorcht der Schrödingergleichung und besitzt somit eine gewisse Struktur. Wie sich zeigt, besitzt sie fast ausschließlich kurze Verbindungen. Wenn man das Quantensystem also wie zuvor teilt, dann sind meist nur Teilchen an den Rändern der Teilmenge mit dem Rest des Systems verknüpft. Die Entropie der Verschränkung ist proportional zur Oberfläche (in drei Dimensionen) oder zum Umfang (in zwei Dimensionen) der Teilmenge. Das System folgt demnach einem Flächengesetz.
2004 erkannten die Physiker Ignacio Cirac und Frank Verstraete, damals am Max-Planck-Institut für Quantenoptik in München, dass die eindimensionalen Tensornetzwerke von White das Flächengesetz erfüllen. Mehr noch: Wenn die Verschränkung eines eindimensionalen Teilchensystems schwach genug ist, um dem Flächengesetz zu gehorchen, dann liefern 1-D-Tensornetzwerke eine Kompression, deren Fehler sich beliebig klein einstellen lassen. 2007 vervollständigte Matthew Hastings, damals am Los Alamos National Laboratory, den formalen Beweis von Cirac und Verstraete, indem er zeigte, dass die interessanten 1-D-Quantensysteme tatsächlich das Flächengesetz erfüllen.
Bei solchen Aufgaben werden Tensornetzwerke den Wettstreit mit Quantencomputern verlieren. Bei vielen nützlichen Anwendungen steht der Sieger aber keineswegs fest
Das war ein unglaublicher Erfolg. Das eindimensionale quantenmechanische N-Körper-Problem schien jahrzehntelang vollkommen unerreichbar, und plötzlich verfügte man über einen leistungsfähigen Algorithmus, der es mit gewöhnlichen Rechnern lösen kann. Kein Quantencomputer nötig.
Doch in einer Dimension sind die Fähigkeiten der Kompression nicht grenzenlos. Wenn man einem System aus Quantenteilchen viel Energie zuführt (etwa indem man es aus seinem Gleichgewicht bringt), entstehen chaotische Dynamiken. Dadurch nimmt die Verschränkung unkontrolliert zu, das Flächengesetz versagt, und das System lässt sich nicht mehr komprimiert beschreiben. Genau in diesem Regime ist man auf Quantencomputer angewiesen. Und die Aufgaben zur Demonstration eines Quantenvorteils stützen sich auf derartige Situationen – ob die Berechnungen nun nützlich sind oder nicht. Die »random circuit samples«, die der Google-Quantencomputer simuliert, entsprechen Dynamiken, die ein Maximum an Verschränkung erzeugen. Bei solchen Aufgaben werden Tensornetzwerke eines Tages den Wettstreit mit Quantencomputern verlieren. Bei vielen nützlichen Anwendungen steht der Sieger dagegen keineswegs fest.
Über eine Dimension hinaus
Abgesehen von Ausnahmesituationen im Labor (wie bei Nanodrähten) sind Quantensysteme selten auf nur eine einzige Raumdimension beschränkt. Tensornetzwerke – so beeindruckend ihre Ergebnisse in einer Dimension auch sind – müssen sich also auch in höheren Dimensionen behaupten, um als Erfolg zu gelten. Falls sich der Ansatz nicht verallgemeinern lässt, bleibt die Methode auf die Untersuchung von einfachsten Modellen beschränkt.
Im Jahr 2004, als Cirac und Verstraete gerade herausgefunden hatten, was die eindimensionale Kompression ermöglicht, stellten sie eine weitere visionäre Arbeit ins Internet, die zuvor von Fachzeitschriften abgelehnt worden war. Darin schlugen sie eine Verallgemeinerung der Matrixproduktzustände von Fannes, Nachtergaele und Werner in höheren Dimensionen vor. Diese neuen Zustände lassen sich theoretisch auf alle interessanten physikalischen Probleme in zwei und drei Raumdimensionen anwenden. Die beiden Forscher hofften, schnell von der Theorie zu einem Algorithmus zu gelangen, der einen Großteil der praktischen quantenmechanischen N-Körper-Probleme lösen kann.
Allerdings stellten Experten schnell fest, dass die Tensornetzwerke von Cirac und Verstraete deutlich schwieriger zu verwenden sind als die eindimensionalen Matrixproduktzustände. Ihre Fähigkeit zur Kompression ist unstrittig: Man geht davon aus, dass sie mit wenigen Parametern die im quantenmechanischen N-Körper-Problem auftretenden Wellenfunktionen darstellen. In diesem Fall ist es jedoch viel schwieriger, Informationen aus der komprimierten Darstellung abzuleiten, als in einer Raumdimension.
2007 legten Cirac und Verstraete zusammen mit Norbert Schuch und Michael Wolf, damals ebenfalls am Max-Planck-Institut für Quantenoptik, ein ernüchterndes Ergebnis vor: Bei bestimmten 2-D- oder 3-D-Tensornetzwerken kann es schwieriger sein, die Darstellung zu dekomprimieren (was für Vorhersagen unerlässlich ist), als das N-Körper-Problem selbst zu lösen!
Ist das das Ende der Hoffnungen? Glücklicherweise nicht. Denn es ist nicht klar, ob die Tensornetzwerke, die beim Komprimieren der physikalischen Wellenfunktionen entstehen, zu der von den Forschern identifizierten Klasse gehören. Vielleicht sind die entstehenden Tensornetzwerke deutlich einfacher – und zumindest näherungsweise dekomprimierbar. Das zumindest versprechen sich die Fachleute und arbeiten daher weiter an diesem Ansatz.
Konkrete Ergebnisse mit Tensornetzwerken
Nach jahrelangen Bemühungen gelang es Forschenden, verschiedene Algorithmen zur Kompression und Dekompression von zwei- und dreidimensionalen Tensornetzwerken zu entwickeln, die an physikalische Wellenfunktionen angepasst sind. Diese Arbeiten gipfelten in der Anwendung der Methode auf das zweidimensionale Fermi-Hubbard-Modell: ein vereinfachtes Modell eines Hochtemperatur-Supraleiters. Der Algorithmus ist noch nicht genau genug, um die drängendsten Fragen zu diesen Systemen zu beantworten; das Ziel rückt nur allmählich näher.
Damit ist auch das quantenmechanische N-Körper-Problem einer Lösung fern. Trotz der bemerkenswerten Fortschritte der letzten Jahre benötigen 2-D- und 3-D-Tensornetzalgorithmen zu viel Rechenleistung für eine zufrieden stellende Genauigkeit bei physikalischen Problemen. Aktuell muss man sich noch mit einer stark verrauschten Kompression begnügen. Dennoch sind Tensornetzwerke in manchen Fällen die beste Methode, um überhaupt ein Ergebnis zu erhalten. In anderen Situationen haben etablierte Ansätze wie die DMFT oder die Monte-Carlo-Methode hingegen die Nase vorn.
Um die Kompression der Tensornetzwerke nutzen zu können, müsste man auf eine viel größere Anzahl von Parametern zugreifen. Deshalb werden die Komprimierungsalgorithmen weiter verbessert und massiv parallelisiert. Demnach könnten Tensornetzwerke am gleichen Punkt stehen, wo neuronale Netze kurz vor der Revolution der Grafikprozessoren standen: Das richtige theoretische Werkzeug ist da, doch die Technik fehlt.
Es könnte aber auch sein, dass der Methode von Cirac und Verstraete eine wichtige theoretische Zutat fehlt. Einige Fachleute haben bereits Erweiterungen des Ansatzes vorgeschlagen, etwa isometrische Tensornetze, die ein wenig der Allgemeingültigkeit opfern, um die Probleme berechenbar zu machen.
Während sich Physiker und Physikerinnen die Zähne an zwei- und dreidimensionalen Tensornetzwerken ausbeißen, haben die Algorithmen inzwischen ihren Weg in andere Anwendungen gefunden. Insbesondere werden sie bei KI-Modellen eingesetzt. Entweder als Ersatz für neuronale Netze: Tensornetzwerke sind interpretierbar und keine Blackbox. Oder sie dienen als Kompressionsmethode für bestehende neuronale Netze.
Aktuell könnten Tensornetzwerke sogar ihre Kontrahenten voranbringen. Die Algorithmen gestalten, in Quantenfehlerkorrekturcodes eingesetzt, die Berechnungen von Quantencomputern verlässlicher. Auch wenn es immer wieder Fortschritte bei Quantencomputern gibt, werden klassische Methoden wie Tensornetzwerke ebenfalls weiter verfeinert. Es ist noch nicht klar, wer als Sieger aus dem Rennen um die Lösung des quantenmechanischen N-Körper-Problems hervorgehen wird.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.