Sprachverarbeitung: Ein Hirn-Duden aus Nervenzellen
Schnell lesen kann nur, wer Wörter mit einem Blick erkennt. Wie das geht, fanden jetzt Forscher heraus: Sie taten ein Hirnareal auf, das für jedes häufig gelesene Wort mit einem eigenen Detektor aufwartet.
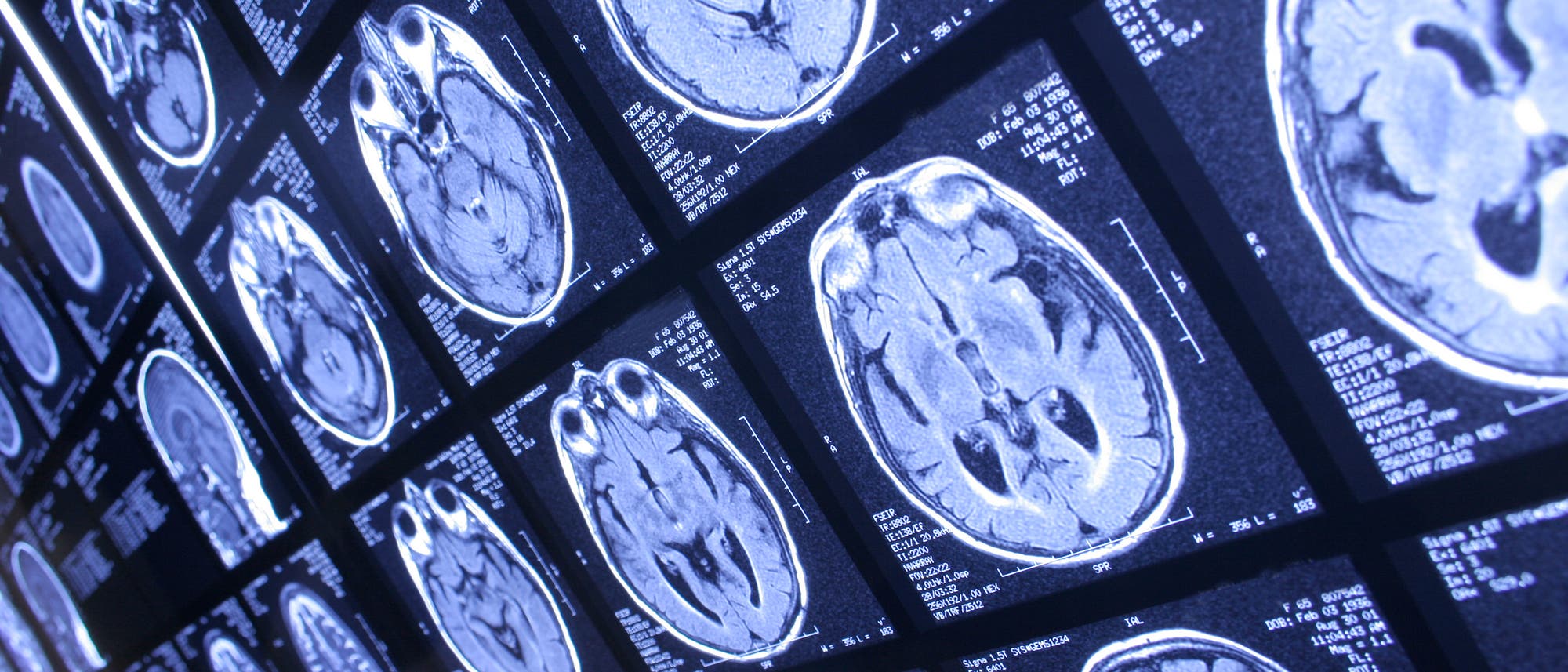
© iStockphoto / Jason Woodcock (Ausschnitt)
Es ist der Brückenschlag zwischen dem ganz Kleinen und dem ganz Großen, der Hirnforschern seit langem die meisten Sorgen bereitet: Das Verhalten einzelner Neuronen gilt als leidlich gut verstanden, und detaillierte Karten verzeichnen die Leistungen jeder Hirnregion. Doch wie arbeiten die Zellen in diesen Regionen eigentlich zusammen? Hier fehlt es oft am Grundverständnis.
Keine Ausnahme macht da jener Apparat des Hirns, der uns die Fähigkeit beschert, Texte zu lesen: Sein Aufbau ist schon länger bekannt, die Frage "Wie genau speichert das Gehirn Wörter ab?" aber gilt nach wie vor als hartes Problem. Nun fanden Wissenschaftler eine erste Antwort: Für jeden gelesenen Ausdruck hält das Gehirn eine Handvoll eigener Erkennungsneuronen bereit.
Psycholinguistische Studien hatten bereits die Existenz einer solchen Lexikon-Komponente vorausgesagt. Sie müsste sich um einzelne, komplette Begriffe kümmern und von erfundenen Pseudowörtern – also orthografisch korrekten, aber bedeutungslosen Buchstabenketten – unterscheiden. Gäbe es sie nicht, hätten wir beim Lesen mühsam jedes Wort aus dem Buchstabensalat herauszuklamüsern. Mit zunehmender Übung erkennen wir jedoch meist die Einheiten wie von selbst. Eines der am Leseprozess beteiligten Hirnareale haben Forscher deshalb bereits voll Zuversicht auf den Namen "visuelles Wortformenareal" getauft. Sitzt hier der neuronale Duden?
Wo schlägt das Hirn die Wörter nach?
Es liegt am Ende einer hierarchisch gegliederten Kette von Spezialbereichen, die sich vom oberhalb des Nackens gelegenen Sehzentrum in die untere, linke Hemisphäre zieht. Je weiter man ihr folgt, desto sprachbezogener werden die jeweils bewältigten Aufgaben. Anfangs stehen grafische Merkmale von Buchstaben im Mittelpunkt, dann die Erkennung der Lettern an sich und schließlich Buchstabenketten aus zwei, dann vier Zeichen. Die Kette endet in eben jenem visuellen Wortformenareal. Doch es wäre auch zu schön gewesen: Seine Funktion blieb rätselhaft. Forscher, die es im Hirnscanner untersuchten, erhielten nur unzusammenhängende Aktivitätsmuster als Antwort. In Frage kam deshalb eher eine Aufgabe in der Buchstabenverarbeitung unterhalb der Wortebene.
Forscher um Maximilian Riesenhuber von der Georgetown University in Washington wollen jetzt dennoch den Beweis erbracht haben: Das visuelle Wortformenareal sei genau das von den Psycholinguisten geforderte Wörterbuch im Hirn. Auch sie verwendeten Hirnscans mit der funktionellen Magnetresonanztomografie (fMRT), griffen bei der Erhebung der Daten aber zu einem Trick.
Für jeden Ausdruck, den wir gelernt haben, so die Forscher, gäbe es dort spezialisierte Neuronenverbände, die sich beim Lesen aktivieren. Die Misserfolge früherer Studien erklären sie mit der groben Auflösung des fMRT, die eigentlich klar abgrenzbare Nervenreaktionen über einen relativ großen Bereich innerhalb des Areals verschmiere.
Ein Trick mit dem Hirnscanner
Um dennoch die spezialisierten Zellpopulationen auszulesen, konzentrierten sie sich allein auf den Vergleich von Wortpaaren. Genauer gesagt setzten sie die Reaktionen auf ein Paar ähnlich aussehender Wörter wie "Wurm" vs. "Turm" mit der Reaktion auf ein Paar grundverschiedener Wörter ("Wurm" vs. "Haus") in Beziehung. Sie fanden keine signifikanten Unterschiede zwischen den Paarungen, egal ob die Wörter einander ähnlich sahen oder nicht. Die Forscher schließen also: Im visuellen Wortformenareal spielen orthografische Aspekte keine Rolle mehr, hier geht es nur um komplette Ausdrücke.
Erst als Riesenhuber und Kollegen Pseudowörter ins Spiel brachten, machten sich orthografische Ähnlichkeiten bemerkbar. So schaffte es ein Wort wie "Gurm" durchaus, Verbände wie "Turm" und "Wurm" zu aktivieren, allerdings nur deutlich schwächer, denn keiner der spezialisierten Detektoren sprang vollständig an. "Gurm" ist eben nicht im Duden verzeichnet – weder im gedruckten, noch im neuronalen.
Noch vor wenigen Jahren wären Wissenschaftler wenig geneigt gewesen, die Existenz solch simpler Detektoren außerhalb der einfachen Sinneswahrnehmung anzunehmen. Wörter schienen nach deutlich komplexeren Mechanismen zu verlangen. Auch dies vielleicht ein Grund dafür, dass die Suche nach der Funktion des Wortformenareals so lange ergebnislos blieb.
Nun will das Team um Riesenhuber mit seinen Befunden auch der Legasthenieforschung neue Impulse verleihen. Schreib- und Leseschwierigkeiten haben ihre Ursache nicht selten in der mangelnden Fähigkeit, Wörter als Ganzes zu erkennen, und hier könnte in der Tat die Ausbildung eines funktionierenden Wortformenareals in Mitleidenschaft gezogen worden sein.
Keine Ausnahme macht da jener Apparat des Hirns, der uns die Fähigkeit beschert, Texte zu lesen: Sein Aufbau ist schon länger bekannt, die Frage "Wie genau speichert das Gehirn Wörter ab?" aber gilt nach wie vor als hartes Problem. Nun fanden Wissenschaftler eine erste Antwort: Für jeden gelesenen Ausdruck hält das Gehirn eine Handvoll eigener Erkennungsneuronen bereit.
Psycholinguistische Studien hatten bereits die Existenz einer solchen Lexikon-Komponente vorausgesagt. Sie müsste sich um einzelne, komplette Begriffe kümmern und von erfundenen Pseudowörtern – also orthografisch korrekten, aber bedeutungslosen Buchstabenketten – unterscheiden. Gäbe es sie nicht, hätten wir beim Lesen mühsam jedes Wort aus dem Buchstabensalat herauszuklamüsern. Mit zunehmender Übung erkennen wir jedoch meist die Einheiten wie von selbst. Eines der am Leseprozess beteiligten Hirnareale haben Forscher deshalb bereits voll Zuversicht auf den Namen "visuelles Wortformenareal" getauft. Sitzt hier der neuronale Duden?
Wo schlägt das Hirn die Wörter nach?
Es liegt am Ende einer hierarchisch gegliederten Kette von Spezialbereichen, die sich vom oberhalb des Nackens gelegenen Sehzentrum in die untere, linke Hemisphäre zieht. Je weiter man ihr folgt, desto sprachbezogener werden die jeweils bewältigten Aufgaben. Anfangs stehen grafische Merkmale von Buchstaben im Mittelpunkt, dann die Erkennung der Lettern an sich und schließlich Buchstabenketten aus zwei, dann vier Zeichen. Die Kette endet in eben jenem visuellen Wortformenareal. Doch es wäre auch zu schön gewesen: Seine Funktion blieb rätselhaft. Forscher, die es im Hirnscanner untersuchten, erhielten nur unzusammenhängende Aktivitätsmuster als Antwort. In Frage kam deshalb eher eine Aufgabe in der Buchstabenverarbeitung unterhalb der Wortebene.
Forscher um Maximilian Riesenhuber von der Georgetown University in Washington wollen jetzt dennoch den Beweis erbracht haben: Das visuelle Wortformenareal sei genau das von den Psycholinguisten geforderte Wörterbuch im Hirn. Auch sie verwendeten Hirnscans mit der funktionellen Magnetresonanztomografie (fMRT), griffen bei der Erhebung der Daten aber zu einem Trick.
Für jeden Ausdruck, den wir gelernt haben, so die Forscher, gäbe es dort spezialisierte Neuronenverbände, die sich beim Lesen aktivieren. Die Misserfolge früherer Studien erklären sie mit der groben Auflösung des fMRT, die eigentlich klar abgrenzbare Nervenreaktionen über einen relativ großen Bereich innerhalb des Areals verschmiere.
Ein Trick mit dem Hirnscanner
Um dennoch die spezialisierten Zellpopulationen auszulesen, konzentrierten sie sich allein auf den Vergleich von Wortpaaren. Genauer gesagt setzten sie die Reaktionen auf ein Paar ähnlich aussehender Wörter wie "Wurm" vs. "Turm" mit der Reaktion auf ein Paar grundverschiedener Wörter ("Wurm" vs. "Haus") in Beziehung. Sie fanden keine signifikanten Unterschiede zwischen den Paarungen, egal ob die Wörter einander ähnlich sahen oder nicht. Die Forscher schließen also: Im visuellen Wortformenareal spielen orthografische Aspekte keine Rolle mehr, hier geht es nur um komplette Ausdrücke.
Erst als Riesenhuber und Kollegen Pseudowörter ins Spiel brachten, machten sich orthografische Ähnlichkeiten bemerkbar. So schaffte es ein Wort wie "Gurm" durchaus, Verbände wie "Turm" und "Wurm" zu aktivieren, allerdings nur deutlich schwächer, denn keiner der spezialisierten Detektoren sprang vollständig an. "Gurm" ist eben nicht im Duden verzeichnet – weder im gedruckten, noch im neuronalen.
Noch vor wenigen Jahren wären Wissenschaftler wenig geneigt gewesen, die Existenz solch simpler Detektoren außerhalb der einfachen Sinneswahrnehmung anzunehmen. Wörter schienen nach deutlich komplexeren Mechanismen zu verlangen. Auch dies vielleicht ein Grund dafür, dass die Suche nach der Funktion des Wortformenareals so lange ergebnislos blieb.
Nun will das Team um Riesenhuber mit seinen Befunden auch der Legasthenieforschung neue Impulse verleihen. Schreib- und Leseschwierigkeiten haben ihre Ursache nicht selten in der mangelnden Fähigkeit, Wörter als Ganzes zu erkennen, und hier könnte in der Tat die Ausbildung eines funktionierenden Wortformenareals in Mitleidenschaft gezogen worden sein.




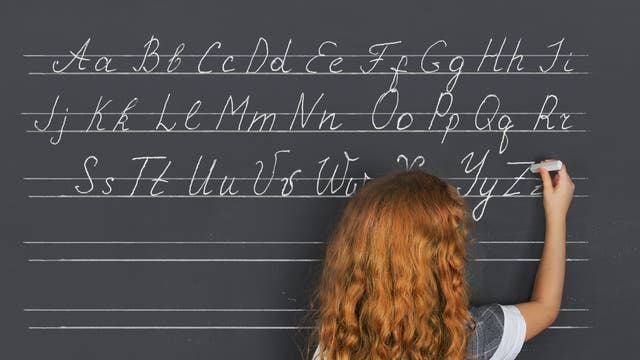

Schreiben Sie uns!
Beitrag schreiben