Stress in der Partnerschaft: »In jeder Krise liegt auch eine Chance«

Auch wenn sich manche Paare im Alltag nach mehr Zweisamkeit sehnen: Den ganzen Tag gemeinsam zu verbringen – etwa im Urlaub oder auf Grund der Corona-Pandemie –, kann mitunter zur Belastungsprobe werden. Der eine will lesen oder arbeiten, der andere würde gerne reden oder gemeinsam kochen: Da sind Konflikte vorprogrammiert. Vor allem, wenn es wenig Möglichkeiten gibt, räumlich auf Abstand zu gehen. Marcel Schär Gmelch vom Zentrum für Klinische Psychologie und Psychotherapie in Zürich erklärt, was Paare am meisten belastet, woran Partnerschaften scheitern und warum es der Liebe sogar guttut, wenn das Idealbild des Partners zerbricht.
»Spektrum.de«: Ausgangsbeschränkungen, Kontaktverbote, Homeoffice – die vergangenen Wochen und Monate haben Paare vor besondere Herausforderungen gestellt. Was bedeuten Extremsituationen wie die Coronakrise für Paare?
Marcel Schär Gmelch: Das lässt sich nicht generell sagen. Für manche ist es schön, weil sie dadurch etwas mehr Zeit miteinander verbringen können. Andere sehen sich wiederum eher seltener und sind gestresst, weil einer oder beide im Gesundheitssystem oder anderswo arbeiten, wo sie stark eingebunden sind. Schließlich gibt es Paare, für die es sehr belastend ist, lange Zeit zusammen auf engem Raum zu leben. Das birgt die Gefahr, dass Konflikte eskalieren – sowohl psychisch als auch körperlich.

Was belastet Partnerschaften in solchen Situationen besonders?
Kurz gesagt: die Unsicherheit. Wir alle wollen in einer sicheren Welt leben und tun alles dafür, damit uns die Welt sicher erscheint. Brechen große Veränderungen oder globale Bedrohungen über uns herein, merken wir, dass diese Welt längst nicht so sicher ist, wie wir gedacht haben. Das löst eine große Verunsicherung in uns aus. Unsicherheiten auf der gesundheitlichen, finanziellen oder beruflichen Ebene führen dazu, dass wir gestresster und gereizter sind als sonst. Wenn wir gleichzeitig eng aufeinandersitzen und in gewisser Weise auf den Partner angewiesen sind, verstärken sich bestehende Konflikte. Die zentrale Frage in Partnerschaften sollte deshalb sein: Wie gehen wir gemeinsam und konstruktiv mit dieser Verunsicherung um?
In Ihren Forschungsarbeiten ist in diesem Zusammenhang von »dyadischem Coping« die Rede. Was bedeutet das?
Diesen Begriff hat vor allem mein Kollege Guy Bodenmann geprägt. Er bedeutet in etwa: Wie können wir gemeinsam mit Stress umgehen? Bodenmanns Grundidee, die mehrfach empirisch bestätigt wurde, ist, dass sich Stressoren negativ auf unsere Partnerschaft auswirken, auch wenn sie nicht direkt etwas mit ihr zu tun haben. Die Frage ist: Wie schaffen wir es, sie unsere Beziehung nicht negativ beeinflussen zu lassen? Ich bin überzeugt, dass uns Krisen an unsere persönlichen Schwächen heranführen. Jeder Konflikt, den wir in einer Partnerschaft haben, gibt uns einen Hinweis darauf, wie wir uns weiterentwickeln können.
Kann also eine Krise auch eine Chance darstellen, die Partnerschaft zu stärken?
Im besten Fall: ja. In jeder Krise liegt auch eine Chance. Zuallererst ist sie jedoch eine Enttäuschung. Sie zeigt uns unsere Grenzen und deckt unsere Illusionen auf, nicht nur in Bezug auf uns selbst, sondern ebenso auf unseren Partner. Es ist nicht einfach, damit umzugehen, aber genau hier liegt eine Chance. Wenn wir es schaffen, daraus zu lernen und uns weiterzuentwickeln, kann uns eine Krise neue Möglichkeiten bieten. Verfallen wir allerdings in ein Muster, bei dem wir die Verantwortung für unsere Gefühle, Gedanken und Handlungen abgeben und andere für unseren Stress verantwortlich machen, schlittern wir oft in eine noch tiefere Krise.
Müssen wir bedingt durch die Coronavirus-Pandemie mit mehr Trennungen und Scheidungen rechnen?
Vermutlich kann nicht jedes Paar die Krise als Chance nutzen. Ich weiß aber nicht, ob es wirklich mehr Trennungen geben wird. Ich glaube eher, dass eine Zuspitzung stattfindet: von Stress und Unzufriedenheit sowie eine Gewalteskalation bei Paaren und in Familien.
Was genau meinen Sie mit Zuspitzung?
Ein paar Trennungen ereignen sich vielleicht früher, als sie ohnehin stattgefunden hätten. Die Krise führt ganz sicher zu einer höheren Belastung in Partnerschaften. Einige Paare können damit nicht umgehen. Unglückliche Partner leiden dann noch mehr als zuvor. Durch die soziale Distanzierung kommt zudem ein weiterer negativer Effekt hinzu: Die Paare haben sich isoliert, um das Virus nicht zu verbreiten. Geraten sie in Konflikte, bräuchten sie jedoch eigentlich Hilfe von außen. Schon unter normalen Bedingungen tun sich Paare schwer damit, diese anzunehmen: Studien aus den USA zeigen, dass 90 Prozent der Paare, die sich trennen, vorher nie irgendeine Form von professioneller Hilfe in Anspruch genommen haben. Es ist also wichtig, dass es Möglichkeiten gibt, sich trotz der Isolation Unterstützung zu holen – und dass die Paare bereit sind, dies zu tun.
Kann eine Paartherapie per Videochat eine solche Möglichkeit sein?
Auf jeden Fall. Doch ich würde empfehlen, dass jeder an seinem eigenen Computer sitzt. Das macht es für den Paartherapeuten einfacher, weil es für die Partner viel schwieriger ist, einander zu unterbrechen oder parallel miteinander zu sprechen.
Wie muss eine Paartherapie generell aussehen, damit sie wirken kann?
Das hängt von vielen Faktoren ab: in erster Linie natürlich vom Paar selbst und vom Therapeuten. Der Paartherapeut oder die Paartherapeutin sollte fähig sein, zu beiden Partnern eine wertschätzende und wohlwollende Beziehung aufzubauen. Beide müssen sich wohlfühlen. Sie müssen auf einer tiefen Ebene verstehen: Ich bin verantwortlich für unsere Partnerschaft. In der Regel machen wir ausschließlich den anderen für unser Unglück verantwortlich. Eine Therapie kann gelingen, wenn jeder versteht, was er oder sie beitragen kann, um die Partnerschaft positiver zu gestalten.
Woran scheitern Partnerschaften am häufigsten?
Ich glaube, sie scheitern am häufigsten an den eigenen Erwartungen. Wir haben so viele Ideen davon, was unser Partner alles können und machen müsste, um uns glücklich zu machen. Wenn wir dann erkennen, dass er oder sie das so nicht erfüllen kann, sind wir tief enttäuscht.
»Die Liebe ist kein Geschenk, man muss sie lernen«
Marcel Schär Gmelch
Wie können wir diese Herausforderung meistern?
Zu erkennen, dass der Partner vielleicht nicht der Traumprinz oder die -prinzessin ist, birgt eine große Chance. Denn auch wir selbst sind nicht perfekt. Den anderen in seinem Makel zu lieben – genau das ist die Kunst. Sich zu lieben heißt, sich gegenseitig so zu sehen und anzunehmen, wie man wirklich ist. Wir müssen wegkommen von irgendeinem Bild des anderen, in das wir uns verliebt haben. Sich zu lieben und sich zu verlieben sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Wenn wir uns gegenseitig mit all unseren Schwächen zeigen können, entsteht Liebe auf einer ganz anderen Ebene. Die Liebe ist kein Geschenk, man muss sie lernen.
Sind nicht oft auch fehlende Kommunikation und ein schlechter Umgang mit Konflikten schuld daran, dass eine Partnerschaft zerbricht?
Das ist die logische Konsequenz daraus. Wenn ich enttäuscht bin, weil mein Partner nicht so ist, wie ich ihn gerne hätte, gibt es Konflikte. Weil ich denke, der andere müsste mehr oder weniger Sex wollen, mehr oder weniger zärtlich sein, mehr oder weniger reden. Aber wir können niemanden verändern, wir schaffen es ja kaum, uns selbst zu verändern. Das Einzige, was wir tun können, ist, unser Verhalten zu verändern: Wir müssen lernen, mit unseren Enttäuschungen umzugehen – und manchen Wunsch und manche Hoffnung aufgeben.
Gemeinsam mit der Psychologin Beate Ditzen haben Sie auch erforscht, was beim Streiten im Körper passiert.
Grundsätzlich ist Streit nichts anderes als Stress. Deshalb löst er auf physiologischer Ebene die Ausschüttung typischer Stresshormone wie Kortisol (siehe »Das Stresssystem unseres Körpers«) aus. Schon feinste Berührungen führen hingegen dazu, dass Oxytozin freigesetzt wird, das landläufig auch als Bindungshormon gilt. Wir wissen, dass körperliche Nähe wichtig ist für die Versöhnung: um innere Verletzungen nicht allzu tief werden zu lassen.
Das Stresssystem unseres Körpers
Eigentlich schützt uns die Stressreaktion unseres Körpers vor Gefahren. Bestimmte Hormone sorgen dafür, dass unser Körper sich auf Flucht oder Kampf einstellt, sobald wir eine Gefahr erkannt haben. Doch nicht nur wenn Gefahr für Leib und Leben besteht, auch bei psychischem Stress, etwa Angst oder Streit, wird diese Maschinerie angeworfen. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Amygdala. Das ist ein kleiner, mandelförmiger Bereich im Inneren unseres Gehirns, der für die Bewertung von Situationen und Gefahren zuständig ist. Gemeinsam mit anderen Hirnregionen steuert die Amygdala unsere Stressreaktion. Das kann über zwei Wege geschehen:
1. Über das sympathische Nervensystem: Nervenstränge im Rückenmark können Stresssignale aus dem Gehirn, genauer gesagt dem Hypothalamus, direkt an Organe wie Herz, Bronchien oder die Augen weitergeben. So werden wir wacher und leistungsfähiger. Zudem wird die Nebenniere aktiviert, sie produziert Adrenalin und Noradrenalin, die unseren Blutdruck in die Höhe treiben und dafür sorgen, dass unsere Muskeln optimal mit Zucker und Sauerstoff versorgt werden.
2. Über die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse, kurz HPA-Achse: Der Hypothalamus aktiviert nicht nur den Sympathikus, sondern schüttet auch Botenstoffe aus, zum Beispiel das Corticotropin-Releasing-Hormon (CRH). Das Hormon aktiviert eine etwa erbsengroße Drüse im Gehirn, die Hypophyse. Sie schüttet dann ihrerseits das Hormon Adrenocorticotropin (ACTH) aus. ACTH gelangt ins Blut und regt die Nebennierenrinde dazu an, das Stresshormon Kortisol zu produzieren. Dieses Glukokortikoid hat in unserem Körper zahlreiche Aufgaben: So kurbelt es beispielsweise unseren Stoffwechsel an und dämpft unser Immunsystem.
Kann man am Körper ablesen, ob ein Paar »gut« oder »schlecht« streitet?
Manche Forscher haben versucht, das über spezielle Parameter zu bestimmen. Aber so einfach ist das nicht. Zum einen sagt der Mittelwert nichts über die Einzelpersonen aus. Ist jemand etwa für längere Zeit chronisch gestresst, schüttet er weniger Kortisol aus als andere Menschen, die weniger gestresst sind, wenn es zu einer konkreten Belastungssituation, zum Beispiel zu einem Streit, kommt. Zum anderen sind unser Körper, die Liebe und unsere sozialen Beziehungen viel komplexer, als irgendwelche Parameter erfassen könnten. Jede Partnerschaft ist anders, jeder hat eine andere Vorstellung davon, wie eine glückliche Beziehung aussieht – und jeder streitet anders. Zu einem gewissen Teil ist das Typsache.
Mit Frau Ditzen haben Sie auch die Wirkung von Oxytozin auf die Kommunikation von Paaren untersucht. Funktioniert das: einen Harmonie-Duftstoff inhalieren, und schon streiten wir weniger?
Die Idee hinter der Studie war nicht, ein neues Medikament zu entwickeln, das Partnerschaftskonflikte löst. Wir haben versucht, das Oxytozin-Level der Probanden mit Hilfe eines Sprays anzuheben, um einen physiologischen Mechanismus zu untersuchen. Dabei entdeckten wir, dass die Paare sich im Streit tatsächlich weniger verletzend verhielten. Manchmal ist es wichtiger, den Moment zu lösen als das Problem – und einen Konflikt zu beenden, bevor er eskaliert. Ich glaube aber nicht, dass ein Oxytozin-Spray hierfür das richtige Mittel ist. Dazu ist seine Wirkung zu gering.
Wie ist das mit Paartherapien? Wirken sie sich ebenfalls auf körperlicher Ebene aus?
Grundsätzlich ja. Wenn man lernt, dass ein Thema, das Konfliktpotenzial birgt, nicht zu massiven Verletzungen führt, hat man weniger Stress. Man kann Meinungsverschiedenheiten – und dem Partner allgemein – offener und wohlwollender gegenübertreten. Das hat natürlich auch Konsequenzen auf der physiologischen Ebene: Das gesamte Stresssystem wird weniger stark hochgefahren. Das kann man wiederum anhand von Hormonen, im Speichel oder im Blut, nachweisen.
Haben Sie konkrete Tipps, wie Paare in Situationen, in denen sie eng aufeinandersitzen, auch ohne professionelle Hilfe Streit vorbeugen können?
Man sollte sich fragen: Ist es das jetzt wirklich wert, einen Streit eskalieren zu lassen? Wenn man eng aufeinandersitzt und merkt, dass sich immer mehr Spannung aufbaut, ist es besser, sich erst einmal abzulenken und etwas anderes zu tun – Musik hören oder ein Video anschauen zum Beispiel. Man sollte erst dann wieder auf das Thema zu sprechen kommen, wenn sich die Gemüter beruhigt haben. Oder wie der israelische Psychologe Haim Omer sagt: »Schmiede das Eisen, wenn es kalt ist.« Außerdem sollte man sich überlegen: Was hat die Wut, der Ärger, die Angst, die Traurigkeit, die ich jetzt gerade in mir verspüre, mit mir und meiner aktuellen Situation zu tun? In der Regel übergehen wir diese Frage schnell und geben dem anderen die Schuld. Schauen wir genau hin, bemerken wir, dass es auch immer Möglichkeiten gibt, etwas an uns selbst zu verändern.





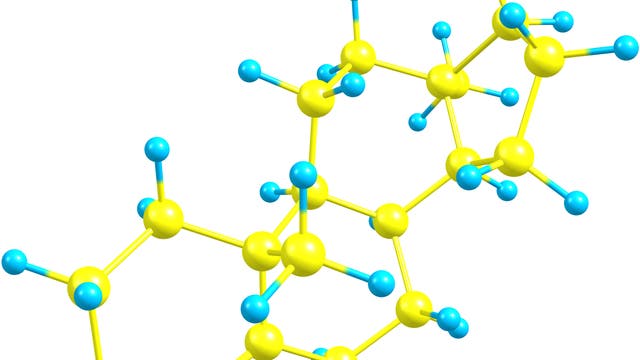
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.