Masern: Eine Bedrohung für die globale Gesundheit
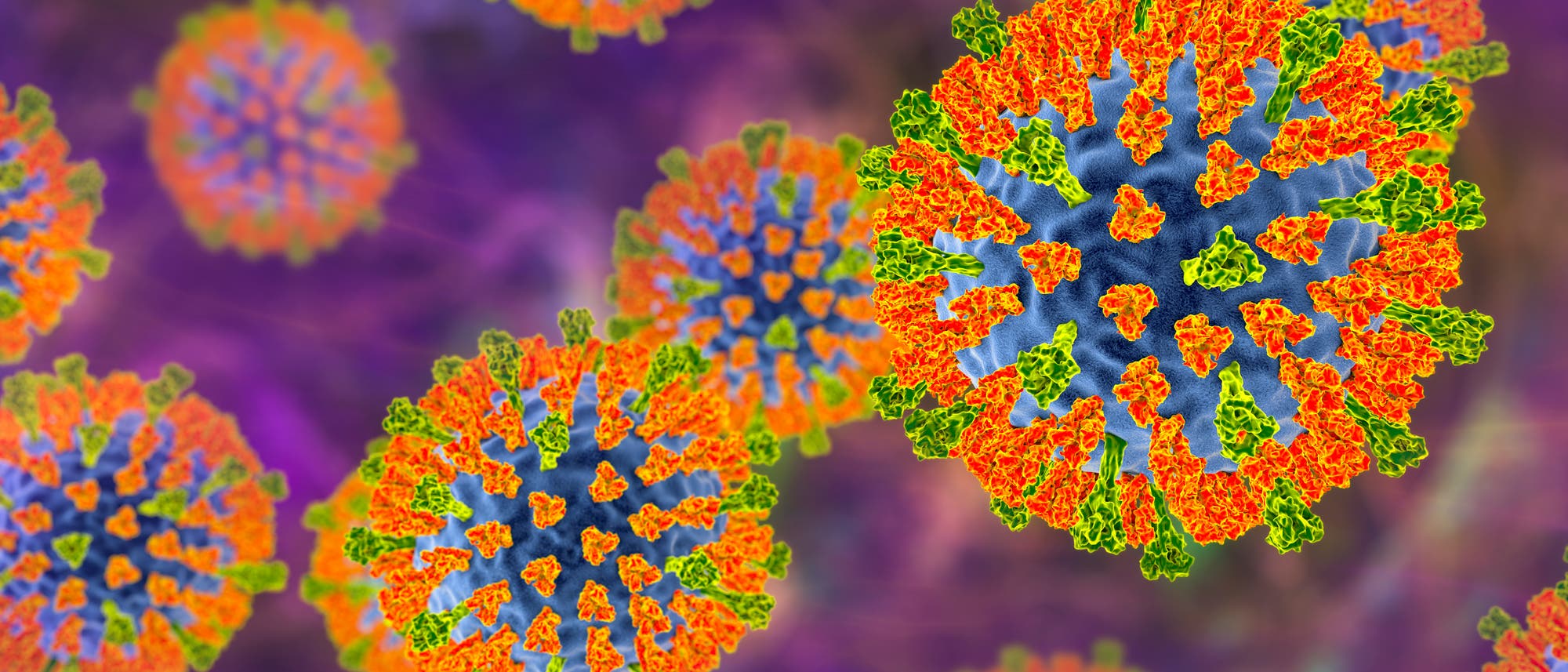
Obwohl es seit Jahrzehnten eine sichere und wirksame Impfung gegen Masern gibt, sterben weltweit jährlich Zehntausende Menschen an der Infektionskrankheit, vor allem Kinder. In Deutschland besteht eine hohe Impfquote. Aber auch hierzulande kommt es immer mal wieder zu Häufungen von Krankheitsfällen bei ungeschützten Personen – wie kürzlich in Karslruhe. Hier sind mittlerweile 16 Menschen aus vier Familien betroffen, darunter ungeimpfte Kinder und Erwachsene. Sie alle hatten im Oktober Veranstaltungen im Christlichen Zentrum Karlsruhe besucht. Masernausbrüche sind im Südwesten selten. Im vergangenen Jahr hatte es laut dpa 73 Fälle gegeben, auch in diesem Jahr waren bereits Fälle gemeldet worden.
Noch steht das Ziel der Weltgesundheitsorganisation (WHO): Bis 2030 soll möglichst kein Mensch auf der Welt mehr an den Masern erkranken. Doch das ambitionierte Vorhaben, sämtliche Infektionsketten auf dem Planeten zu unterbrechen, kommt immer wieder ins Wanken. Zu nennen ist etwa ein großer Ausbruch in den USA zu Jahresanfang. In Europa, Südostasien, dem östlichen Mittelmeerraum und Afrika waren tausende Menschen betroffen. Was sind die Ursachen für solche Ausbrüche? Was für Maßnahmen müssen global ergriffen werden und warum sind Impfungen so wichtig?
Wo erkrankten in letzter Zeit besonders viele Menschen an Masern?
Nicht alle erkrankten Personen suchen eine Arztpraxis auf, die geschätzte Dunkelziffer ist hoch. So meldeten Behörden 2023 insgesamt 306 000 Masernfälle mit zum Teil erheblichen Ausbrüchen in 57 Ländern. Laut Modellrechnungen waren jedoch um die 10,3 Millionen Menschen betroffen, etwa 107 500 davon starben laut der Schätzungen. Die meisten von ihnen waren jünger als fünf Jahre. Sie verloren ihr Leben durch eine Infektionskrankheit, die mit einer Impfung vermeidbar ist.
Ob gemeldet oder geschätzt: Sicher ist, die Zahlen weltweit steigen. Die Masern bleiben trotz der Eliminierungspläne also eine erhebliche Bedrohung für die globale Gesundheit. Für das Jahr 2024 meldete die WHO 359 521 Fälle, das sind ungefähr 53 500 mehr als im Jahr davor. Rund ein Drittel und damit 127 350 Infektionen fielen auf die »europäische Region«, die 53 Länder in Europa und Zentralasien umfasst – die meisten davon in Rumänien und Kasachstan. Die Masern kamen damit 2024 mehr als doppelt so häufig in Europa vor als 2023. »Die Masern sind zurück, und das ist ein Weckruf«, sagt Hans Henri P. Kluge, WHO-Regionaldirektor für Europa, gegenüber »The Conversation«.
Wie sind die zum Teil sprunghaften Anstiege zu erklären?
Wenn Epidemiologen über die Ausbreitung der Masern sprechen, gebrauchen sie hin und wieder das Bild von dem Kanarienvogel in der Kohlenmine. Wenn der sangesfreudige Vogel, den die Bergarbeiter in einem Käfig mitführten, verstummte, war das ein Warnsignal: Die Luft war schlecht, der Sauerstoff im Stollen wurde knapp. Auch die Masern sind ein Hinweisgeber – und zwar auf schlechte Impfquoten: »Masernausbrüche können ein Indikator für gesundheitliche Ungleichheiten sein und dazu beitragen, Lücken in Impfprogrammen in der primären Gesundheitsversorgung aufzudecken«, steht in einer gemeinsamen Strategieschrift von WHO, Unicef, CDC und anderen Organisationen.
»Die Masern sind zurück, und das ist ein Weckruf«Hans Henri P. Kluge, WHO-Regionaldirektor für Europa
In 82 Ländern war die Eliminierung der Masern bis Ende des Jahres 2023 erreicht – ein fragiler Erfolg. Denn Ausbrüche können nur bei einer Impfquote von mehr als 95 Prozent der Bevölkerung verhindert werden. Doch diesen Wert erreicht aktuell nur ein Drittel der 82 Länder. »Ohne hohe Impfraten gibt es keine Gesundheitssicherheit«, sagt HenriP. Kluge. Dort wo das Virus, das auch aus anderen Kontinenten eingeschleppt werden kann, auf eine kritische Menge an nicht geimpften oder nicht ausreichend geimpften Menschen trifft, kommt es zu einem Ausbruch.
Was sind die Ursachen für Impflücken?
2023 erhielten weltweit 22 Millionen Kinder nicht ihre erste (von zwei notwendigen) Impfdosen. In Europa lag diese Zahl bei 500 000. Hierfür lassen sich mindestens vier Ursachen ausmachen: Überall auf dem Globus gibt es Kriege und Konflikte, in vielen Ländern sind die Ressourcen im Gesundheitssektor knapp, die Coronapandemie hat ihre Spuren hinterlassen und in einigen Teilen der Welt gibt es eine zunehmende Impfzurückhaltung oder Impfskepsis.
Dort wo Kriege und Konflikte ein Land beherrschen, fehlt mitunter die benötigte Infrastruktur. Geflüchtete und Vertriebene sind zudem häufig nicht in nationale Impfprogramme eingeschlossen. Während der Coronapandemie kamen geplante Impfaktionen oft nicht zu Stande, Ressourcen mussten wegen der Bedrohung durch das neue Sars-CoV-2 umgeschichtet werden, Gesundheitseinrichtungen blieben aus Sorge vor einer Ausbreitung nur unter strengen Kontrollen geöffnet. In einigen Ländern im Globalen Süden sank die Masernimpfquote bei Kindern zu Beginn der Pandemie zum Teil um fast 25 Prozent. Wie eine Studie aus 2024 zeigt, ist sie immer noch nicht auf Normalniveau.
Möglicherweise haben die Diskussionen um die Coronaimpfung oder gar eine Impfpflicht der Akzeptanz altbewährter Immunisierungen, wie dem Masern-Mumps-Röteln-Impfstoff (MMR), geschadet. Falschinformationen halten sich hartnäckig, obwohl die These, der Masernimpfstoff würde Autismus erzeugen, mehrfach eindeutig widerlegt wurde.
»Die Impfung ist ein Akt der Solidarität. Wenn wir uns selbst schützen, schützen wir auch andere«Pamela Rendi-Wagner, Direktorin der ECDC
Zu allem kommt das Präventionsparadox: Weil es die Masern vielerorts wegen der Impfungen nicht mehr gibt, glauben Eltern, das Risiko für ihr eigenes Kind sei extrem gering, argumentiert Michael Mina, US-Mediziner und Epidemiologe. »Dann kann es sein, dass du eine 35-jährige Mutter vor dir hast, die sagt: Ich habe die Masern nie erlebt, warum sollte ich dann meinem Kind den Impfstoff spritzen lassen?«, sagt Mina gegenüber »The Scientist«.
In den USA sind selbst von oberster Stelle, dem amtierenden Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr., kritische Töne über Impfungen zu hören. In einem Interview mit Fox News behauptete er, die MMR-Impfung würde jedes Jahr Todesfälle verursachen. Das ist falsch, urteilt die Fachgesellschaft Infectious Diseases Society America: Es gebe keine Todesfälle bei gesunden Personen durch die MMR-Impfung. Zum Tode können eher die Masern selbst führen – wie 2025 bei zwei nicht geimpften Kindern und einem nicht geimpften Erwachsenen in Texas beziehungsweise New Mexico. Sie sind damit die ersten Maserntoten in den USA seit 22 Jahren.
Warum sind die Masern so gefährlich?
Die Masern sind keine harmlose Kinderkrankheit. Die ersten typischen Symptome nach einer Ansteckung sind hohes Fieber, Husten und Schnupfen. Der Ausschlag, hellrote, drei bis sechs Millimeter große Flecken, erscheint meist zuerst im Gesicht und breitet sich von dort am ganzen Körper aus. Nach Angaben des CDC entwickelt eines von 20 erkrankten Kindern eine Lungenentzündung, eines von 1000 eine Entzündung des Gehirns, die zum Erblinden, zu Gehörverlust oder Krampfanfällen führen kann. 1 bis 3 von 1000 Kindern mit Masern sterben an der Infektionskrankheit. In sehr seltenen Fällen entwickelt sich bis zu zehn Jahre nach der akuten Infektion eine neurodegenerative Erkrankung, die so genannte subakute sklerosierende Panenzephalitis, die meist tödlich endet.
Doch selbst wenn die Masern ohne offensichtliche Beeinträchtigungen überstanden sind, wirkt die Infektion mitunter noch lange nach. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass die Sterblichkeit der Kinder noch bis zu zweieinhalb Jahre erhöht sein kann. Der Grund: Das Masernvirus infiziert in der Krankheitsphase manche Zellen des Immunsystems, die das immunologische Gedächtnis ausbilden. Die Zellen sterben und es entsteht eine »Immunamnesie«. Dabei gehen bereits gebildete Antikörper verloren, die das Kind sonst vor Herpes-, Entero-, Tetanus- oder auch Grippeerregern geschützt hätten.
Wieso sind Impfungen so wichtig?
Die Masern sind eine der ansteckendsten Krankheiten überhaupt. Das Virus breitet sich über das Einatmen infektiöser Tröpfchen sowie durch den Kontakt zu infektiösen Sekreten aus. Neun von zehn nicht geimpften Personen, die ihm ausgesetzt sind, werden die Krankheit bekommen. Ein Infizierter steckt im Durchschnitt 12 bis 18 andere Nichtgeimpfte an. Der Impfstoff ist der beste Schutz vor dem Virus. Vor Einführung der Masernimpfung in den 1970er Jahren gab es weltweit jährlich rund 30 Millionen Krankheitsfälle, über zwei Millionen Menschen starben jedes Jahr daran. Die Immunisierung erfolgt mit einem abgeschwächten Lebendimpfstoff in Kombination mit der Impfung gegen Mumps und Röteln. Die STIKO empfiehlt: »Babys und Kleinkinder sollen die erste MMR-Impfung im Alter von elf Monaten erhalten. Die zweite Impfung sollte frühestens vier Wochen nach der ersten Impfung, im Alter von 15 Monaten durchgeführt werden.« Die Wirksamkeit einer zweifachen Impfung liegt bei 98 bis 99 Prozent, schreibt das RKI. Eine einfache Impfung schützt bereits 92 Prozent der Geimpften vor einer Masernerkrankung.
»Der Masernimpfstoff hat in den letzten 50 Jahren mehr Leben gerettet als jeder andere Impfstoff«Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO-Generaldirektor
»Der Masernimpfstoff hat in den letzten 50 Jahren mehr Leben gerettet als jeder andere Impfstoff«, sagte Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO-Generaldirektor, in einer Pressemeldung. Einer Schätzung zufolge verhinderte die Immunisierung zwischen 1974 und 2024 global rund 94 Millionen Todesfälle. »Um noch mehr Leben zu retten und zu verhindern, dass dieses tödliche Virus die Schwächsten angreift, müssen wir in die Impfung aller Menschen investieren, unabhängig davon, wo sie leben«, so Ghebreyesus.
Das gilt auch für das deutsche Gesundheitssystem. Seit dem 1. März 2020 gibt es in Deutschland das Masernschutzgesetz. Einen Kindergarten darf grundsätzlich nur besuchen, wer eine Masernimpfung nachweisen kann. Nicht geimpfte Schulkinder müssen wegen der Schulpflicht aufgenommen werden, jedoch melden die Schulen solche Fälle den Gesundheitsämtern, die dann mitunter hohe Bußgelder gegen die Eltern verhängen. Einige Fachleute beurteilen die Entwicklungen bisher als positiv: »Der Anteil zweifach geimpfter Kinder im Alter von 24 Monaten stieg von 70 Prozent (2019) auf 77 Prozent (2023), bei Sechsjährigen stieg der Anteil zweifach Geimpfter von 89 Prozent (2019) auf 92 Prozent (2023)«, berichtet das RKI im »Epidemiologischen Bulletin«. Allerdings seien im Jahr 2023 immer noch sieben Prozent der Kinder im Alter von 24 Monaten und vier Prozent der Sechsjährigen nicht geimpft und damit ungeschützt.
Welche Maßnahmen braucht es nun?
»Um Kinder vor dieser verheerenden und oft tödlichen Krankheit zu schützen, brauchen wir dringend staatliche Maßnahmen und dauerhafte Investitionen in das Gesundheitspersonal«, sagt Regina De Dominicis, die UNICEF-Regionaldirektorin für Europa und Zentralasien, in einer Pressemeldung der WHO. Länder mit Ausbrüchen sollten die Fallermittlungen intensivieren, die Ursachen der Infektionswellen ausmachen und Schwachstellen im Gesundheitssystem erkennen und beseitigen.
Das gilt einmal mehr für Länder in Regionen Afrikas oder des östlichen Mittelmeerraums, die von Konflikten betroffen sind. Es braucht leistungsstarke Impfprogramme, geschultes Gesundheitspersonal und eine aufgeklärte Bevölkerung. Denn: »Die Impfung ist ein Akt der Solidarität. Wenn wir uns selbst schützen, schützen wir auch andere«, sagt Pamela Rendi-Wagner, Direktorin der European Centers for Disease Control and Prevention (ECDC), am 14. März 2025 in einer Pressemitteilung.
Für eine erfolgreiche Aufklärungskampagne ist es wichtig, die Gründe hinter der Impfskepsis mancher Eltern zu verstehen. Kontraproduktiv ist, was in den USA gerade geschieht: Das US-amerikanische National Institute for Health (NIH) hatte am 10. März 2025 verkündet, die Gelder für jene Forschung zu streichen, die untersuchen sollte, welche Ursache die zunehmende Impfmüdigkeit in der Bevölkerung hat und wie sich diese überwinden lässt.
Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Fassung des Textes hatten wir den Tetanuserreger zu einem Virus gemacht. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.