Metzler Lexikon Philosophie: Ethik
Die terminologische Verwendung des Begriffs ist nicht einheitlich: »E.« wird z.T. gleichbedeutend mit Moralphilosophie gebraucht, z.T. in Differenz dazu, wenn man die Unterscheidung trifft, dass E. sich mit dem Maßstäben des richtigen Handelns ganz allgemein beschäftige (Brentano, Husserl) oder dass E. sich mit Fragen des guten Lebens beschäftige, während Moralphilosophie die Begründungsmöglichkeit von Normen, den Begründungsformen und deren Gültigkeit thematisiere (Habermas). Eine diese Differenzierungen übergreifende Bestimmung von E. kann so getroffen werden: Gegenstand der E. ist das menschliche Handeln, sofern es einem praktischen Sollen genügt und zugleich eine allgemeine Verbindlichkeit zum Ausdruck bringt. Es ist auch die Aufgabe der E., das Streben nach der Seite des Guten – der moralischen Werte und Normen – hin als sinnvoll zu begründen und zu zeigen, was das sich in moralischen Normen und Werten artikulierende Gute ist (Pieper). Die Ethik hat somit gleichermaßen die Moral und die Moralität zu ihrem Gegenstand. Ihre Fragen unterscheiden sich von denen der Moral dadurch, dass sie sich nicht unmittelbar auf singuläre Handlungen und konkrete Handlungssituationen bezieht, sondern auf einer Metaebene moralisches Handeln grundsätzlich thematisiert, indem sie nach dessen Maßstäben, nach dem Moralprinzip oder nach einem Kriterium der Beurteilung von Handlungen fragt und indem sie die Bedingungen untersucht, unter denen moralische Normen und Werte allgemein verbindlich sind (Pieper). – Ethisches Argumentieren beginnt mit der doppelten Erfahrung, dass der Mensch inmitten von Leid, Unrecht und Furcht lebt, dass er schon immer um das Übel verfehlten Lebens weiß, aber über keine gesicherte Erkenntnis bezüglich der Bedingungen gelingender Lebensführung verfügt. Sie gründet also einerseits in der lebensweltlichen Erfahrung von Ungerechtigkeit, Verletzung personaler Integrität, und andererseits in den normativen Ansprüchen bzw. Forderungen an die Handlungsweisen oder Einstellungen der Personen. Sie unterscheidet sich von der Moral als einem faktischen System von naturwüchsig oder konventionell entstandenen Normen, da sie es nicht bei der Beschreibung solcher Normen belässt, sondern die deren Verbindlichkeit thematisiert. Vom Recht unterscheidet die E. sich dadurch, dass sie die Verbindlichkeit verbürgende Instanz nicht in der Sanktionsgewalt des Staates sucht, sondern nach einem subjektiven Verständnis einer solchen Verbindlichkeit fragt. Eine weitere Form ethischer Reflexion beschäftigt sich mit der Frage der Bedeutung moralischer Begriffe. Die sprachanalytisch inspirierte Metaethik erörtert die Bedeutung moralischer Ausdrücke wie »gut«, »richtig«, »sollte« unter dem Vorbehalt der Neutralität bezüglich normativer Gehalte. Derartige Analysen haben ihre Relevanz in der Frage, ob solche Wörter rein subjektiv als Ausdruck einer emotionalen Gefühlseinstellung zu interpretieren sind, oder ob sie insoweit kognitiven Gehalt haben, dass über ihren Geltungsbereich auf rationale Weise diskutiert und entschieden werden kann. Solche Sprachanalysen lassen die Fragen, wie die Begründung der Moral zu erreichen ist, unbeantwortet.
Insofern die E. darauf abzielt, Gründe für die Anerkennung (oder Verwerfung) von Normen und Werten benennen zu können, stellt sie eine Reflexion über sozial geltende und traditional vermittelte normative Gehalte dar. Das Interesse an der Frage, wie wir handeln sollen, führt zu dem Anspruch einer normativen E., die Normativität überhaupt zu begründen und damit einen Maßstab zu entwickeln, an dem sich geltende Normen überprüfen lassen, ob ihr Anspruch auf unbedingte Gültigkeit berechtigt ist. Ein anderer Problembereich der E. befasst sich mit den notwendigen Voraussetzungen, die wir immer schon machen, wenn wir die Handlung einer Person beurteilen. Er betrifft die Fragen, ob wir die Freiheit der Entscheidung für eine Handlung bzw. für oder gegen eine Handlungsmöglichkeit haben (Determination). Die ethische Bewertung einer Handlung setzt Zurechnungsfähigkeit voraus. Das bedeutet nach der objektiven Seite hin, dass die als Handlung gedeutete Tätigkeit kein naturhaftes Ereignis sein darf, das in Ursache-Wirkungs-Kategorien zu beschreiben wäre; in diesen Zusammenhang gehört die Diskussion über die Freiheit des Menschen, die Differenzierung zwischen Handlungs- und Willensfreiheit. Nach der subjektiven Seite hin setzt die Zurechnungsfähigkeit voraus, dass die Handlung freiwillig und mit Absicht vollzogen wurde. Um das Spektrum der ethischen Problemstellungen hinreichend umgrenzen zu können, ist eine genaue Charakterisierung der Handlungstypen erforderlich: Der Typus der produktiven Handlung umfasst den Aspekt der durch die Handlung bewirkten Veränderungen und Folgen (für andere Personen), die präventive Handlung den Aspekt der vorbeugenden oder verhindernden Aktivität, die intermissive Handlung den Aspekt der Unterlassung (in Bezug auf einen Handlungskontext) (Riedel).
Das ethische Problem macht sich zunächst dadurch bemerkbar, dass der Einzelne selbst unter der Bedingung einer vorgegebenen Ordnung sich der Richtigkeit seiner Handlung vergewissern muss. Die Reichweite dieser Vergewisserung und damit auch der Begründungsanspruch richtet sich danach, in welchem Ausmaß die vorgegebene Ordnung noch eine allgemeine Begründungsebene darstellt. Weder bei Platon noch bei Aristoteles ist die Idee des Guten, die das Handeln bestimmt, losgelöst von der kosmologischen Auffassung einer geordneten Welt zu denken. Der Einzelne kann sich nur in Entsprechung zu ihr adäquat realisieren. Erst wenn dieser allgemeine Ordnungsrahmen seiner absoluten Verbindlichkeit verlustig geht, eröffnet sich das ethische Problem in seinem vollen Umfang. Denn nun wird die Frage nach einem begründenden Prinzip, das an die Stelle der Ordnung zu treten hat, virulent. Eine Möglichkeit der Antwort darauf besteht darin, das natürliche Streben nach Glück in Gestalt der Befriedigung der natürlichen Bedürfnisse als allgemeinen Maßstab des Sittlichen anzugeben. Der Utilitätsgedanke verbindet dabei die naturhafte Seite des Menschen, das Angenehme zu suchen und das Unangenehme zu meiden, mit dem Universalisierungsgedanken in Gestalt des »größten Glücks der größten Zahl« (Bentham). Der Ansatz des Utilitarismus basiert auf Voraussetzungen, die nicht ohne weiteres als eingelöst unterstellt werden können. Das aufgeklärte Selbstinteresse ist ebenso wenig sichergestellt wie die Möglichkeit, die unterschiedlichen Bedürfnisse gegeneinander abzuschätzen und aufzurechnen. Die Formel der »größten Zahl« lässt den Kreis der Betroffenen unbestimmt und lässt ohne ein zusätzliches Prinzip der Gerechtigkeit ethisch nicht legitimierbare Benachteiligungen einer Minderheit zu.
Eine andere mögliche Antwort auf die Frage nach der Grundlage, von der aus der normative Anspruch erhoben werden kann, bietet Kant. Auf dem Standpunkt der Moralität verlangt der Einzelne sich selbst eine unbedingte Verpflichtung ab. Diese Art der Verpflichtung steht in Verbindung mit dem Anspruch auf Selbstbestimmung, der auf adäquate Weise nur dadurch eingelöst werden kann, wenn der Mensch sich nicht von den Einflüssen der Triebe, Begierden und Neigungen leiten lässt. Damit setzt Kant an die Stelle der Naturbestimmung des Menschen die Autonomie des Willens, der sich ein Gesetz gibt und damit auf jede Willkürhandlung verzichtet. Der Begriff der Moralität wird an den unbedingten Anspruch der Freiheit um der Freiheit willen zurückgebunden. Damit ist eine moralische Kompetenz erreicht, die den Einzelnen in den Stand setzt, Rechenschaft über die Gründe seines Handelns abzugeben. Der einzig denkbare Maßstab ist das Freiheitsprinzip i.S. der Autonomie, die sich um der Freiheit aller willen an Normen und Werte bindet, durch die der größtmögliche Freiheitsspielraum für alle ermöglicht wird (Pieper). – Die Hegel’sche Kritik an Kant klagt eine aristotelische Vorstellung ein, nämlich das Praktischwerden der verallgemeinerbaren Maximen in den gesellschaftlichen Strukturen, Interaktionsformen und Institutionen. Der kantische Moralitätsstandpunkt kann nicht mehr ohne Verlust der Selbstbestimmung aufgegeben werden, kritisiert wird aber eine normative E., die das Gute über die Haltung der Moralität des vernünftigen Individuums gemäß dem kategorischen Imperativ zur Geltung bringt. Hegel drängt darauf, subjektive Moralität zur sittlichen Lebensform werden zu lassen. D.h. die Moralität sollte konkrete Gestalt gewinnen in den die Selbstverwirklichung des Menschen ermöglichenden gesellschaftlichen Institutionen. – Marx geht einen Schritt weiter, wenn er die Moral als Erfordernis einer unsittlichen Gesellschaft bezeichnet und dadurch diskreditiert. Wären die gesellschaftlichen Verhältnisse nicht von Klassengegensätzen geprägt, bedürfte es keiner E. Eine solche Auffassung verfängt sich in idealistischen Annahmen. – Der Sache nach wird die Hegel’sche Forderung in den ethischen Positionen der konstruktiven E. und der Diskursethik aufgenommen. In beiden Positionen soll das moralische Urteil erklären, wie auf der Grundlage eines rational motivierten Einverständnisses Handlungskonflikte beigelegt werden können. Die konstruktive E. stellt ein Argumentationsmodell zur Lösung moralischer Konflikte zur Verfügung. Die Probleme, aber auch die Absicht, diese auf verträgliche Art zu lösen, ergeben sich aus dem lebensweltlichen Handlungskontext. Vor jedem Versuch einer Konfliktbeilegung gehen die Opponenten die Selbstverpflichtung ein, sich um eine terminologische Festlegung eines jeden für die Argumentation verwendeten Ausdrucks zu bemühen und ausdrücklich die Typen von Problemen zu benennen, zu deren Lösung die Argumentation beitragen soll. Der Anspruch auf Universalität wird durch gemeinsame Festlegung der Ausdrücke und der allgemeinen Lehrbarkeit von moralischem Argumentieren eingelöst. Durch die Benennung der Typen von Problemen wird die Argumentation darauf beschränkt und in dieser Beschränkung als lösbar erachtet. Die Diskursethik geht denselben Weg einer moralischen Argumentation, für die der Grundsatz gilt, dass nur diejenigen Normen Geltung beanspruchen können, die die Zustimmung aller Betroffenen als Teilnehmer eines praktischen Diskurses finden können. Als zweiter Grundsatz gilt das Universalisierungspostulat, dass bei gültigen Normen die Ergebnisse und Nebenfolgen, die sich aus einer allgemeinen Befolgung für die Befriedigung der Interessen eines jeden ergeben, von allen akzeptiert werden müssen. Das Verfahren einer rationalen Argumentation soll die allgemeine Anerkennung gewährleisten.
Literatur:
- M. Düwell/C. Hübenthal/M. H. Werner (Hg.): Handbuch Ethik. Stuttgart/Weimar 22006
- J. Habermas: Diskursethik – Notizen zu einem Begründungsprogramm. In: Moralbewußtsein und kommunikatives Handeln. Frankfurt 1983. S. 53 ff
- P. Lorenzen/O. Schwemmer: Konstruktive Logik, Ethik und Wissenschaftstheorie. Mannheim 1973. S. 107 ff
- G. Patzig: Tatsachen, Normen, Sätze. Stuttgart 1988
- Ders.: Ethik ohne Metaphysik. Göttingen 1971
- A. Pieper: Pragmatische und ethische Normenbegründung. Freiburg/München 1979. S. 12 ff
- Dies.: Ethik und Moral. München 1985
- M. Riedel: Norm und Werturteil. Stuttgart 1979.
PP
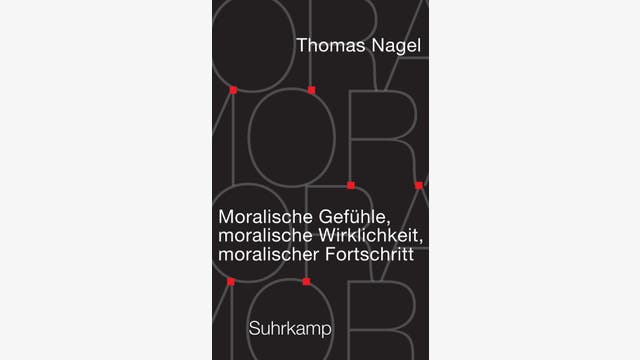



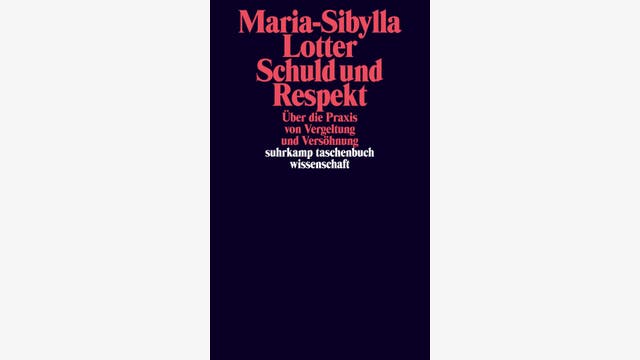
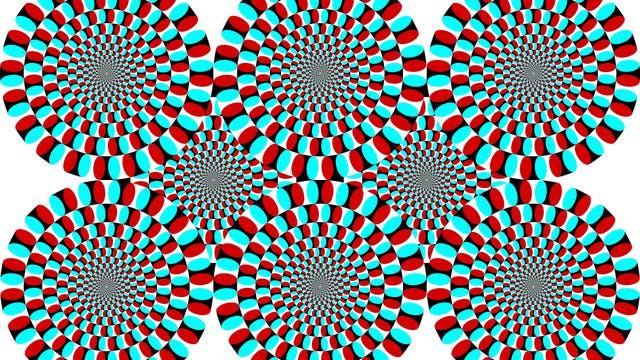


Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.